»Filmbilder bewahren die Zeit. Auch wenn sie Geschichte, vergangene Zeit sind. Immer wenn wir Bilder auf der Leinwand zum Leben bringen, werden diese zu einem Hier und Jetzt, zur Gegenwart. Es scheint jedoch, daß obwohl die Geschichte für die Filmbilder nicht existiert, diese stärker als die Zeit sind. Dauerhafter als die Welt, die vorbeizieht.« – The Time Machine (Peter Delpeut 1996) Die Zeit ist allgegenwärtig und flüchtig mit dem Kino verbunden: Erst in ihrem Verlauf entsteht während der Projektion aus den auf einem Streifen Zelluloid angeordneten Bildern Film. Henri Bergson sagt: »Zeit ist Erfindung oder gar nichts. «Zeit hat also ein fiktionales Potential. Deshalb ist es nicht überraschend, daß Zeit in unzähligen Filmen als Motiv aufgegriffen wird oder gar die Erzählung strukturell prägt. Für das vorliegende CINEMA haben sich verschiedene Annäherungsweisen an das Phänomen der Zeit herauskristallisiert: Ein erster Schwerpunkt liegt in der Beschäftigung mit der Zeit als Darstellungsphänomen und -problem. Martin Schaub stellt vor und kommentiert, wie die Filmzeit in Theorie und Praxis, in Philosophie und Kino ausgelotet wurde. Mit der Darstellbarkeit von filmischer Zeit beschäftigt sich auch Ruedi Widmer. Er liest Andre Bazins Kritik an Le mystere Picasso von Henri-Georges Clouzot als Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Wirklichkeitsnähe des Films; im Mittelpunkt steht die Gegenüberstellung von einer realen mit einer abstrakten Zeit. In Harold Ramis' Film Groundhog Day bleibt der Protagonist in einer Zeitschlaufe gefangen. Er erlebt denselben Kalendertag in Varianten immer wieder von neuem. Brigitte Mayr geht dieser fiktionalen Außerkraftsetzung der intersubjektiven Zeit nach. Doch der Lauf der Zeit kann nicht nur zu einem individuellen, sondern auch zu einem kollektiven Problem werden – nach einem traumatischen Ereignis zum Beispiel. Die Verarbeitungs- und Verdrängungsproblematik, welche ein traumatisches Ereignis mit sich bringt, schlägt sich in der filmischen Stilistik nieder. Thomas Tode analysiert Level Five, den »letzten Film« von Chris Marker, in dem das Verdrängen von historischen und privaten Tragödien reflektiert wird und das Vergangene immer wieder im Gegenwärtigen aufscheint. Von einer Gegenwart, die zur Schuld geworden ist, spricht Vinzenz Hediger im Zusammenhang mit Oliver Stones JFK. Er zeigt, wie Stone durch eine »Montage des Traumas« die Ermordung Kennedys filmisch zu verarbeiten versucht. Roland Cosandey untersucht den ersten ethnologischen Film aus der Schweiz: Yopi. Chez les Indiens du Brésil des Basler Ethnologen Felix Speiser. Er läßt sich auf das Abenteuer ein, die Überlieferungsgeschichte und den Entstehungskontext zu rekonstruieren, und erlebt dabei so manche Überraschung. In der Nocturne diskutiert Christine Noll Brinckmann Pull my Daisy von Robert Frank und Alfred Leslie, wobei sie auch den kulturellen Kontext des Selbstverständnisses der Beat Generation beleuchtet. Francis Ford Coppolas Bram Stoker's Dracula wird von Caroline Arni als Romanverfilmung interpretiert, die auf eine symptomatische Art und Weise Sexualität und Aids thematisiert. Für das CH-Fenster hat sich Martin Walder mit Fredi M. Murer über die Entstehung von dessen neuem Film Vollmond unterhalten und das Gespräch in Form eines Lexikons festgehalten. Die Filmbriefe kommen dieses Jahr aus Hamilton und Kairo. Für die Redaktion Alexandra Schneider
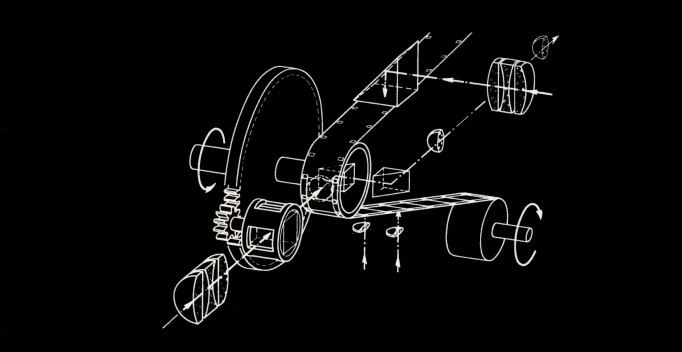
CINEMA #43
ZEIT
EDITORIAL
ESSAY
CH-FENSTER
FILMBRIEF
SELECTION CINEMA
MARKUS JURA SUISSE – DER VERLORENE SOHN/LE FILS PRODIGUE (EDGAR HAGEN)
LUX! VORSPIELE ZU EINER AUTOBIOGRAPHIE DES LICHTS (FRED VAN DER KOOIJ)
KADDISCH (BEATRICE MICHEL / HANS STÜRM, IN ZUSAMMENARBEIT MIT VILLI HERMANN)