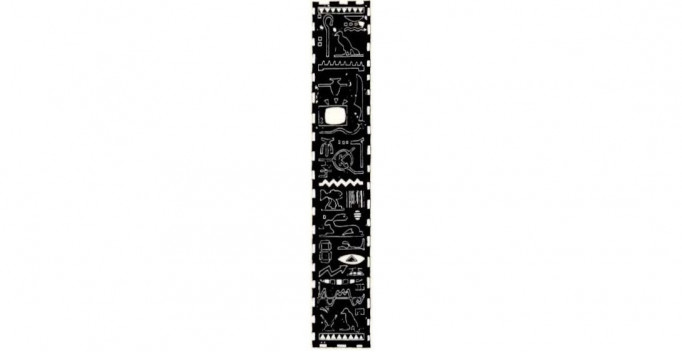Der Frage nach dem Radio im Fernsehzeitalter möchte ich zwei Ausrichtungen geben: Was bleibt dem auditiven gegenüber dem audiovisuellen Medium Spezifisches? Wie steht es seit dem Aufkommen des Fernsehens um den Hörfunk? Da diese Fragen - entsprechend den nationalen und kulturellen Besonderheiten - für jedes Land spezifisch ausfallen, beziehe ich mich auf Erfahrungen in der Bundesrepublik Deutschland.
„Radio“ bezeichnet zunächst einmal bestimmte Wellen, vermittels derer Hörfunk, Fernsehrundfunk, Radiotelegrafie und anderes übertragen werden. In der Umgangssprache allerdings ist Radio der Hörfunk. Dieser ist aufs Akustische beschränkt, wendet sich also an die Ohren eines Publikums. Der überkommenen Sprach-, Musik- und Klangkultur und der Hörkultur hat er eigene ästhetische Formen hinzugefügt. Radiosender sind Einrichtungen zur Herstellung und Ausstrahlung von Sendungen, beispielsweise die historischen Radio London, Radio Caroline, Radio Alice oder Radio Eriwan. Das Radioprogramm ist die Gesamtstruktur der Hörfunksendungen (wie Radionachrichten, Verkehrsfunk, Hitparade oder Direktübertragungen aus Parlament, Oper und Fußballstadion). Stellt man den Empfänger an, so kann man Radio hören. Doch muß der Radiohörer „in Laune sein. Der beste Empfang nützt mir nichts, wenn ich nicht auf Empfang bin“ (Raulff 1986, S. 11), er kann zur Qual werden, wenn der Nachbar sein Gerät auf volle Lautstärke gestellt hat. Der Apparat ist zwar längst selbstverständlicher Teil der technischen Kultur unseres Alltags geworden (Bausinger 1983), doch kommt ihm je nach Situation ein anderer Stellenwert zu: ob mit Hilfe von Detektor und Kopfhörern der Äther nach Sendezeichen abgesucht wird oder man über den Volksempfänger das Einheitsprogramm zur Kriegslage empfängt, ob versucht wird, heimlich einen illegalen Freiheitssender zu empfangen, oder ob man bequem neben der Stereotruhe (dem „Schneewittchensarg“) der späten 50er Jahre sitzt, abends im Bett liegt, unterwegs seinem Koffer-, Auto- oder Transistorradio lauscht, ob man öffentlicher Beschallung durch Gemeindelautsprecher ausgesetzt ist (wie in den zwanziger Jahren auf den Plätzen Moskaus und heute noch z. B. in manchen ländlichen Teilen Chinas) oder, anderes Extrem (fast ganz mit sich allein), seine Ohren direkt aus dem Miniempfänger in der Sonnenbrille füttert. Vom Walkman aber (dessen nomadenhafter Benutzer sich überall und jederzeit individuellen Hörgenuß verschaffen kann) unterscheidet sich das tragbare Radio durch die Gebundenheit an öffentliche Programme. Per drahtlosem Empfang ist der Radiohörer fortwährend vernetzt: „Ich schalte mich ein, aber die Sendung läuft schon, dann schalte ich mich wieder aus. [... ] Radio [... ] hat diesen Schalter, mit dem man einen Stoff zerschneidet, der uns ständig ungesehen umfließt.“ (Raulff 1986, S. 10)
Das Radio hält uns nicht bloß Tag für Tag, sondern von Minute zu Minute auf dem laufenden. Was immer sich ereignet, wir nehmen - sofern es für aktuell befunden wird - per Funk im Nu akustisch am Geschehen teil und bekommen es sogleich kommentiert (Staus auf der Stadtautobahn, Börsenkurse, Wasserstandsmeldungen, Protestveranstaltungen, Sportrekorde, „große“ Politik und „bedeutendes“ Kulturgeschehen). Sobald ich mich wie zufällig einschalte, skandieren Sendetermine meinen Tag: Radiowecker, Guten Morgen, Mittagsecho, Musik am Nachmittag, Politik am Abend, Mitternachtsspitzen, Bis vier dabei ... Schon in den historischen Anfängen (in den zwanziger Jahren) machte die unspektakuläre, aber äußerst wichtige „Zeitangabe“ den Hörfunk zum Inbegriff des gesellschaftlich verbindlichen Timings. Gewißheit, „in der Zeit zu sein“ verschafft er einem weiterhin durch Meldungen über das „Zeitgeschehen“, über „Zeitströmungen“ in Politik, Kultur und Sport etwa, bis hin zu Media Events, und natürlich durch zeitgemäße Musikarten und Sprechweisen. Nicht selten schlagen sich vom Rundfunk gesetzte Ereignisse und Stimmungen in der Erinnerung als zeittypisch oder lebensentscheidend nieder. So markiert die Hörfunkreportage vom Fußballweltmeisterschaftsspiel Deutschland-Ungarn 1954 in Faßbinders Die Ehe der Maria Braun eine historische Phase des nationalen Selbstverständnisses. Als tönendes Implantat im Interdependenzgeflecht (Elias 1980) des Gesellschaftskörpers bewirkt das Radio vielfältige Synchronisierungen. Da es mit größter Reichweite „Zeitgemäßes“ verkündet und konstituiert, wird es zu einem der Bindeglieder zwischen Makropraktiken und Mikropraktiken der Macht (angefangen bei der „Funkgymnastik“ [seit 1927] und damit zum Führungsmittel sowohl der Sende-Mächtigen als auch der Hörer-Subjekte, die sich per Funk der „Realität“ und mithin ihrer aktuellen Lebensführung versichern wollen (vgl. Foucault 1987). Fragen wie die in Christa Wolfs Roman (zur Tschernobyl-Katastrophe) Störfall, „ob ich übrigens auch an mir beobachte, daß irgend etwas in mir geil sei auf diese bösen Nachrichten jede Stunde? Eine finstere Schadenfreude, gegen uns selbst gerichtet?“ (Wolf 1987, S. 62), bringen „Mitschuld“ und „Mitverantwortung“ des Hörers ins Spiel.
Es zählen eben nicht allein seine Übermittlungsleistung, sondern auch seine gesellschaftlichen Vermittlungsfunktionen inhaltlicher (semantischer) und formaler (syntaktischer) Art. Schon vor jedem „Programm“ steckt im Sendenetz, mit dem ein „Rundruf“ getätigt werden kann, eine spezifische Wirkmacht. Das wird durch seine Rolle in verschiedenen Diktaturen belegt.
Was sein Apparat empfängt, worin sich der Hörer per Knopfdruck einschaltet und was sich in seinem Kopf vollendet, ist das Programm - das, was gesendet werden kann, darf und soll. Dabei müssen zwei Aspekte unterschieden werden, nämlich: das Programm, erstens, als Programmatik, die aus den Abhängigkeiten zwischen Rundfunk und staatlichen, wirtschaftlichen und anderen Instanzen und aus einer Funktionszuweisung des Hörfunks hervorgeht (programmpolitische Richtlinien etwa in Gestalt eines Programmauftrags; auch Pflichtenhefte u. a. Auflagen). Je mehr in den letzten Jahren, mit Blick auf Einschaltquoten und Werbe-Einnahmen, über „natürliche“ Aufgaben des Hörfunks spekuliert wurde, desto mehr hat sich der - vermeintlich interessenfreie - Begriff „Programmphilosophie“ verbreitet. Und das Programm, zweitens, als Programmgestaltung, also die Ästhetik einzelner Genres (Programmgattungen) und Sendungen, ihr innerer Aufbau und äußerer Ablauf.
Programme strukturieren einen Sender gleichsam vertikal und horizontal, nämlich einmal als Kanäle wie „Das Dritte Programm“ (mit einer spezifischen Abfolge von Plätzen, Blöcken und Terminen), und zum andern als redaktionelle Themen- und Kompetenzbereiche (Ressorts wie „Bildungs- und Familienprogramm“). Transmissionsagenten zwischen Programmatik und Programmgestaltung sind Intendanten, Programmdirektoren, Redakteure, Rundfunkräte und Kommissionen, bisweilen auch ein Sendekollektiv.
Das Publikum erkennt Sender und Programme am Namen und am akustischen Signet (z.B. einem Jingle). Serientitel, Personen, die schon „Programm“ sind, markante Stimmen, Begriffe und Schlagworte der Programmsprache sind für den Stammhörer wichtige Elemente der Vertrautheit und Identifikation mit dem Kanal. Sender werben für die eigenen Programme gelegentlich auch per Zeitung und Plakat, doch wird im Großteil der Tages- und Wochenpresse auf Hörfunksendungen (im Gegensatz zu denen des Fernsehens) nur mangelhaft oder gar nicht hingewiesen. Programmkritiken gibt es - gemessen an der Zahl der Sendungen - fast überhaupt keine. Dies belegt und festigt den Zufallsoder Gewohnheitscharakter des Radiohörens.
1952, als das Fernsehen, gelegentlich „Der Zauberspiegel“ genannt, nur ein etwa zweistündiges Abendprogramm ausstrahlte, sortierte die populäre Radiozeitschrift Hör tu! unter der Rubrik „Was möchten Sie hören!“ (1953 hieß sie dann „Die Speisekarte“) das Hörfunkangebot der Woche nach „Schöne Klänge“, „Sinfoniekonzert“, „Kammermusik“, „Zum Tanz“, „Bunte Sendung“, „Operette und Film“, „Oper und Ballett“, „Hörspiel“, „Welt und Wissen“, „Kunst und Literatur“, „Für die Familie“ und „Sport“ - dabei wurden auch mehr als 15 ausländische Mittelwellensender berücksichtigt.1 Die Kategorisierung (teilweise entsprach sie der Ressortaufteilung bei den Sendern) läßt erkennen, wie Radioprogramme kulturelle Etikettierungen (etwa „ernste Musik“ und „leichte“ oder „Unterhaltungsmusik“) übernommen, bekräftigt oder eingeführt haben. Noch heute bestehen einige Hörfunkprogramme aus denselben Elementen (Funkuniversität, Sendungen für ausländische Arbeiter und spezifische Jugendsendungen etwa sind noch hinzugekommen) - doch nicht mehr alles. Bei manchen Sendern wird man Oper, Stockhausen, Free Jazz und Frank Zappa genauso vergeblich suchen wie Hörspiele, Features oder Berichte. Allerdings ist (in der Bundesrepublik Deutschland) verfassungsrechtlich festgelegt, daß öffentlichrechtliche Rundfunksender (vor allem im Hinblick auf die Teil-Finanzierung aus den Rundfunkgebühren) eine sogenannte „Grundversorgung“ (mit Information, Bildung und Unterhaltung) gewährleisten müssen, während die privaten, meist nur über Werbung finanzierten Sender ihre Programme im wesentlichen völlig frei gestalten können.
Das Radio war schon in den zwanziger Jahren als Vorläufer des Bilderrundfunks gedacht. Viele Programmgattungen hat das Fernsehen (ab 1935) vom Radio geerbt und ins Audiovisuelle übersetzt: Nachrichtensendungen, Konzerte, Berichte, Features, Kinderprogramme, biographische Porträts, Soap Operas (in den Ländern, in denen es Radio Soap Operas gab), Talk-Shows. Langsam wurde der Radio- (aber auch der Kino-)Abend durch den Fernsehabend abgelöst. („Bloßes“ Radiohören als Haupttätigkeit wurde vielen zu dürftig.) Zur abendlichen Hauptfernsehzeit, das wissen die Radioanstalten, haben ihre Programme (noch) keine Chance; deshalb werden dann, für den harten Kern der Nicht-Fernseher, gerne Hörspiele und andere „anspruchsvolle“ Sendungen ausgestrahlt.
Rundfunk hebt sich von der Telefonkommunikation dadurch ab, daß von einem oder mehreren Sendern für eine Vielzahl von Hörern Programme hergestellt und ausgesendet werden. Er hat öffentlichen Charakter. Was aber „öffentlich“ zu sein habe, darüber gibt es die unterschiedlichsten Auffassungen. Reicht es, daß ein Sender sich an die Öffentlichkeit wendet? Soll er öffentlicher Aufsicht unterliegen (um etwa Unparteilichkeit zu sichern)? Oder sollen sogar die Produktionsmittel der Sender öffentlich zugänglich sein?2 In den siebziger Jahren wurde - in der Folge der gesellschaftlichen Bewegungen von 1968 und angesichts des anbrechenden Zeitalters des Kabel- und Satellitenfernsehens - die von Bertolt Brecht 1932 vorgetragene Forderung, den Rundfunk in einen emanzipatorischen Kommunikationsapparat umzuwandeln, von einigen Theoretikern und Praktikern (z. B. Enzensberger und auch von den eben entstandenen Videogruppen) auf die audiovisuellen elektronischen Medien übertragen.
Ist das Fernsehen also Fortsetzung des Hörfunks mit anderen - potenteren oder ärmeren - Mitteln? Fernsehen ist nicht nur Hörfunk mit Bildzugabe, und umgekehrt ergibt ein Fernsehprogramm ohne Bild, ergibt die bloße Tonspur noch keine Radiosendung. Beide haben ihre Spezifiken (dies kann der Vergleich einer Hörfunk- und einer Fernsehreportage von einem Fußballspiel verdeutlichen; vgl. Bausinger 1972, S. 80-82). Während Hörfunk allein mit den Rohstoffen Geräusch, Klang, Stimme, Musik, Wort arbeitet, verfügt das Fernsehen zusätzlich über einen elektronischen Bildschreiber; zwar richtet es sich auch ans Gehör - vorrangig aber beschäftigt es den Blick. Leider sind Fernsehsendungen oft bloße Text- und Musik-Bebilderungen oder, umgekehrt, verbale und musikalische Bildkommentare, Resultate also eher einer bequemen Aufteilung der Darstellungsleistung auf das Visuelle und das Auditive, denn volle Ausschöpfung der gesamten technischen und dramaturgischen Möglichkeiten, die das Medium eröffnet. Darauf zielen Arnheims und Adornos Kritiken am Bebilderungszwang und Godards Äußerung über einen „visuellen Analphabetismus“. Das Fernsehprogramm erreicht also kaum die hörfunkspezifische Sprachkultur noch deren Sprechkultur (Sprechdramaturgie, Rhetorik, Tonfall, Dynamik und Tempo der Stimmführung, Dialekt). Die Schlampigkeit vieler Synchronisierungen fremdsprachiger Filme und Fernsehspiele belegt dies. Auch bleibt die Klangkultur (Geräusche, Stimmen, Musik) eines Großteils der Fernsehprogramme bloß naturalistisch. Daß man dem audiovisuellen Medium nicht ganz zu trauen scheint, zeigt sich daran, daß die deutschen (zumindest die öffentlich-rechtlichen) Fernsehanstalten viele Sendungen (Spielfilme usw.) regelmäßig einleitend durch einen Sprecher erläutern lassen. Schon vor der Geburt des Radios findet eine Verschiebung von der oralen zur visuellen Kultur statt. Exemplarische Ursache und Symptom ist die Beschleunigung des Lebens in den industrialisierten Großstädten.
Idealtypisch (und sehr vereinfachend) kann man sagen: der visuelle ist ein digitaler, der akustische hingegen ein analoger (kontinuierlicher) Informationsprozeß. Vieles von dem, was in akustischer Form dem Gehör bloß nach und nach zugeht, kann in Bildform das Auge auf einen Blick erfassen. Das heißt auch: Hören fordert und kostet Zeit. Nicht berührt Fernsehen mehr, vielmehr berührt es anders als der Hörfunk. Der Blick des Schauspielers in die Kamera kann uns vor dem Bildschirm nicht treffen, wohl aber seine Stimme, denn sie hat (wie auch der Instrumentalklang) im Gegensatz zum visuellen Abbild Körper.
Die Tatsache jedoch, daß heute, wo nahezu jeder Haushalt zumindest über ein Fernsehgerät verfügt, immer noch Radios gekauft werden, bezeugt, daß nicht aufs Radio verzichtet wird, daß also das jüngere Medium nicht einfach das ältere ersetzt oder ablöst, und daß die audiovisuelle Kultur gegenüber der auditiven nicht einfach eine „Verbesserung“ oder „Bereicherung“ darstellt.
„Anthropologisch ist das Hören der Raum- und Zeitsinn: Vom Gehör ausgehend, bildet er sich über die Wahrnehmung von Entfernungsstufen und regelmäßigen Rhythmen akustischer Erregung. Wie für das Säugetier das Territorium durch Gerüche und Geräusche markiert ist, so eignet sich auch der Mensch, was man oft nicht bedenkt, den Raum teilweise akustisch an. Der heimische Raum, der des Hauses, der Wohnung ist ein Raum vertrauter, wiedererkannter Geräusche, die im Zusammenspiel eine Art Sinfonie des Daheim bilden: differenziertes Türenschlagen, Stimmen, Küchen- und Leitungsgeräusche, Echos von draußen“ (Barthes/Havas 1977, S. 982-983). Andererseits bereiten Stille und Schweigen ihm aber den Eindruck des Verlassenseins oder unheimlicher Leere, bewirken bisweilen panische Reaktionen.
Doch abgesehen davon, daß die Entzifferung der Schattierungen eines Bildes meist eines zweiten Blickes bedarf, gibt es verschiedene Arten des Hörens. Neben dem Indizien-Hören, das Gelegenheit zur Entspannung signalisiert oder bei bestimmten Geräuschen Unruhe oder Alarm auslöst und einen aus dem Schlummer hochschrecken läßt, gibt es auch ein lesendes Hören, das Zeichen und Codes entziffert, und ein Hören, das „in einem innersubjektiven Raum stattfindet, wo,ich höre’ auch heißt,höre mich““ (Barthes/Havas 1977, S. 982) und das sich der unbewußten Signifikanz zuwendet.
Je nach Hörart (und je nach Sendung) kann das Radio deshalb als soziale Alarm- und Beruhigungsinstanz fungieren, kann verführen und für Interpretation sorgen, kann Konzentration (Hinhören!) fordern und zerstreuen. Sein Klangraum ist allgegenwärtiger, einen umkleidender Symbolraum. Ein Schutzmantel, was immer einem auch zustoßen mag: Ratschläge schon am frühen Morgen, Vorwarnungen oder, wenn etwas passiert ist, tröstende Worte des Moderators und Wunschmusik.
Seit einigen Jahren aber wird zum erstenmal eine Hörart (oder ein Hörmodell) - das Nebenbeihören - zum Parameter der Strukturierung und Produktion von Programmen. Man produziert vorrangig fürs Hinhören mit halbem Ohr, das es mit dem Wiedererkennen des eigenen Reviers bewenden läßt.
Das seit etwa einem Jahrzehnt wieder gestiegene Interesse für den Hörfunk ist freilich keine bloße Rückwendung zu früheren Radiozeiten. Nicht nur die Haltung zum auditiven Massenmedium (die Hörart) hat sich gewandelt, sondern auch dieses selbst. Wie färbte die Existenz des TV, wie die Ästhetik des TV auf das Radio und auf das Radiohören ab? Es ist natürlich mitzubedenken, daß die Funktionen des Radios und des Fernsehens beide durch das gesellschaftliche Interdependenzgeflecht geprägt sind, daß also das Fernsehen nicht die Bedingung des heutigen Hörfunks darstellt.
Bis gegen Mitte der siebziger Jahre sind innerhalb der einzelnen Rundfunkanstalten verschiedene Genres und Programmtypen relativ gleich verteilt (wobei jede Anstalt durch regionale und personale Besonderheiten geprägt ist). Dann tritt eine Differenzierung ein: Zunächst bilden sich im Kampf gegen den (teilweise durchs Fernsehen bedingten) Publikumsschwund die sogenannten Schnellen Wellen oder Servicewellen heraus (z. B. SWF 3; vgl. Haedecke 1985) mit Popmusik, Verkehrsmeldungen usw. und größtem Attraktionswert für die werbungtreibende Wirtschaft. Nach und nach werden die einzelnen Programmschienen der Anstalten gegeneinander abgegrenzt - etwa nach dem Muster: Programmschema A für den etwas älteren Durchschnittshörer (mit Schlager, „volkstümlicher Musik“, „populärer Klassik“ und Operette), Programmschiene B als schnelle Servicewelle („Rock, Pop und Infos rund um die Uhr, Nachrichten zur vollen Stunde“ - so die Werbung für SFB 2, in: TIP 16 [Berlin 1987], S. 47), C als Kulturkanal (mit Features, klassischer Musik und Hörspiel), D für längere Live-Übertragungen. Dies geschieht vor allem angesichts der Konkurrenz der Privatradios, die, nach einer wenig erfolgreichen Anfangszeit im Kabelnetz seit Anfang 1987, über einige Ätherfrequenzen verfügen und deren Programme sich grob in zwei Typen aufteilen lassen: Die Mehrzahl liefert Soundtrack und Phone-In-Sendungen, einige wenige verstehen sich als Lokal-, Milieu- oder Gruppenradio.
Unterschiedliche Arten des Programmablaufs koexistieren jetzt. Minutiös ausgefeilte Programmstrukturen und Programme, die nur noch Sound- und Wortbehälter (für 60 oder 120 Minuten) sind, aber auch eine tendentielle Auflösung der Struktur (wobei der Sendeablauf von Spontaneität und „Wichtigkeit“ eines Ereignisses oder Anliegens bestimmt wird).
Interessant, wie sich in dieser Situation die Diskurse übers Radioprogramm verändern. Hieß es 1980 noch in einem Intendantenbericht (des SFB): „Es wäre [...] falsch, den Hörfunk ausschließlich als ein,Nebenbei-Medium’, als bloße Geräuschkulisse’, zu charakterisieren. Der aufmerksame Hörer ist [...] durchaus nicht in der Minderheit“, so verschiebt sich bis Mitte der achtziger Jahre die Gewichtung: „Radio begleitet durch den Tag. Der Hörfunk soll aktuell und schnell informieren, er soll unterhalten.“ (aus einem Text des Intendanten des RIAS, Berlin 1986, S. 23)
Ideal gegenwärtiger Programmatiken ist die „Durchhör-Welle“, ein Programm also, das man den ganzen Tag durch hört. „Jedes Programm wird geprägt durch seine Musikfarbe und eine spezielle, von den anderen Programmen unterschiedliche Art und Weise der Information, Bildung und Unterhaltung“ (SFB-Pressestelle, „Neue Hörfunkprogramme für den SFB“, Berlin 1986, S. 1). Derartige Programme müssen sich einerseits zum Nebenbeihören eignen, gewissermaßen als konstanter Klangraum, andererseits sich durch eine bestimmte eigene „Färbung“ gegen andere Sender abheben. Das „format radio“-Programm ist ein akustischer Designartikel.
Mit Musikfarbe sind nicht etwa der Klang einer Komposition oder bestimmter Instrumente, sondern - ungenau - Stimmungswerte wie „insgesamt eher rhythmisch“ oder „insgesamt eher melodiös betont“ (vgl. SFB-Papier, S. 25-26) gemeint. Ein Musikredakteur kommentierte: „Gibt es überhaupt Musik ohne Rhythmus? [...] Melodie hat der größere Teil der Musik, ob Schlager, ob Mozart.“ Es geht also um den affektiven Effekt bestimmter Musiken, um Programmimage. Eine so verstandene Musikfarbe hat, so glaubt man, Ordnungsfunktion als „Reviermarkierung“ einer bestimmten Hörergemeinde. Entspräche das Radiohören dem Gang durch eine Stadt, dann hieße das: anstelle des früheren Hin- und Herwechselns von einer Straßenseite zur anderen, mit gelegentlichem Innehalten und Abstechern in die Nebenstraßen, soll der Hörer heute sich an einen farblich markierten Pfad gebunden fühlen, dem er unbeirrt und ohne Anstrengung folgt, den er entlangeilt, wie weiland die „Europe in three days“-Touristen. Er bleibt stets auf dem laufenden, mit einem Ohr am Puls der Zeit - mit dem anderen am Walkie-Talkie. Als „hörenswert“ gilt, was „Neuigkeitswert“, „Gesprächswert“ („im Kollegenkreis mitreden“) und „Anwendungswert“ („Tips und Hinweise“) hat (Haedecke 1985, S. 18). Das neue Radioprogramm zielt auf Aktion und Emotion. Es antwortet der Evidenz, dem Augenschein, der Audiovision und der Ballung der Sinneseindrücke in der Fernsehästhetik mit Betriebsamkeit und Operativität.
Betrachten wir nun drei Felder der Programmdiskussion: die Musik, das Verhältnis Wort-Musik und das Wort. Hörergruppen werden nun nicht mehr - soziologisch — im Hinblick auf ihren Ort im gesellschaftlichen Gefüge (Macht, Produktions- und Reproduktionsprozeß, soziale Gruppen, Lebensformen u. a.) identifiziert und angesprochen, sondern gewissermaßen „musikologisch“.
Musik ist dabei allerdings nur noch eine Frage der Geschmacks- und Altersgruppe und der Hörsituation, ist nur noch farbiger Fetisch, Glücksbringer der Kasse des Senders und dem Gemüt des Halbhörers gleichermaßen - Musik, „die sich selbst an nichts mißt als an ihrem sozialpsychologischen Effekt“, so Adorno über leichte Musik (Adorno 1975, S. 46). Musikstücke werden folglich nicht auf ihren Gehalt und ihre Wahrheit befragt, sondern auf „Wirkungsfunktionen“ wie etwa: „Parasozialer Kontakt“ („ohne Musik käme ich mir oft einsam und verlassen vor“), „dezente Hintergrundmusik“ („sonst stört sie mich“), „Kontakt-Förderung“ („bei Musik kommt man sich näher“), „Stimmungskontrolle“ („belebt, befreit, schafft Ausgeglichenheit“) und „Funktionalität“ („mit Musik geht die Arbeit leichter von der Hand“). (Vgl. Eckhardt 1987, S.410)
Music-Playlists legen bestimmte Schwerpunkttitel fest, die sich meist an Erfolgsnummern verschiedener Charts orientieren. Durch solche Musikauswahl nach Maßgabe einer unterstellten Akzeptanz beim Publikum wird implizit und explizit Musikpolitik betrieben. Trotz steigender Senderzahl und steigenden Musikanteils an den Gesamtprogrammen droht deshalb die weitere Einengung des medial verbreiteten Spektrums des Musikschaffens. Musik zur Untermalung, Sound im Hintergrund, der man kein Ohr zu schenken braucht, bloß atmosphärische Tönung nach dem Motto „Mit Musik geht alles besser“ ist nicht etwa ein Zeichen einer allmächtigen, sondern der „vertriebenen“ Musik (Adorno).
Der Favorisierung derart verstandener Musik entspricht das quantifizierende Verständnis des Wortes (neben der Sorge um Ausgewogenheit der Wortbeiträge bei den öffentlich-rechtlichen Sendern). Was welche Musik sei und was welches Wort, wird nicht überlegt. Normal sind vielmehr Äußerungen wie: „Auch das C-Programm scheint uns zu worthaltig zu sein. Das wird nach unserer Auffassung die Hörer noch weiter weg vom SFB treiben.“ (Stellungnahme der Geschäftsleitung des Senders Freies Berlin vom 30. 6. 1986, S. 35) Haedecke gibt 1985 als Richtwert für SWF 3 „zwanzig Minuten Wort pro Stunde, mit Nachrichten, mit Werbung“ an. „Und kein einzelnes Wortelement länger als fünf Minuten. Zwanzig Minuten Wort und vierzig Minuten Musik.“ (Haedecke 1985, S. 17)
Desgleichen wird mit Blick auf eine angebliche Drei- oder Fünf-Minuten-Aufmerksamkeitsschwelle (konzentriertes Zuhören) von Wortbeiträgen Kürze gefordert: „Wie lange kann ein Mensch zuhören, wenn er nicht in der Lage ist, sich zu konzentrieren?“ (Haedecke 1985, S. 17)
Aber entsprechen 20 Minuten Telefoninterview 20 Minuten Hörspiel und 20 Minuten Landfunk? Und entsprechen diese 20 Minuten Beethoven-Sonaten, 20 Minuten Cage und 20 Minuten Prince? Und das Moderatorengequatsche? Und das gesungene Wort? Aus der Annahme des Nebenbeihörens, scheint es, werden verkehrte Folgerungen für die Qualität des Sendematerials oder der Präsentation gezogen, als müsse Radio zum Weghören animieren. Auf diese Weise werden von vorneherein Spontaneität und Konzentration des Hörens ausgeschlossen.
Die stetigen Versuche einer Rückversicherung beim Publikum: „Gefällt Ihnen unser Programm?“,Wollen Sie noch mehr davon hören?“ usw., legen den Verdacht nahe, daß niemand mehr weiß, was zu sagen ist. Dies macht einen krassen Unterschied gegenüber der alten Institution Rundfunk (gleich ob staatlich oder öffentlich-rechtlich). Es wird hier das Aufkommen von Widerstand nicht mehr riskiert, auf den man stößt, wenn man den Hörern etwas zu sagen hat. Vermieden wird, was das Fließprogramm für einen Moment zum Stocken bringen könnte.
Eine andere Antwort auf die Charakteristiken des Fernsehens scheint mir in der Tendenz zum Aktionsradio zu bestehen. Mehr und mehr sind Hörfunkprogramme in jüngster Zeit auf anstehendes Handeln ausgerichtet (schneller Telefonanruf bei Quiz-, Preisrätsel- oder Musikwunschsendungen). Alles muß schnell gehen, kurzfristig abgeschlossen sein und zugleich zum nächsten Musiktitel oder zur nächsten Kurzmeldung übergeleitet werden. Mit der Aussicht auf besondere Handlungsangebote im Laufe der nächsten Stunde(n) erhofft man sich treue Hörer zu schaffen. Eine allgemeine Tendenz zum Fließprogramm eliminiert die (Sende- oder Umschalt-)Pausen und drängt auf Verschleifung der Sendungen miteinander. Das Radio soll schnell und effektiv sein, soll „Servicewert“ haben. Im Pop-Shop, Radio Kiosk, Radioboutique wird soeben eingetroffene Nachrichtenware (Aktualitäten) in Musikkonfektion feilgeboten. Der Hörer ist damit für alle Eventualitäten abgesichert.
Die Sendungen werden spezifischer an bestimmten Publika ausgerichtet, die aber anders bestimmt werden als bisher, nämlich situativ und stimmungsorientiert: Schüler nach Schulschluß, ältere Jugendliche am frühen Abend usw. Es bilden sich spezifische Hörergemeinden, innerhalb derer Grüße ausgerichtet werden. Arbeits- und Bürogemeinschaften dürfen sich Wünsche auf „Internationale Hits und Oldies“ erfüllen lassen (vgl. Teichert 1987, S. 280). Dank Radio der richtigen „Musikfarbe“ wird das Büro zum Zuhause; mit Blumen, Kaffeetassen und Musikmoderation wird es endlich persönlich eingerichtet.
Die Moderatoren geben sich „launig“, spielen den Disc-Jockey und Plauderer, verlesen „interessante“ Agenturmeldungen, Kuriosa und humorige Kalendersprüche. Auffallend ist die Entprofessionalisierung in der Sprach- und Sprechkultur. Wesentlich für die Schaffung einer persönlichen Bindung sind der gezielte Einsatz der erotischen Ausstrahlung der Stimme, vorgebliches Verständnis und Komplizenschaft mit dem Publikum in dessen konkreter Hörsituation: „Vielleicht sind Sie heute auch so müde, so erkältet, so verkatert ... wie ich“, „Wenn Sie jetzt mit Ihrem Auto im Stau stehen ...“, „Bei diesem Regenwetter ...“, „Vor dem Studiofenster geht gerade die süße Gabi vorbei - und was sie wieder anhat, na na ..., wenn Sie das sehen könnten ... “, „Tschüs, mir reicht’s für heute, ich geh jetzt nach Hause; Thomas macht jetzt mit Ihnen weiter - auch wenn wir alle wissen, daß ich Ihnen sympathischer bin ..." In Phone-in-Sendungen mancher Sender werden Anrufer prinzipiell geduzt. Das Radio gibt sich nicht mehr als Führer durch den Tag, sondern als Begleiter, bisweilen Kumpel im Alltag.
In der Praxis vieler, auch öffentlich-rechtlicher Sender zeigt sich eine (unausgesprochene) Reaktion gegen die Sprachregelungen des offiziellen Redens, etwa in den Nachrichten (Verlautbarungsjournalismus), und gegen die ängstliche Abschottung gegenüber allen Arten aktiver Beteiligung von Hörern. Gegen die (unausgesprochene) Herrschaftshaltung des Radios machen nun „unsere“ Sender, die bringen, was „uns“ gefällt, deren Moderatoren „uns mögen“ und „uns verstehen“, denen es „ebenso geht wie uns“, Front.
Mit dem scheinbar assoziativen Sprechen vieler Moderatoren und Präsentatoren (das in Wahrheit sich meist an Style-Books und an Angst vor dem Zuschauerschwund und Jobverlust orientiert) mitsamt all ihren scheinbaren persönlichen Offenbarungen tritt aber auch eine Art zu hören und eine Lust zu hören in den Vordergrund, die der Rundfunk bislang kaum gefordert hat: die der Erotik der Stimme und des Begehrens im Text des unsichtbaren Gegenüber.
Neben der Tendenz zu internationaler Standardisierung der Machart - die natürlich auch kulturelle Einebnung und Hegemonie einiger weniger Modelle bedeutet — zeigt sich im internationalen Maßstab auch eine Tendenz zur regionalen und lokalen Besonderheit. Erstere herrscht im Musik-, letztere hingegen im Wortbereich vor (schon allein aus Gründen der Sprachgrenzen).
Gegenüber den 50er und 60er Jahren zeigt sich der Hörfunk seit den späten 70er Jahren deutlich als operatives Medium. Die (von Brecht und anderen in der Frühzeit des Hörfunks vorgebrachte) Forderung, das Radio zum Kommunikationsapparat zu machen, bei dem Empfänger zugleich auch Sender sind, schien sich am Modell einer gesamtgesellschaftlichen Telephonie zu orientieren. Der Zuhörer, der heute in eine Radiosendung telefoniert, verfügt über ein gesellschaftliches Sprachrohr (zwischen monologisierender Ansprache ans Publikum, Übermittlung von Grüßen an andere Hörer bis zu Telefondisputen per Radio; er kann sich über seinen Radiolautsprecher als öffentlichen Redner hören). Telefonsendungen können für die Teilnehmer zum Ort des Bekenntnisses oder Geständnisses werden, zum Marktplatz des Geschlechts (mit Adresse und Telefonnummer) usw. (Dies schließt an eine Entwicklung an, die sich schon seit einigen Jahren im Bereich der Kleinanzeigen, Anzeigenblätter und, beispielsweise in Frankreichs,Minitel’, des Bildschirmtextes, abzeichnet.)
Es tritt die operative Seite des Funks auch dort hervor, wo er — vor allem im regionalen und subregionalen Bereich - sich auf laufendes Geschehen bezieht, an dem Hörer persönlich teilnehmen oder teilnehmen könnten. Stadtradios, Bürgerradios und Offener Kanal weisen auf Musikveranstaltungen, Stadtteilfeste, Treffen von Bürgerinitiativen (Politik ist dabei nicht auf Parteiaktionen beschränkt), allgemein: auf Handlungschancen und -notwendigkeiten hin, betreiben „anwaltlichen“ Journalismus, bieten sich als Diskussionsforen an und locken teilweise (Stichwort: „Hörer machen Programm“) das Publikum ins Funkhaus. Gelegentlich wird per Ü-Wagen über mehrere Stunden hinweg immer wieder von Brennpunkten des städtischen Geschehens berichtet. Partikularität der Themen, Dialekt, Akzent, Jargon, Slang, Gruppensprachen, auch regionale und lokale Musik unterscheiden sie gegenüber den Programmen größerer Reichweite.
Dies bedeutet durchaus eine thematische Bereicherung, wurden doch bislang Sexualität und Produktionssphäre aus dem öffentlichen Sprechen des Bürgertums ausgespart oder ausgesperrt (vgl. die Thesen von Negt und Kluge 1972). Die Einbeziehung der Telefonate bedeutet zugleich aber auch eine Fixierung auf einige wenige Themen. Es muß hier unterstrichen werden, daß die Kommentare des Moderators den jeweiligen Diskurs auch lenken: schnelles Schließen, Witz, lächerlich machen, Abtun, Aufreizen, Verallgemeinern, Abwiegeln, Nachhaken, Beipflichten, kumpelhafte Zustimmung usw. Wie geht er mit seiner Verantwortung um?
Im Zeitalter allgemeiner „Informalisierung“ (Elias) scheint zwar auch das Radioprogramm kaum noch strukturiert, doch kommt ihm gerade in seiner Allgegenwart im Hintergrund (bei aller scheinbaren Unverbindlichkeit) eine Ordnungsfunktion zu. Freilich tönt hier keine autoritäre Stimme des Herrn mehr, gleichwohl aber vernimmt man etwas Eindringliches, das vielleicht den Programmgestaltern meist gar nicht bewußt ist. Mag auch die relative Auflösung der Raster, Rubriken und Sendeformen zur Annahme verleiten, alles sei nun völlig beliebig, verkörpert (eine Analyse von Moderatorensprüchen und Hörertelefonaten kann das erweisen) Rundfunk auch dort, wo er scheinbar am entferntesten von jedweder Institution ist, kulturelles Gesetz; und sei es in Form des „gesunden Menschenverstands“ und des „Volksempfindens“ (also unterhalb oder diesseits des Bereichs staatlicher Gesetzgebung).
Der Einzug von Alltagssprache und Telefoninterventionen der Hörer entkräftet nicht schon den Pauschalvorwurf von Günter Anders (1956 in seinen „Philosophischen Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen“), dem Radiohörer sei „das Sprechen nun verbürgt“, es werde ihm „durch die Kulturwasserhähne der Radios“ in jeder Wohnung „fertig geliefert ins Ohr geträufelt“ (Anders 1980, S. 109). „Da uns die Geräte das Sprechen abnehmen, nehmen sie uns auch die Sprache fort; berauben sie uns unserer Ausdrucksfähigkeit, unserer Sprachgelegenheit, ja unserer Sprachlust — genauso wie uns Grammophon- und Radiomusik unserer Hausmusik beraubt“ (Anders 1980, S. 107). Die entscheidenden Fragen lauten vielmehr: Was kommt zur Sprache? Welche Musik kommt zu Ohren? Wie werden die Sendungen präsentiert? - und wie wird gehört?
„Aktive Erfahrung der Musik besteht nicht im Klimpern oder Fiedeln, sondern in sachgerechter Imagination, einem Hören, das die Werke, denen es passiv sich hingibt, durch solche Hingabe wiederum erst entstehen läßt. [...] Radiomusik [...] hätte“, so fordert Adorno, „... planvoll zu aktiver Imagination zu erziehen und das Ihre dazu beizutragen, die Hörermassen adäquat, nämlich strukturell hören zu lehren, etwa so, wie es dem Typus des,guten Zuhörens1 entspricht [...] nämlich dazu (zu) befähigen, musikalische Texte stumm, in bloßer Imagination sich anzueignen...“ (Adorno 1975, S. 161). Dasselbe gilt für das Hören von Wort und Geräusch. Solch geschultes Zuhören ist allerdings nicht mit krampfhaftem Aufhorchen (Ohrenspitzen) zu verwechseln: geschultes Hören kann auch Nebenbeihören sein.
Auf seiten der Programmgestaltung hieße dies - mit einer Bemerkung von Glenn Gould: „Technologie [...] ist nicht primär ein Förderband für die Verbreitung von Information; sie ist nicht primär ein unverzüglich funktionierendes Relaissystem; sie ist nicht primär eine Datenbank, in deren Gewölben die Leistungen und Unzulänglichkeiten, die kreativen Kreditposten und die dokumentierten Defizite des Menschen deponiert sind.“ Vielmehr muß „ihre Fähigkeit zur Zerlegung, zur Analyse - vor allem vielleicht zur Idealisierung eines Eindrucks - [...] ausgenutzt werden“ (Gould 1974, S. 184-185).
Zwar hat die (zumindest in der Bundesrepublik) aufs Nebenbeihören und auf das Radio als Begleitmedium zugespitzte Debatte der letzten Jahre weder die wesentlichen Eigenschaften des Hörfunks berührt noch etwas darüber ausgesagt, wie ein Hörer was hört. Da sie aber zu einer programmatischen Weichenstellung führte, herrscht nun auf bestimmten Programmbahnen Dauerbetrieb, während andere nahezu stillgelegt sind.
Manche Programmgattungen wuchsen über das Radio hinaus oder wurden hinausgedrängt: so wurde die Produktion von Hörkunst im Zeitalter beweglicher Tonaufzeichnungs- und Bearbeitungsgeräte zwar immer leichter, ihre Existenz im Radioprogramm aber zugleich schwerer. Andererseits ist mit dem begonnenen Vertrieb in Kassettenform manches solcher „Literatur fürs Ohr“, einer der spezifischsten Errungenschaften des Hörfunks, wo immer und sooft man will, unabhängig von Sendeterminen verfügbar geworden.3 Und längst verbinden sich jenseits des Radioprogramms Lautsprecherkünste wie Hörspiel, elektronische Musik, Audio Art in Live-Performances des Experimental-Rock (z. B. Laurie Anderson), der sogenannten Neuen Klassik und des Theaters.
Es wird sich relativ bald erweisen, in welche Richtung und in welchem Ausmaß sich unsere Tonkultur und unsere Hörkultur entwickeln werden, ob die Programme, die man zu hören bekommt, eher Ohrentropfen und Ohrenstopfen gleichkommen, ob sie bloß zum Weghören geeignet sind, oder ob mit dem Radio weiterhin - wie in seinen Anfangsjahren - neue Formen der Hörproduktion und des Hörens gewagt werden.
Es läßt sich im Moment nicht Vorhersagen, ob sich nicht in einer zweiten Phase der Konkurrenz der (öffentlich-rechtlichen und privaten) Hörfunksysteme neue Differenzierungen und neue kulturelle Marktsegmente ergeben werden. So kann etwa „das Überangebot des gleichen im Musikspektrum [...] - angesichts der sich verschärfenden Konkurrenzsituation durch überlappende Sendegebiete - den Informationssendungen eine zunehmend wichtigere Rolle Zuspielen“, überlegt Will Teichert (Teichert 1987, S. 291). Es könnte selbst zu einer Umstrukturierung institutioneller Programmeinteilungen wie „Information“, „Unterhaltung“, „Bildung“, „Ernste Musik“ usw. kommen (vgl. Eckhardt 1987).4
Auch die Ermittlung von Einschaltquoten, Hörerpräferenzen und sogenannter Hörgewohnheiten ändert nichts daran, daß der Hörerwunsch immer eine Unterstellung bleibt. Entscheidend ist, ob man im Hörfunk etwas zu sagen hat, per Sprache, Geräusch und Musik - daß es also, mit einem Wort Rudolf Arnheims - „nicht auf die Alternative,Pathos oder Konversation‘ ankommt, sondern allein darauf, ob es gelingt, die Form mit Leben zu füllen“ (1929 in der Weltbühne; Arnheim 1985, S. 104).