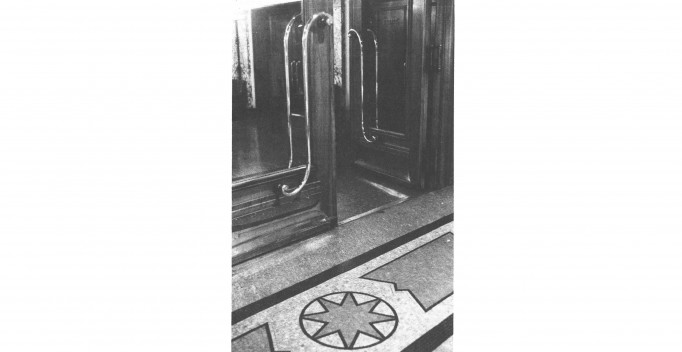Wenn unter Filmschaffenden vom «Buch» die Rede ist, ist das Drehbuch gemeint. Spricht einer von einem Buch aus der Buchhandlung, ist es ein «Buch-Buch». Ein Stück zu verfilmende Literatur heisst «Vorlage».
1971/72 hatte ich einen Job beim «Filmverlag der Autoren» in München. Damals produzierte die Firma noch Filme, der Verleih war erst im Aufbau. Ich bewohnte ein Zimmer, das dem Büro hauptsächlich als Ablage für die Buchhaltung diente. Meine Nächte verbrachte ich also auch im Filmverlag. Ich las alle Drehbücher, die hemmlagen, sogar jene, die man längst in einem Schrank abgelegt und völlig vergessen hatte. Ich las Bücher von Uwe Brandner, Volker Vogeler, Thomas Schamoni, Peter Lilienthal, Rüdiger Nüchtern, Wim Wenders, Hark Böhm und anderen mehr.
Ich bekam einiges von der Hysterie mit, die sich ausbreitete, wenn der Ablieferungstermin für irgendeine staatliche Filmförderung bevorstand. Das lief meistens in nächtlichen Fotokopierorgien ab, denn um elf musste das Paket am Dringlichkeitsschalter noch den Stempel des Tages kriegen. Immer auf den letzten Drücker. In den letzten Stunden wurde noch an Posten in der Kalkulation hemmgebastelt, die den Drehbüchern beizuliegen hatte. Waren die Bücher erst mal auf der Post, brachen Erleichterung und Euphorie aus, als habe man den Film bereits erfolgreich abgedreht.
Tage später dann die Ernüchterung. Was wird aus dem Stoff? Wochen des Wartens, Selbstzweifel der Macher, aber auch kühne Entwürfe zu drehender Szenen. Provisorische Motivsuche (in der Schweiz auch Reko genannt), erste Besetzungsgespräche. Verschwörerisch geprägte Kontaktaufnahme mit Mitgliedern der Förderkommissionen. Nicht gerade Bestechungen, aber doch Einladungen zu opulenten Mittagessen. Um den Film, dieses Phantom, drehte sich alles. Kollegen wagten untereinander Prognosen, wünschten sich das Beste, wünschten, dass jeder seinen Film machen durfte: «Eine schöne Geschichte». «Ein wichtiger Stoff». «Also wenn Du das so hinkriegst, wie es im Buch steht, wird es wunderbar). So führten sie Reden. Dachten aber insgeheim: «Wenn der mit seiner sentimentalen, verschmockten Scheisse Förderung kriegt, weiss ich auch nicht. Dagegen mein Projekt. Dreimal hab ich's umgeschrieben. Die letzten zwei Jahre nix gekriegt. Diesmal klappt es bestimmt».
Als Nicht-Konkurrent, als nur mittelbar beteiligter Helfershelfer bekam ich sowohl die schönen kollegialen Reden als auch die bösen neidvollen Gedanken zu hören. Den Gipfelpunkt an Hohn und Verachtung drückte einmal ein Filmemacher über seinen heute weltberühmten Kollegen so aus: «Wenn der sein nächstes Ding wieder in den Sand setzt, kann er anfangen Essays für die ‹Zeit› zu schreiben.» Das klang so, als hätte er gesagt: «... dann kann er sich bei der Fürsorge melden». Ich war damals gerade zwanzig und die Wochenzeitung «Die Zeit» bedeutete mir zwar nicht das Mass aller Dinge, aber ich las sie doch mit Respekt.
Ein schönes Buch. Damit stand und fiel alles.
Heimlich fing ich an, auch Drehbücher und Exposés und Treatments zu schreiben. Ich schickte sie an Fernsehspielredaktionen, auch an Filmförderinstanzen. Das Fieber hatte mich angesteckt. Aber ganz tief innen hatte ich eine ungeheure Angst, eines meiner kleinen Projekte könnte zustande kommen und ich müsste es realisieren. Die Angst vor der eigenen Courage. Doch da bestand vorläufig keine Gefahr.
Ich kam gar nicht auf die Idee, dass man ein Drehbuch für einen anderen Regisseur schreiben konnte. Das ergab sich selten unter den Leuten vom Filmverlag. Sie verstanden sich als Autorenfilmer. Man schrieb seine eigenen Stoffe, oder fand sie in der Literatur und reichte sie dann ein. Beim Fernsehen oder bei Fördergremien. Oder bei beiden. Und wartete ab. Ich war völlig baff, als ein paar Jahre später ein Fernsehredakteur mir einen Roman schickte mit der Frage, ob ich daraus ein Drehbuch machen wolle und könne. Die Regie könne er mir leider nicht anbieten, die sei schon vergeben. Regie anbieten. Den Ausdruck hörte ich zum ersten Mal. Ich machte ein Drehbuch aus dem Buch-Buch. Über den fertigen Film war ich entsetzt. Also hatte es doch seinen Grund, Drehbücher nur für sich selbst zu schreiben. Was ich dann auch tat. Ich war überzeugt, dass es das Beste ist, alles allein zu machen. Natürlich nicht alles. Aber: Buch und Regie.
Bei meinem ersten Film1 (Ich hab Stücker drei gemacht. Und erst noch bloss fürs böse Fernsehen. Dies sei hier nur vermerkt, damit kein CINEMA-Leser auf die Idee kommt, er müsse meinen Namen kennen) hätte ich, rückblickend, ganz gut einen Co-Autor brauchen können. Es gibt für mich Argumente dafür, ein Gedicht allein zu schreiben. Oder auch einen Roman. (Mit Theater hab ich nichts zu tun.) Aber ein Drehbuch zu einem Film, den Leute sich ansehen und dafür bezahlen sollen, ist für mich der Versuch zu einer objektivierbaren Grösse: Ein Rahmen, innerhalb dessen sich verschiedene Subjektivitäten kreuzen oder wenigstens begegnen. Wie sie es, und das ist das altbekannte Argument, später auch bei der Filmherstellung tun.
Ich kenne Regisseure, deren Seele geschmerzt ist, wenn ihr Name nicht als einziger auf dem Drehbuch und später von den Titeln genannt wird. Manche von ihnen arbeiten gleichwohl mit Co-Autoren, die aber in bezahlter Anonymität am Kunstwerk beteiligt sind.
Heute macht es mir mehr Spass, mit jemand anders ein Buch zu schreiben. Sicher eignet sich nicht jeder Stoff dazu. Aber bei jeder Filmgeschichte kommt früher oder später ein Korrektiv ins Spiel. In Gestalt eines Dramaturgen oder Produzenten. Oder auf die harte Tour erst später beim Drehen. Also lieber früher. Gerade in einer Filmkultur, die keine Kontinuität der Arbeit ermöglicht, den Regisseuren also nicht die grosse Erfahrungsbasis verschafft, die Improvisation erst gestatten würde, spielt ein ausgearbeitetes Drehbuch seine grösste Rolle. Freilich gibt es Naturtalente, die erst im Zwang zur Improvisation ihre schöpferische Kraft voll entfalten können. Aber die sind selten.
Es ist immens schwierig, einen passenden Co-Autor zu finden. Literarischen Autoren sind die Erfordernisse des Drehbuchschreibens oft fremd. Schweizerische Literaten kokettieren oft gar mit ihrer Unbedarftheit in Sachen Film. Soviel Technik. Und ei! wieviel Licht da leuchtet! Das Geld würde sie schon interessieren, das man mit Drehbuchschreiben verdienen kann. Aber ihr Kunstbegriff orientiert sich oft noch nicht mal am Feuilleton der «Zeit». Film ist ihnen etwas Exotisches, vielleicht ganz Abenteuerliches und hat mit blanken Busen und viel Geld zu tun. Aber Abenteuer sind nicht ihre Sache und das Geld — jenes der andern — ist ihnen ohnehin suspekt. Der mittlere Schweizer Literat würde ganz gern die Filmrechte an seinem Roman verkaufen, vielleicht an einer, nicht allzu anstrengenden, Drehbucharbeit mitverdienen und später dann in der Zeitung lesen, sein Buch sei halt doch besser als der gleichnamige Film, der alles nur verwässere.
Das sind Verallgemeinerungen. Aber die Tendenz stimmt leider. Vielleicht bieten sich da vermehrt Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Journalisten, die es gewohnt sind, auf die verschiedensten Stoffe und Themen einzusteigen. Und: sich selbst welche auszudenken, ohne sich dabei an die einzig gültige Form ihrer Bearbeitung zu klammem. Wichtig ist es für den Filmautor, nicht vor allem die schönen Wörter zur Beschreibung eines Bildes zu finden, sondern die präzisen. Das Denken in dramaturgischen Konstruktionen, das Hineindenken in verschiedene Filmfiguren, die gegeneinandergesetzt werden. Und vor allem: Die freudvolle Bereitschaft zur Unterwerfung unter den Stoff. Es ist nicht entscheidend, wie gut die eigenen Autoren-Ideen sind, sondern einzig inwieweit sie die Qualität des Stoffes verbessern. Hier kreuzen sich die Subjektivitäten. Hier fängt die Filmarbeit an.
Dass zwei oder mehrere Autoren, anstatt bloss einer, die Qualität eines Drehbuchs entscheidend steigern können, hat sich leider noch nicht bis zu jenen Leuten hemmgesprochen, die zur Gültigkeit von Kalkulationen das letzte Wort haben. Man geht zunächst von einem Autor aus, der, bitte sehr, möglichst noch ein Genie zu sein hat. Für zwei Autoren ist dann nicht einfach doppelt so viel Geld vorhanden, sondern es soll geteilt werden. So scheitern Pläne zur Zusammenarbeit oft an finanziellen Problemen oder aber bestimmte Formen von Selbstausbeutung werden benutzt.
Auch bei Filmemachern selbst findet sich manchmal eine Zurückhaltung gegenüber dem Kooperationsgedanken. Furcht vor der Konkurrenz? Die ist doch solange unbegründet, als jeder etwas Eigenes zu sagen hat, und dies vor allem auf seine eigene, unverwechselbare Weise. Darauf pochen ja gerade die Autorenfilmer.
Dem Publikum ist es letztlich egal, wie der fertige Film entstanden ist und woher der Stoff kommt. Aber wer Filme machen will, muss selbst wissen, was ihm lieb und teuer ist.
Mit einem schönen Buch steht und fällt alles. Zunächst jedenfalls.