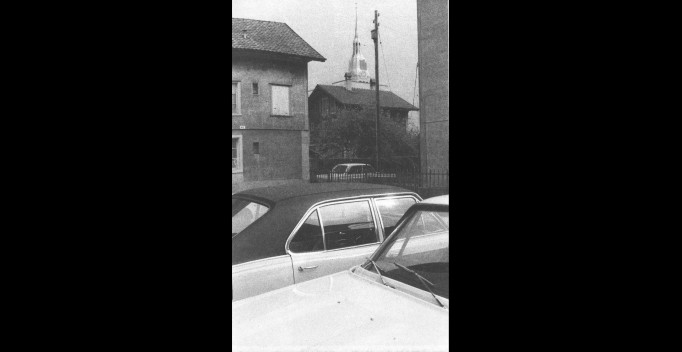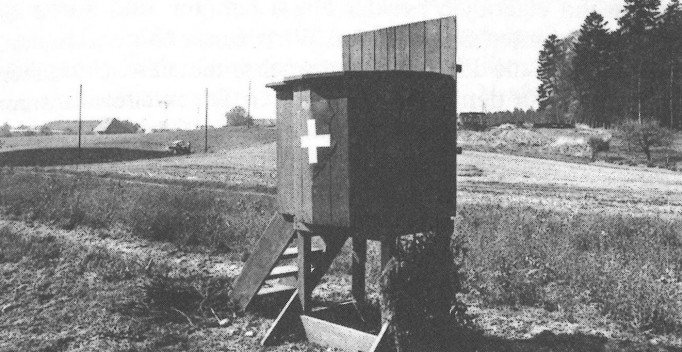Basel, 15. Juli
Selbstverliebt und elegant tänzelt er auf der Bühne herum und singt die alten Lieder. Die Abendsonne wirft ihre Strahlen über das Stadion, die bunten, die Bühne schmückenden Tücher leuchten im Gegenlicht. Im Hintergrund zieht dann und wann ein Güterzug vorbei, einmal ein unendlich langer, mit fabrikneuen Mittelstandswagen beladener. Die Schienenarbeiter haben ihre Werkzeuge zur Seite gelegt, für einmal werden sie nicht im «Blick» lesen müssen, was passiert ist, sondern selber etwas erzählen können.
Es fliegen nicht wie bei Fussballspielen Kunststoff-Bierflaschen herum, Alkohol wird nicht verkauft, nur Fruchtsäfte und Choco-Drinks. Süsse Düfte verbreiten sich, aber die Joints werden ganz selbstverständlich geraucht und herumgereicht, niemand muss hier demonstrieren, dass er einen durchzieht. Vor mir ist ein Mädchen aufgestanden, einfach aufgestanden und nicht aufgesprungen wie ein durchgedrehter Fan. Das Mädchen schreit sich nicht die Seele aus dem Leib wie die jungen Engländerinnen in den Filmen über die frühen Auftritte der Band. Sanft wiegt es seinen Körper hin und her.
Es gab eine Zeit, da ist es bei den Konzerten der Rolling Stones regelmässig zu Krawallen gekommen. Den ersten richtigen Mord, den es in einem von einer Hollywood-Firma vertriebenen Film zu sehen gab, haben die Brüder Maysels in Altamont aufgenommen. Jetzt ist alles anders. Lasst es uns noch einmal schön haben zusammen — das ist die Botschaft. Die wilden Jahre sind vorüber, und was war, das war. Über verpasste Chancen nachzudenken bringt nichts mehr.
Alter Schweizergeist
Rückblende in eine Zeit, die ich nur vom Hörensagen kenne: Die Mitarbeit bei einer Ausstellung und einer Publikation für das Berner Kunstmuseum über den 1953 gestorbenen Fotoreporter Paul Senn kommt mir gelegen. Sein Werk, sein Archiv führt zurück in die Zeit zwischen 1930 und 1950. Krise, Armut, Arbeitslosigkeit; Friedensabkommen, Landi, Mobilmachung; Krieg, Flüchtlinge und ein neuer Anfang — das sind Stichworte zur Arbeit dieses grossen realistischen Erzählers. Hingezogen hat es ihn aber ganz besonders zu den Bauern. Im Emmental, da hat er aufgeatmet. Seine Bilder zeugen von einer tiefen Verbeugung vor diesen in Feld und Wald hart arbeitenden, vor Gesundheit strotzenden Menschen, die noch eins zu sein scheinen mit ihrer Umwelt, mit ihrer Welt.
Seinen grossen Traum hat Senn in dem einzigen zu seiner Lebzeit erschienenen Buch beschworen: in dem Bildband «Bauer und Arbeiter», der 1943 in der Büchergilde Gutenberg herausgekommen ist und als Beitrag gedacht war zum «Brückenbau zwischen Stadt und Land». Im Vorwort schreibt Arnold Kubier:
Bauer und Arbeiter haben schwer, sich zu verstehen. Die Schwierigkeit liegt in der Sache. In den Streitfragen, wie das Leben der schweizerischen Stände zu ordnen sei, haben sie sich oft weit voneinander entfernt, weiter als nötig, weiter, als gut fürs Ganze war. Irrtum, Kurzsichtigkeit, Unkenntnis haben die Entfremdung gefördert. Dem besitzlosen Klassenkämpfer erschien der Bauer auf seinem Grund und Boden als Gegner oder Feind. So wollte es die politische Theorie. Dass wir in einem und demselben Vaterland zusammenwohnen, war ohne Bedeutung. Heute sind wir eines Besseren belehrt. Bauer und Arbeiter einander näherzubringen, zu gemeinsamem, einigem Handeln im Staat sie zusammenzuführen: wo ist der Mann, der dem Lande diesen Dienst tun kann? Wer ist es, der dazu die Kraft — und den Mut findet?
Sie sind mir zu gross, Kühlers Worte, auch wenn ich nicht lachen mag über den Pathos, der aus ihnen spricht. Dem Fotografen Senn und seinem Förderer Kühler nehme ich die leidenschaftliche Beschwörung einer idealen Schweiz ab, sie hatten, so glaube ich, dabei keine eigennützigen Hintergedanken. Heute jedoch ist solches ärgerlich und gefährlich. Das Denken, das diese Bilder und Worte gebar, muss oft herhalten als plumpe Propaganda. Ja, sie sind jetzt wieder öfters zu hören, die Reden, die sich am Vergangenen orientieren und das Schlagwort von der guten alten Zeit zum Mass aller Dinge machen. Aber sie passen schlecht in den schweizerischen politischen Alltag, sie werden zur Heuchelei.
So kommt es, dass ich meinen Zorn über das, was heute passiert, an dem braven Fotoreporter Senn abreagiere: Einer, der beim Schwur des Generals vor der Bundesversammlung— Senn war bei dem historischen Ereignis im Auftrag der «Zürcher Illustrierten» anwesend — die Aufnahme verzittert, der ist ein Untertan. Der hat Angst.
Die Ich-Zeit
Winterstadt beschrieb die Stimmung einer Innenwelt. Was ich erzählte, konnte jeder als meine Privatsache abtun. Was geht Mr. X denn schon dieser unrasierte, hohläugige Säufer an? Die Schwierigkeit, mit sehr persönlichen Zeichen einen Zustand, den man selber zwar besonders intensiv empfindet, von dem man aber glaubt, dass er eigentlich auch andere belasten müsste, so zu beschreiben, dass diese Zeichen leserlich bleiben, wurde mir erst im Nachhinein richtig bewusst. Beim Schreiben des Buchs und bei der Herstellung des Films war nur das eine entscheidend: dass das, was ich mache, für mich stimmt.
Dass ich konsequent von meinen eigenen Erfahrungen, Ängsten und verschütteten Hoffnungen ausging und dass ich darin nichts Aussergewöhnliches sah, war eine logische Folge meiner Arbeit als Filmkritiker. Film war für mich nie nur das, was man auf der Leinwand angeboten bekommt, sondern immer Teil eines weitverzweigten, komplizierten Systems, für dessen Funktionieren ausserfilmische Einflüsse ebenso bestimmend sind wie die Ideen der Filmautoren. Das mag zwar wie eine Selbstverständlichkeit tönen, ist es aber in der Praxis keineswegs. Eine Filmkritik, die über Inhalte und formale Gestaltung hinausgeht und auch Produktionsverhältnisse berücksichtigt oder versteckte politische Absichten aufdeckt, findet — zumindest in den Feuilletons unserer Tageszeitungen — kaum statt. Kann oft auch nicht, weil im Feuilleton von Politik und Wirtschaft nicht oder nur am Rande die Rede ist.
Schreiben über Film im Kulturteil verstand ich deshalb mehr und mehr als eine mögliche, als persönliche Reaktion auf Mitteilungen von der Leinwand. Als einer, der in erster Linie über Filme zu schreiben hat und nicht über das Kino, wollte ich nicht anders sein als der «gewöhnliche Zuschauer». Mit der Zeit habe ich diese Haltung zu pflegen begonnen. Ich ging kaum mehr in Pressevorführungen, sondern wollte mich als Teil des Publikums fühlen, wollte lachen und weinen, wie es mir gefällt, wollte nach dem Film mein Bier und nur ja kein tiefschürfendes Gespräch über das soeben Gesehene führen. Meine schriftlichen Äusserungen zum Film wurden nach und nach zu subjektiven Bemerkungen eines Zeitgenossen, der — allem zum Trotz, was unsensible Geschäftsleute dem Film antaten — ein leidenschaftlicher Kinogeher geblieben war — einer, der in der Dunkelheit des Kinosaals nach den verborgenen Zeichen des Glücks sucht.
Dieser Art des Schreibens entgegen kamen im Kino jene Filme, bei denen auch der Zuschauer spürt, dass sie aus dem Erfahrungsbereich ihrer Realisatoren herausentwickelt wurden: Wenn der dort oben von sich spricht, dann will auch ich mich in den Film einbringen können. Und umgekehrt: Wenn ich da oben etwas erzähle, dann erzähle ich von mir, denn die dort unten sollen ja auch bei sich selber bleiben.
Winterstadt also ist aus meinem und aus dem Erfahrungsbereich seines Hauptdarstellers heraus entstanden. Der Film bewegt sich in unseren Innenwelten, er handelt von Privatsachen. Im Kino aber wird die Privatsphäre des Autors verletzt von fremden Augen. Das kann zu Missverständnissen führen.
Die Idee, zwischen Privatem und Persönlichem zu unterscheiden und die Begebenheiten der Innenwelt mit den Ansprüchen der Aussenwelt zu vereinen, bildete den Ausgangspunkt zu einem weiteren Film.
Bei uns in der Schweiz
«Der Gemeindepräsident», ein Arbeitstitel. Erzählen möchte ich von den Erfahrungen eines Lokalpolitikers, der einst mit Idealismus und gesundem Menschenverstand angetreten ist, im Lauf der Zeit aber erfahren musste, dass sich diese Qualitäten im politischen Alltag schnell verbrauchen und von einer fast kalten, jenseits der Gefühlswelt liegenden Sachlichkeit abgelöst werden. Die Gleichgültigkeit der Bürger dem politischen Geschehen gegenüber einerseits und andererseits die Verrohung der «politischen Klasse», die des Bürgers Gleichgültigkeit geschickt auszunutzen versteht, macht dem Gemeindepräsidenten zu schaffen. Eine Hausbesetzung, bei der ein Parteifreund eine zwielichtige Rolle spielt, bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Die Ermordung seines besten Freundes untergräbt seinen guten Ruf endgültig, weil durch diese Tat bestätigt wird, was als Gerücht schon lange die Runde machte, für den Gemeindepräsidenten jedoch nie von Bedeutung war—aber einen schwulen Freund darf sich ein Lokalpolitiker halt nicht leisten. Die Geschichte handelt in einer kleinen Stadt. Irgendwo in der Schweiz. Heute. Die Geschichte und die Figuren sind erfunden. Doch sie könnten stimmen. Erfunden habe ich sie, weil ich nicht die Absicht habe und auch keinen Sinn darin sähe, bestimmte Personen oder Parteien in die Pfanne zu hauen. Abgesehen davon möchte ich nicht, dass das Interesse des Zuschauers an einem vordergründigen Rätselspiel darüber, welche Figur nun welche in der Öffentlichkeit bekannte Person meint, hängenbleibt.
Die Idee dahinter? Im Exposé schreibe ich:
Seit ich mich erinnern kann, wurde am Familientisch zu Hause über Politik gesprochen, über Innen- und Lokalpolitik im Besonderen. Durch diese Erfahrung mit der Politik sozusagen im alltäglichen Gebrauch, in ihrer vielleicht normalsten, unbeschwertesten Form, und dadurch, dass ich seit drei Jahren auf der Redaktion einer grossen lokalen Zeitung arbeite, habe ich das schweizerische politische Leben, ohne es bewusst anzustreben, kennengelernt.
Ich gehe — nicht immer — ins Stimmlokal, wenn ich dazu «aufgerufen» werde, und ich informiere mich über das schweizerische und das internationale politische Geschehen. Mehr und mehr aber frage ich mich, ob denn die konventionellen Formen, nach denen die heutige Politik funktioniert, nicht schon zu abgebraucht seien, um mehr als nur gerade das Nötigste zu ermöglichen. Kann die Politik auf Zeitströmungen noch so reagieren, dass diese in die politische Praxis Eingang finden?
Die Jugendunruhen und vor allem das, was sie im politischen Alltag der Schweiz ausgelöst haben, diese Verhärtung und diese Hysterie, haben mich an vielem zweifeln lassen, was für mich vorher «halt einfach so war». Das ungute Gefühl, dass die Politik, so wie sie heute ist, eines Tages nicht mehr standhalten könnte, wenn sie von einem wild um sich greifenden Fanatismus auf die Probe gestellt würde — das ist die Idee dahinter.
Und:
Winterstadt — das war ein Film als Ersatz für die Verzweiflung und die Angst, ein Film als Verdrängung dieser selbstquälerischen Lust, ganz abzudriften. Der Gemeindepräsident — das ist ein Ersatz für die gelegentliche Sehnsucht, ein Terrorist zu sein in dieser erstarrten Welt.
Mit dem Exposé will ich das Geld suchen für den geplanten Film, etwa 320000 Franken sieht das Budget vor. Das Drehbuch soll, in Zusammenarbeit mit einem Ko-Autor, der im Drehbuchschreiben mehr Erfahrung hat als ich, erst entstehen, wenn die Produktion einigermassen gesichert ist.
Ich nehme nicht an, dass die Kommissionen, denen ich mein Projekt vorzulegen gedenke, die Bemerkung von der Sehnsucht nach dem Terrorismus besonders ernst nehmen. Wie sollten sie auch, wo doch äusserlich an mir kaum etwas auf die Lust zum Bombenlegen hinweist. Ich bin kein Arbeiterkind und kein Bauernsohn, das Bürgertum, der gehobene Mittelstand hat mich geprägt. Das kann ich nicht verleugnen. Schaufenster einschlagen oder Steine schmeissen gegen Polizisten im Kampfanzug, das ist nicht meine Sache, das verbietet mir meine Erziehung, und ich muss gestehen, dass es mich nicht belastet. Ich habe gelernt, im Zweifelsfall freundlich zu bleiben, ich bin geübt darin, den Vernünftigen zu markieren. Wiewohl es mir ist in dieser halb vorgetäuschten, halb ernstgemeinten Rolle, die ich unter normalen Umständen mir selber zuweise, braucht die, die mein Projekt zu beurteilen haben, nicht zu interessieren. Es scheint mir darum fast unmöglich, einem Kommissionsmitglied, einem Experten, von dem ich vielleicht nur gerade den Namen weiss, zu erklären, was ich wie und warum ich es machen will. Ich müsste ihn eigentlich bei der Hand nehmen und durch all die Büros, Ämter, Strassen und Wirtshäuser führen können, in denen ich die Eindrücke sammelte, die sich schliesslich zu der Idee für den Film verdichteten. Ich müsste ihn über längere Zeit zum Teilhaber machen meiner Gedankengänge, ich müsste ihn soweit bringen, dass er meinen Gefühlslagen und meinen wahren Empfindungen ohne Fragen folgen könnte. Zwischen ihm und mir dürfte es keine Distanz mehr geben.
Soweit wird es nie kommen, ich weiss es, aber dieses Hirngespinst eines sozusagen paradiesischen Filmförderungs-modells mag ein Hinweis darauf sein, wie schwer die Verständigung zwischen einem um Unterstützung bittenden Filmemacher und einem Begutachter, für den dieser Filmemacher ein Gesuchssteller unter vielen ist, in einer Sache sein kann, die als Entwurf auf dem Papier vorliegt, letztlich aber erst im Kopf ihres Erfinders vorhanden ist, und auch dort noch ohne feste Form. Vom Begutachter wird hier, wenn er wirklich auf das ihm vorgelegte Projekt einzugehen bereit ist, eine Vorstellungskraft verlangt, die er beim besten Willen nicht aufzubringen imstande ist.
Das Exposé zum «Gemeindepräsidenten» erzählt gradlinig eine Geschichte, es erzählt sie in grellen Tönen. Ich will damit anzeigen, dass der Film nicht gedacht ist als Studie eines Besserwissers, der vom Schreibtisch aus auf das dumme Volk herabschaut, sondern als Drama, das ganz direkt alltägliche Vorgänge beschreibt und sie zu möglichst eindringlichen, vielleicht überzeichneten, aber typischen Bildern aus unserer Umwelt vergrössert. Dass der Film der Gradlinigkeit der geschriebenen Geschichte nicht bedingungslos folgen wird, weil er sich, wo immer es geht, auf Stimmungen einlassen soll, auf Gesichter, die selber Geschichten erzählen, kann ich zwar erwähnen, für die Beurteilung des Projekts wird dies aber kaum von Bedeutung sein, weil solche Ideen zur Gestaltung vorerst bloss Behauptungen sind.
Unsere Problemchen!
Kupferstunde von Dres Balmer. Am Schluss kehrt der Autor, der Vertreter der humanitären Organisation, mit der Erfahrung in die Schweiz zurück, dass es für einen, der sich gemäss seinem Auftrag um Entrechtete, Verfolgte und Gefangene kümmern muss, dort, wo die Menschenrechte nicht mehr gelten, fast unmöglich wird, diesen Auftrag neutral zu erfüllen. Auf dem Heimweg fährt der Autor an einer Baustelle vorbei, die Leute reden dabei «vom Bau der Abwasserreinigungsanlage, deren Zuflussrohre unter den Bahnschienen durchgeführt werden müssen, was angesichts der unerwarteten Härte des Gesteins erhebliche Mehrkosten verursacht ...» Eine für unser Land nicht ungewöhnliche Angelegenheit, über die in der Zeitung geschrieben und in Versammlungen debattiert wird. Schliesslich werden hier ja Steuergelder ausgegeben. Im Vergleich jedoch zu dem, was der Autor auf allen vorderen Seiten seines Buchs beschreibt, scheint das, was die Leute zu Hause beschäftigt, geradezu lächerlich und auch beschämend zu sein. Auf der anderen Seite beklagt man sich immer wieder darüber, dass der Bürger seiner näheren Umgebung, dem Bereich also, der ihn ganz direkt betrifft, zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Darum müsste man eigentlich froh sein, dass sich einer über den Bau einer Abwasserreinigungsanlage Gedanken macht. Müsste man eigentlich — kann man aber nicht, solange die Gewichtung unserer kleinen Problemchen und des schreienden Elends am anderen Ende der Welt dermassen unverhältnismässig ist. Hier einen Ausgleich zu schaffen, ein Bewusstsein darum, dass die Welt nicht hinter unserer kleinen Stadt aufhört, wäre Aufgabe derer, die die Informationen verbreiten. Das ist leichter gesagt als getan.
Ich habe auch einmal — indirekt wenigstens — in der Zeitung über El Salvador geschrieben: in der Tagesschau lief ein kurzer Film, der zeigte, wie Soldaten Studenten zwingen, sich auf den Boden zu legen, Gesicht nach unten, und wie sie dann, weil sich unter den Festgenommenen angeblich Subversive befinden, auf diesen Menschenteppich losschiessen. Ich habe dem Kameramann, der diese Szene festhielt, und dem Mediengiganten Fernsehen, der sie als Sensation mit makaberem Unterhaltungswert in alle Welt vertreibt, Gefühlslosigkeit vorgeworfen. Der Bericht ärgerte mich, weil er den grausamen Akt zeigte, ohne auf die Mörder oder auf ihre Opfer einzugehen. Eine Leserin hat mir dann einen bösen Brief geschickt und den Kameramann vor meiner Kritik in Schutz genommen mit der Begründung, dass dieser ja nur seine Arbeit erledigt habe. Von den Soldaten und den Studenten hat sie nichts geschrieben, kein Zorn über die einen und kein Mitleid mit den anderen fanden sich in ihren Zeilen. Ich konnte ihr deswegen keinen Vorwurf machen, denn auch ich hatte das Thema El Salvador letztlich nur als Medienthema behandelt. Etwas anderes wäre mir gar nicht möglich gewesen, ich bin Medienkritiker und nicht Redaktor im Ressort Ausland. Ich habe mich — auf einer ganz anderen, viel harmloseren Ebene als der Autor der Kupferstunde — auch neutral zu verhalten: ich kritisiere die Fernseh-Information, ich informierte nicht über El Salvador.
Ich arbeite für eine Zeitung, die man eine bürgerliche nennt. Wenn mich alte Bekannte darauf ansprechen, sage ich, dass ich dort — im Rahmen jenes Bereichs, für den ich verantwortlich bin — schreiben kann, was ich schreiben will. Ich sage auch, dass das Wort liberal im Untertitel der Zeitung kein leeres Versprechen sei. Früher, in den Jahren nach 1968, als ich mich aus Überzeugung schwarz kleidete, hätte ich mich einen Scheiss-Liberalen geschumpfen. Die Erklärung, dass man auch in einer solchen Zeitung versuchen kann, Denkprozesse anzuregen, hätte ich damals als faule Ausrede verworfen. Ist es Anpassung, wenn ich heute glaube, vielleicht etwas bewirken zu können, indem ich beim Redigieren eines von einer Agentur übermittelten Textes das Wort Rauschgift durch das Wort Rauschmittel ersetze? Bin ich naiv, wenn ich glaube, dass Veränderungen bei Kleinigkeiten, bei den Details, bei Wörtern zum Beispiel, die das, was sie bezeichnen, zugleich auch bewerten, beginnen müssen? Habe ich ein Messer im Kopf, das so raffiniert funktioniert, dass ich es nicht merke?
Die «Wölfe» der Kultur
Beim vierten Anlauf hab ich Glück gehabt: die Eidgenossenschaft erachtet ein Projekt von mir als förderungswürdig. Zweimal habe ich das Drehbuch von Winterstadt eingegeben, einmal ein Drehbuch zu einer in Italien spielenden Liebesgeschichte. Und jetzt eben das Exposé zum «Gemeindepräsidenten». Knapp sei der Entscheid der zuständigen Kommission auch diesmal ausgefallen, höre ich, aber immerhin ist der Film nun zu annähernd einem Drittel finanziell gesichert. Das ist ein Anfang, der Hoffnung macht.
Andere versuchten es häufiger als ich und hatten trotzdem keinen Erfolg. Noch andere versuchen es schon gar nicht mehr, weil sie nicht mehr daran glauben, weil sie das ständige Anrennen als Demütigung empfinden. Das Bild vom zuerst fordernden, dann bettelnden und schliesslich entweder wuterfüllten oder resignierten Filmschaffenden ist — gestern, heute und wohl auch in Zukunft — ein typisches für die Situation des Films in diesem Land. Dass auf diesem Bild dann und wann auch die zu sehen sind, die man, bloss weil sie schon länger dabei sind, die Etablierten nennt, mag zwar für manch einen Namenlosen ein gewisser Trost sein, das Bild wird dadurch aber auch nicht heiterer. Denn mit ihren Namen wird ja von denen, die zur Verbesserung der heutigen perspektivenlosen und darum bedrohlichen Lage sehr wohl etwas beitragen könnten, ganz besonders Politik gemacht. Tanner, Goretta, Schmid, Imhoof, Gloor, Lyssy und Koerfer— das sind die Namen, auf die sich dieses mühsame Wir-sind-wieder-wer-Gerede meistens bezieht. Sie sind die «Wölfe» der Kultur. Ihre Leistungen sind für die Politiker gut für grosse Worte, was aber darüber hinausgeht, will niemand so recht zu seiner Sache machen. Filmförderung, das ist halt noch kein Wahlkampfthema. In der Propaganda der politischen Parteien wird der Begriff Kultur — ganz bewusst, wie mir scheint — so abstrakt gehalten, dass die «Sachfragen» im Unterschied zu den meisten anderen Bereichen gar nicht erst angeschnitten werden müssen.
Kulturpolitik
Dem diesjährigen Filmfestival von Locarno hat Bundesrat Hans Hürlimann, der Innen- und als solcher auch der Kulturminister, einen offiziellen Besuch abgestattet. Eine Rede hat er nicht gehalten, nur beim Empfang des Filmzentrums und der Pro Helvetia und bei einer Vorführung am Abend auf der Piazza Grande — es lief Wenders' Hammett — hat er sich der Öffentlichkeit gezeigt. Als Beweis des guten Willens hat das genügt, die Medien waren anwesend und haben das Ereignis festgehalten. Es gab auch ein offizielles Essen mit dem hohen Gast. Daran teilnehmen durften Lokalgrössen (das eidgenössisch subventionierte Festival ist die bedeutendste kulturelle Veranstaltung des Tessins), der Chef der Sektion Film, der Leiter der Filmförderung, die ehemaligen Festival-Direktoren und der neue Direktor. Zugelassen wurden auch, obschon vorerst nicht vorgesehen, jene Mitglieder der Auswahlkommission, die zugleich auch dem Exekutivkomitee des Festivals angehören. Die Liste ist vielleicht nicht ganz vollständig, sicher aber ist, dass Hürlimann mit denen, die von der Filmförderung ganz direkt betroffen sind, nicht zusammengekommen ist: mit den Filmschaffenden. Wer es seltsam fand, dem wurde erklärt, dass solches in der hohen Politik gang und gäbe sei. Zudem sei es bei Anlässen dieser Art nicht möglich, mit dem Bundesrat richtig ins Gespräch zu kommen.
Bis einem Bundesrat die Nöte der Filmschaffenden zu Ohren kommen, werden sie gesiebelt und geschliffen. Sie werden übersetzt in eine Sprache, die die extreme Äusserung nicht kennt: Was ganz unten verzweifelt tönt, kommt ganz oben als vorsichtige, als diplomatische Mahnung heraus.
Jetzt ist Bundesrat Hürlimann zurückgetreten. Vor ein paar Jahren noch hätte ihm in Filmerkreisen wohl kaum jemand nachgetrauert. Nun sind jedoch Befürchtungen laut geworden, dass durch diesen Rücktritt die Anliegen der Filmschaffenden zurückgestellt werden könnten. Hürlimann, so heisst es, hätte im Lauf der Zeit für diese Anliegen sensibilisiert werden können.
Eines wird da offensichtlich: die Entwicklung der Labor-Preise und der Mitarbeiter-Honorare, die rasante Teuerung also und die immer höheren Ansprüche, die heute von Expertenkommissionen, Kritik und Publikum an die Filme gestellt werden, korrespondieren in keiner Art und Weise mit der Entwicklung film- oder überhaupt kulturpolitischer Prozesse.
Letztes Jahr im Herbst
Vor einem Jahr: die Italienreise. Die Idee war, ohne feste Route, aber doch einer grossen Bewegung von Süden nach Norden, vom Herbst in den Winter folgend, unterwegs zu sein und aus einem Gefühl des Ungebundenseins heraus einen Film zu entwerfen. Eine Handlung war zuvor schon skizziert worden, es sollte die Hauptfigur ein etwa vierzig Jahre alter Mann sein (ich dachte daran, noch einmal mit Peter Hasslinger, dem Charlie aus Winterstadt, zu arbeiten), kein Aussteiger, aber einer, der mit sich selber nichts mehr Rechtes anzufangen weiss. Ihm begegnen sollten drei Frauen: eine verbitterte Ehefrau auf Ferienreise, die Tochter eines Fremdarbeiters, die erstmals in ihrer Heimat war, dort die grosse Liebe fand und nun nicht mehr recht weiss, ob sie bleiben oder zurückfahren will, und schliesslich und vor allem Olga, eine Frau auf der Flucht, eine, die zu Hause ausgerissen ist, weil sie ihren brutalen Mann und überhaupt diese kleinkarierte Welt, die sie gefangen hielt, nicht mehr ertragen konnte. Olga trägt ein Geheimnis mit sich herum, sie steht vor einer grossen Entscheidung. Und sie ist bereit, sich einem Fremden anzuvertrauen.
Von Entwurzelten, von Suchenden in einer ihnen unvertrauten Landschaft sollte der Film handeln. Dabei sollte die Hauptrolle die Landschaft selber darstellen — die Landschaft als grosse Betörerin, als einmal vergnügte, einmal melancholische Kupplerin.
Es blieb bei dem schönen Erlebnis, bei der Reise, die von Perugia durch Umbrien nach Castiglione del Lago am Trasimeno-See führte, von dort weiterging nach Siena, später nach Parma, schliesslich nach Domodossola und über Iselle auf den Simplon-Pass. Das Drehbuch, das in den Monaten nach der Reise — im Winter — entstanden war, vermochte den auf der Reise im Kopf gedrehten Film nicht wiederzugeben, es blieb bei Andeutungen, beispielsweise über Fotografien. Die Geschichte — die bis zum Drehbeginn sicher noch oft abgeändert worden und vielleicht selbst beim Drehen noch auf andere Wege gekommen wäre, weil sie eben aus der Landschaft, die sie durchquert, hätte wachsen sollen — wirkte eher konventionell, weil sie nicht viel mehr war als das Gerüst einer Idee. Damit kann man einen Film aber nicht finanzieren.
Ein Beispiel: Mir war es nicht besonders wichtig, dass die Hauptfigur ein Fernsehredaktor ist. Der Mann musste einfach einmal einen Beruf haben, und da habe ich einen gewählt, der mir wenigstens nicht ganz unvertraut ist. Die, die mein Projekt zu beurteilen hatten, sahen das aber anders.
Ich glaubte, durch Winterstadt sei deutlich geworden, dass ich eine für einen Film gedachte Geschichte oder einfach eine Reihe von Ereignissen erst aufgelöst in Bildern richtig erzählen kann. Natürlich sollte das bei jedem Regisseur so sein, doch mein Fall schien mir ein besonderer. Ich habe mich getäuscht.
Rückschläge
Das Exposé zum «Gemeindepräsidenten» kommt, einmal abgesehen von einigen Begutachtern des Bundes, bei denen, die das Beschriebene kennen, besser an als bei den Filmspezialisten. Obwohl dies für mich beruhigend ist, weil es zeigt, dass ich offenbar mit dem, was ich vorhabe, einiger-massen richtigliege, hilft es nicht weiter: Das Fernsehen lehnt ab, mit dem Drehbuch kann ich aber noch einmal vorbeigehen. Die Migros lehnt ab, auch dort kann ich es später vielleicht noch einmal versuchen. Und die Grossbank, die mir nach der abgelehnten Eingabe für Winterstadt einen freundlichen Brief geschrieben und mich aufgefordert hat, ein neues Projekt wieder einzureichen, will mir auch diesmal nichts geben.
Ich weiss nicht, wie Routiniers auf solche Ablehnungen reagieren. Mich verunsichern sie jedes Mal, ich beginne, an meiner Arbeit zu zweifeln und ich versuche, auf die Argumente derer einzugehen, die in dieser Situation ganz einfach am längeren Hebel sitzen, auch wenn diese Argumente manchmal keine sind, auf die einzugehen ich bereit sein müsste: Mich interessiert die Figur dieses Lokalpolitikers nicht, sagt ein Fernsehredaktor. Das Ganze erinnert zu stark an die Telebühne, meint ein anderer Experte. Ist eine Vorlage ungenügend, wenn sie einen Fernsehredaktor nicht interessiert? Sind Themen, die von der Telebühne aufgegriffen werden, danach «besetzt»?
Heimkehr eines Europäers
Der Stand der Dinge: Ein europäischer Regisseur dreht in Portugal für einen amerikanischen Produzenten einen schwarz-weissen Film mit dem Titel The Survivors. Die Figuren dieses Films durchqueren unter grössten Strapazen ein offenbar verseuchtes Wüstengebiet und erreichen einen Ort am Meer, der sie endlich wieder hoffen lässt, ein neues Zuhause vielleicht. Während der Film — die Fiktion — sich zu einem guten Ende hin zu wenden scheint, kommt es in der Wirklichkeit zur Krise. Die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden, weil kein Filmmaterial mehr vorhanden ist und kein Geld, um neues zu kaufen. Zudem ist der Produzent spurlos verschwunden. Für die in einem riesigen, vereinsamten Strandhotel untergebrachte Filmequipe beginnt eine Zeit des Wartens und der Langeweile. Plötzlich ist nichts mehr da, was die Schauspieler und die Techniker von ihren persönlichen Problemen ablenkt. In dieser ausweglosen Situation entschliesst sich der Regisseur, nach Los Angeles zu gehen, um seinen Produzenten — ein Freund, wie er gegenüber dem Filmteam versichert — zu finden. Als er diesen — in einem Wohnmobil, das ein bissiger Chauffeur ziellos durch die Stadt steuert und das für den Produzenten den letzten sicheren Ort darstellt — gegenübersitzt, ist es aber bereits zu spät. Der Produzent ist ein gebrochener Mann, er beschimpft sich selber und seinen Regisseur, weil er die Dummheit begangen hat, sich mit einem Europäer einzulassen. Am Schluss werden die beiden auf offener Strasse erschossen: die Unvernünftigen haben in Hollywood keine Chance.
Wim Wenders hat Der Stand der Dinge während der rund vierjährigen Arbeit an Hammett realisiert. Hammett erzählt die Geschichte eines Privatdetektivs, der sich zurückziehen und schreiben will, durch einen alten Freund aber noch einmal in eine dunkle Affäre verwickelt wird. Wenders hat den Film im Studio und unter amerikanischen Bedingungen hergestellt. Sein Produzent war Francis Ford Coppola. Er hat seinen europäischen Kollegen zum Angestellten degradiert und ihm in die Arbeit gepfuscht.
Der Stand der Dinge nun handelt zwar von einer gescheiterten europäisch-amerikanischen Zusammenarbeit, aber er ist nicht zur grossen Abrechnung eines in Amerika verratenen Europäers geworden. Das wäre auch nicht richtig. Wim Wenders wollte ja nach Amerika gehen, er träumte von diesem Land wie einst die Auswanderer, die in ihrer Heimat nicht mehr bleiben konnten oder wollten. In den frühen Kritiken und in den Filmen vor seinem amerikanischen Abenteuer hat Wenders den Weg dorthin schon lange vorgezeichnet.
Der Stand der Dinge ist ein Film, in dem Wenders seine amerikanischen Erfahrungen zusammenbringt mit seiner wiedergefundenen Eigenart. Der Stand der Dinge ist somit ein Film, der sich Zeit nimmt und nicht blindlings einer Geschichte folgt, sondern ruhig, fast bedächtig die Bewegungen der Gefühle und die Gegenbewegungen der äusseren Einflüsse registriert.
Filme seien keine Fertighäuser, erklärt der Regisseur, der den Film im Film dreht, einmal. Coppola hat Wim Wenders gezwungen, ein Fertighaus aufzustellen. In Hammett wird eine Geschichte vorangetrieben, die Szenen sind kurz geschnitten: Action/Schnitt/wieder Action/wieder Schnitt — keine Zwischenräume, keine Freiräume für die Gedanken. In Der Stand der Dinge sind die Freiräume die bewegendsten Momente des Films, die Momente, die zu langen Sekunden werden und zwischen dem liegen, was man üblicherweise eine Geschichte nennen würde. Diese Erzählweise ist der Tradition des europäischen Films sicher mehr verpflichtet als der des amerikanischen: Wim Wenders ist auf dem Heimweg.
Gern möchte ich ihm entgegengehen. Heute habe ich Theres und Martin die ersten dreissig Seiten des Drehbuchs geschickt. Es läuft nicht schlecht, erklärte ich ihnen am Telefon.
In Basel hat Mick Jagger auch dieses alte Lied noch einmal gesungen: «Time is on my Side». Zum Glück ist es auch auf der 1981 in Amerika entstandenen Konzert-Platte «Still Life» zu hören.