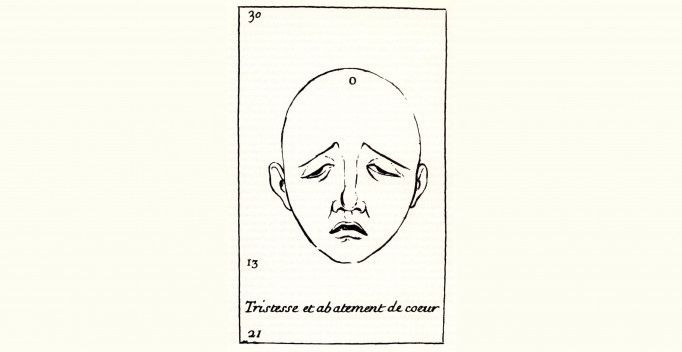„Ohne Dich haben sie eine leere Leinwand.“ -James Cagney
AM Für den Schauspieler im Film scheint die Maxime zu gelten: Weniger ist mehr.
FK Leider, ja. Die Schauspieler agieren heute, als säßen sie in dieser Hütte in Chaplins The Gold Rush (1925). Du erinnerst dich. Die Hütte hängt über einem Abgrund, und die kleinste Bewegung kann sie zum Absturz bringen. Sobald Chaplin und seinem Widersacher das klar wird, praktizieren beide einen absoluten Minimalismus der Geste. Es ist schon folgerichtig, daß Arnold Schwarzenegger heute der bestbezahlte Filmschauspieler der Welt ist. Das Filmacting hat sich von einem anfänglichen Uber-Agieren zum schlichten Nicht-Agieren gemausert. Vor dieser Tendenz hatte schon der eigentliche Entdecker einer eigenständig filmischen Schauspielkunst, D.W. Griffith, gewarnt. So soll er einmal zu Lillian Gish gesagt haben: „Schau, während einiger Zeit ist die Leinwand dunkel durch diese Verschlußblende. Man sieht also nur einen Teil von dem, was du machst. Das mußt du kompensieren.“ Er vertrat also die eigentümliche Meinung, daß man mehr machen müsse als im Theater. Und er hatte recht. Das übertriebene Grimassieren, das die allerfrühsten Filme prägte, und das immer noch als Schreckgespenst herumgeboten wird, entstand dadurch, daß zunächst auch der Ton kompensiert werden mußte. Asta Nielsen etwa hat darauf ausdrücklich hingewiesen. Das stimmt aber nur für eine ganz kurze Zeit; nur in den allerersten Anfängen hat überhaupt diese plumpe Unbeholfenheit im Umgang mit dem Medium geherrscht. In unserem Gedächtnis springen wir dann immer auf den Tonfilm rüber und lassen im Grunde die wirklich große Zeit der Schauspielkunst, nämlich den Stummfilm in den zwanziger Jahren, außer Acht. In den letzten Jahren des Stummfilms entstanden aber Filme wie La Passion de Jeanne d’Arc (1928) von Carl Th. Dreyer mit Maria Falconetti, wo in diesen berühmten Großaufnahmen ihres Gesichtes eine ganz neuartige Spieltechnik sichtbar wurde, die nichts mit dem Theater zu tun hat, aber alles mit dem Film. Und Asta Nielsen selbst entwickelte in ihren heute leider nicht mehr so oft gezeigten Filmen, die von der Regie her keine Meisterwerke sind, erstaunliche Techniken, eine ... ja, Mehrstimmigkeit möchte ich mal sagen, in den Abläufen ihrer Charakterdarstellung, die hochinteressant ist. In ihrer Autobiographie Die schweigende Muse beschreibt sie, wie, als dann der Tonfilm kam und man wieder anfing, die Information in den Dialog zu verlegen, von der großen Kunst, dem hochentwickelten Kammerspiel der späten Stummfilme bald nichts mehr übrig blieb. Durch den schnellen Schnittwechsel wurde der Schauspieler davon befreit, überhaupt etwas darzustellen. Der Schnitt übernahm das Erzählen. Pointiert formuliert: Der Schauspieler hat in dieser Spieluhr, die der Tonfilm darstellt, die Aufgabe, neben dem Sprechen durch sein Erscheinen den roten Faden zu markieren, etwas Konstantes einzubringen, an das man sich halten kann in dieser Zentrifuge aus Musik, Dialog, Schnitt und Rhythmus. So entstand der Schauspieler als blank (leere Hülse, Platzpatrone). Und das ist bis heute so geblieben. Alle scheinen der Meinung zu sein, beim Filmschauspiel sei das Sein wichtiger als das Darstellen, als das einsehbare Herstellen eines Charakters.
AM Siehst du nicht die Gefahr, daß solches sichtbare Darstellen auf eine erneute Theatralisierung des Films hinauslaufen könnte?
FK Weißt du, sehr vieles, was auf der Bühne geschieht und was die Abstraktion des Spiels auf dem Theater ausmacht, hängt mit dem Produktionsort Theater zusammen. Anders als beim Theater aber, wo gewisse Feinheiten schon nach der zehnten Reihe nicht mehr bemerkt werden, wirkt die Filmkamera bekanntlich wie ein Mikroskop das eben, bitte schön, mehr wahrnehmen kann, als von bloßem Auge möglich ist. Dem Schauspieler sollte man demnach logischerweise mehr abverlangen, als auf irgendeiner Bühne. In diesem Zusammenhang ist Ariane Mnouchkines Film Molière (1978) aufschlußreich, weil sie die filmischen und theatralischen Techniken miteinander konfrontiert. Drei grundverschiedene Stile stoßen in diesem Film aufeinander, und die Ergebnisse dieser Konfrontation sind ebenso spannend wie ernüchternd. Da ist einmal das in knöchernem, weltfremdem Akademismus förmlich erstarrte, ja verkommene klassische Bühnenpathos. Dieser hohe Stil, der in Szenen aus Britannicus (1669) von Racine vorgeführt wird, hat jede Beziehung zum Leben verloren und wirkt in seinem Autismus nur noch lächerlich. Dem wird ein von der Commedia dell’Arte kommender komödiantischer Theaterstil entgegengestellt, der sich dadurch auszeichnet, daß er zwar nicht weniger künstlich, aber zugleich äußerst erfinderisch ist. Man sieht den Schauspielern an, wie ihre Hirne rasen, um überraschende Einfälle wie ein Sperrfeuer auf den Zuschauer loszulassen. Die Invention steht im Zentrum. Dann gibt es die dritte Spielebene, die filmische. Sie gibt sich als das Leben selbst, täuscht vor, kunstloses, reales Sein unmittelbar abzubilden. In Wirklichkeit aber ist sie ebenso in in ihren Mitteln beschränkt und erstarrt wie das kalkgesichtige Pathos der Racine-Szenen.
Draußen im Garten proben vier Schauspieler. Zwei markieren etwas hölzern eine Liebesszene und werden dabei von zwei anderen beobachtet. Der eine ist Molière, die andere seine Lebensgefährtin. Im Verlauf der Probe nun beginnt das Spiel zwischen den drei Stilen hin und her zu pendeln. Die Schauspielerin ist dem Molière anfangs zu starr, und er spielt ihr die Sache vor. Bei diesem Vorspielen kippt er immer witzig in diesen äußerst inventiven Komödiantenstil, der sehr bewegt und gestisch aktiv ist. Seine Backen blasen sich auf, seine Augen beginnen zu zittern ... Ähnliches geschieht, wenn er die Schauspielerin bei ihrem Agieren beobachtet. Die Freude über ihr Spiel färbt auf ihn ab. Darüber hinaus gibt es die persönliche Beziehung zwischen ihm, als Molière, und der Schauspielerin, wo sich eine „reale“ von Molières Lebensgefährtin schweigend beobachtete Liebesgeschichte anbahnt, und die ist auf der Ebene eines völlig kunstlosen Spielens angelegt. Es entsteht jenes typische Blicke-Karussell, das heute schon fast synonym für „Kino“ geworden ist. Verstehe mich nicht falsch. In diesem konkreten Fall reichen ein Paar in der richtigen Achse gehaltene Schauspielerköpfe durchaus aus, um eine weitere psychologische Ebene zu etablieren, aber stimmt es nicht traurig, immer wieder sehen zu müssen, wie für das filmische Agieren noch das Simpelste, die klischierteste Reduktion, gut genug ist? Darin steht dieser Stil dem blutleeren Agieren in Britanniens näher, als man meinen würde. Beide sind inventionslos und nur auf Konventionen der Glaubwürdigkeit aus. Da die Konventionen des klassischen Theaters für uns nicht mehr verbindlich sind, sehen wir sofort, was für ein unglaubliches Gerippe uns da vorgeführt wird. Aber weil wir die ebenso extremen Konventionen, die in der äußersten Beschränkung der filmischen Spielart liegen, nicht wahrnehmen wollen, da wir diesen Abgedroschenheiten immer wieder brav aufsitzen, sehen wir nicht, daß es hier ähnlich im Gefüge knarrt.
AM Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Krise des Schauspielens im Film und seiner fehlenden theoretischen Aufarbeitung?
FK Unbedingt. Schau, es gibt eine riesige Zahl von Büchern, die sich mit Film befassen. Sämtliche Aspekte des Films werden da mehr oder weniger gescheit theoretisch abgehandelt. Es gibt Detailstudien, es gibt Gesamtübersichten, was du nur willst. Aber eine der zentralsten Sachen, nämlich die Menschen, die in diesen Filmen agieren - darüber herrscht nahezu vollkommenes Schweigen, die Theorie beschäftigt sich lieber mit Farbdramaturgie oder mit Schnitttechnik. Nimm ein Standardwerk wie How to Read a Film (1977) von James Monaco; es kommt ohne jegliche Erwähnung der Arbeit, der Kunst des Schauspielens aus! Sogar in den Biographien, die es, weil der Film noch immer eine populäre Kunst ist, im Übermaß gibt, findet man über die spezifische Kunst, der Filmschauspieler immerhin ihr Leben gewidmet haben, außer Anekdoten nichts. Auch in den Biographien oder Autobiographien von betont virtuos agierenden Akteuren, wie James Cagney oder Michel Serrault, erfährt man kein Wort über die Errungenschaften ihrer Kunst.
AM Und wie erklärst du dir das?
FK Es ist eine bestimmte Ideologie, die sich da an der Kunst rächt, die Ideologie eines kurzgeschlossenen Naturalismus, wie sie sowohl vom Publikum als auch von der Filmindustrie fortwährend reproduziert wird. Gemäß dieser Ideologie stellt der Schauspieler im Film nicht dar, sondern er ist: Clint Eastwood ist Dirty Harry. Die logische Folge davon ist, daß Technik als etwas Negatives angesehen wird. Denn dem allgemeinen Klischee zufolge bedeutet Spielen im Film Nicht-Spielen. Oder wie Hitchcock mal sagte, man übe dort „die Fähigkeit, Worte dadurch auszudrücken, daß man nichts tut“. Hast du am Drehort einen Schauspieler, der noch keine Erfahrungen im Film gemacht hat, so wird er dir todsicher sagen, er habe das Gefühl, überhaupt nichts zu machen. Das ist falsch. Das, was er bis zur Nacktheit abstreifen muß, ist seine Theatertechnik. Aber das heißt nicht, daß das, was übrigbleibt, schon die filmische Technik ist. Eine gewiße Natürlichkeit wird sicher durch die große Nähe der Filmkamera, vor allem aber durch die Wirklichkeit des Drehorts erzwungen. Du kannst in einer realen Umgebung nicht so leicht den Abstraktionsgrad erreichen, wie er beim Theater oder bei anderen Künsten möglich ist. Du mußt dich der Realität eines Baumes irgendwie angleichen, einen ähnlichen Grad von Selbstverständlichkeit erreichen. (Entweder der Baum paßt sich an oder du, nicht wahr.) Aber das reicht noch nicht aus. Leider läßt sich die Geschichte der Schauspielkunst im Film bis heute im wesentlichen auf diesen technischen Striptease, der am Schluß den Schauspieler wie ein gebalgtes Kaninchen der Kamera überläßt, reduzieren. Es ist interessant, daß die einzige Theorie, die einzige ach so filmgerechte Methode, die es für den Schauspieler gibt, das sogenannte method acting aus dem Actor’s Studio von Lee Strasberg, das in den fünfziger Jahren mit Elia Kazans On tbe Waterfront (1954) in Hollywood einbricht, daß dieser Stil überhaupt kein typisch filmischer ist, sondern unmittelbar vom Theater übernommen wurde, nämlich von Stanislawsky, genauer gesagt, vom frühen Stanislawsky-Theater der Jahrhundertwende. Stanislawsky hat mit einem ganz extremen, noch vom Symbolismus eingefärbten Naturalismus angefangen. Die Unsichtbarkeit der schauspielerischen Arbeit auf der Bühne war für ihn die wichtigste Voraussetzung. Alles wurde radikal zurückgenommen. Die großen Momente, die immer wieder beschrieben werden in den frühen Inszenierungen Stanislawskys, sind - inhaltlich gesehen - zwar unglaublich emotionelle Momente, aber die wurden von einem Schauspieler ganz hinten auf der Bühne, mit dem Rücken zum Publikum gewandt, gespielt. Der Zuschauer merkte, es ist eine große Emotionalität da, aber er sah fast nichts davon. Und diese oft buchstäbliche Unsichtbarkeit des Spiels des frühen Stanislawsky-Theaters ist ja im Grunde der Erbgroschen, mit dem bis auf den heutigen Tag im Film gewuchert wird. Die leeren Blicke und das auf ein Nichts reduzierte Spiel im Film haben dort ihren Ursprung. Strasberg hat dieses Stanislawsky-Theater bloß vulgarisiert, indem er die Methode zu einer Art Psychotherapie umfunktioniert hat. Wenn man dieses method acting genau anschaut, so sieht man, daß es eigentlich keine Technik ist, die es erlaubt, ganz bestimmte gestische, ausdrucksspezifische Werte technisch umzusetzen. Die Methode bewegt sich gleichsam im Vorfeld einer Professionalisierung. Sie gibt vielleicht dem Schauspieler eine innere Haltung an, aber sie zeigt ihm in gar keiner Weise, wie er das umsetzen kann.
AM ‚Warum wurde gerade diese Methode, obwohl sie doch vom Theater her kam, für den Film so erfolgreich f
FK Hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, daß das Strasberg-Theater, obwohl es aus dem politischen Theater in Amerika kam, diesen politischen Kontext und damit auch das Kollektiv in der schauspielerischen Arbeit verleugnet hat. Das Individuum wurde in einem ganz romantischen Sinne wieder ins Zentrum gestellt, und damit hat Strasberg dem Starsystem in die Hand gespielt. Zweitens kam dieser äußerste Naturalismus und diese extreme Unsichtbarkeit des Spielens der Hollywoodschen Kunstfeindlichkeit entgegen. Hollywood ließ nur einen Schauspieler zu, dem man das Können nicht ansah. Kunst kommt in Hollywood nur als Betriebsunfall vor. Auf diesen beiden Ebenen hat das vom Theater kommende method acting von Lee Strasberg in Hollywood überhaupt Fuß fassen und zumindest ideologisch eine Monopolstellung erringen können. Dabei ist zu sagen, daß die eigentlichen method acting-Filme in Hollywood absolute Randerscheinungen blieben. Sogar derart erstaunliche schauspielerische Leistungen wie von Karl Maiden, Eli Walach und Caroll Baker in Baby Doll (1956) blieben in der Filmstadt ohne Echo. Ironischerweise hat das Beste in diesem Film herzlich wenig mit method acting zu tun. Die Schauspieler gehen darin so souverän mit ihren Mitteln um, stellen sie derart heraus, daß es stellenweise wie eine Parodie auf Lee Strasbergs Psychotour wirkt. Die psychischen Zusammenbrüche und die latente Hysterie, die dieser Methode innewohnt, wird von ihnen in Anführungszeichen und so witzig gespielt, daß man den Eindruck bekommt, der typische Methode-Stil sei bestenfalls als Zitat da. Caroll Baker, die das Klischee einer etwas dümmlichen Kindfrau spielt, der zwei Männer zum Opfer fallen, konterkariert die von der Figur verlangten IQ-Abgründe blitzgescheit, und das, obwohl der Text ihr dazu eigentlich keine Chance ließ; ein Text, dessen Südstaatenakzent sie manchmal nachgerade singt, als wären ihre Dialoge ariosi in einer Buffo-Oper. Sie macht andauernd technisch verrückte Sachen. So trägt sie zum Beispiel, wenn sie draußen ist, weiße Handschuhe. Dadurch drängt sich jede Geste brutal in den Vordergrund. Andere Schauspielerinnen hätten zumindest die Farbe dieser Handschuhe abgetönt, aber nein, Bakers Hände knallen richtiggehend aus dem Bild heraus, und sie weiß das natürlich. Jede noch so kleine Bewegung, die sie mit den Händen macht, springt sofort ins Auge. In der Arztpraxis oder draußen im Wagen, wenn sie wartet, macht sie damit eine Menge wunderbare Dinge.
Viele Leute, die immer als method actor-Leute angesehen werden, sind im Grunde keine. Weder ist Robert De Niro ein method actor, noch ist Marlon Brando einer. Brando wurde von Stella Adler, die wie Strasberg aus dem frühen Kollektivtheater kam, ausgebildet. Stella Adler war angewidert vom method acting, und es kam mit Strasberg schon in den dreißiger Jahren zum Bruch. Adler ist dann nach Paris zu Stanislawsky gereist, weil sie nicht glauben konnte, daß Stanislawsky solche exhibitionistischen Seelenmassagen ins Zentrum der Schauspielkunst stellte, und hat während der letzten Jahre seines Lebens bei ihm Unterricht genommen. Stanislawsky hatte schon in den zwanziger Jahren dieses unsichtbare Theaterspielen aufgegeben und sehr viel mehr auf die Komplexität des theatralischen Vorgangs Wert gelegt. Auch der Maske, den Kostümen und den Objekten verlieh er wieder neues Gewicht und rückte auch äußerlich den Reichtum des Spielens in den Mittelpunkt. Aus diesem Grund kommt die große Gegenbewegung gegen das method acting durch Stella Adler ebenfalls von Stanislawsky. Und Brando, der ihr berühmtester Schüler war, hat deshalb den meisten method actors gegenüber den großen Vorteil, daß er über eine ganz solide schauspielerische Technik verfügt. Das merkt man am deutlichsten seinem Sprachduktus an. Die meisten, oder fast alle Hollywood-Schauspieler nuscheln irgend etwas vor sich hin. Auch De Niro übrigens. Das fällt weiter nicht auf, weil sie immer diese plebejischen Figuren spielen, denen auch in der Realität der Zugriff auf die Sprache fehlt. Das undeutliche Artikulieren der Wörter, die abgebrochenen Sätze, die nur schwer verständlich sind, diese ganze Unbeholfenheit wirkt sehr realistisch. Das hat aber zur Folge, daß alles, was davon abweicht, zur Schulfeierrede verkommt. Wenn Schauspieler wie Spencer Tracy oder James Stewart Texte kriegen, die nicht in einer absolut grauen Alltagssprache gehalten sind, so hört man lieber weg, denn daraus werden immer Reden an die Nation, die ganz peinlich und papieren wirken. Brando aber geht schlafwandlerisch sicher mit Sprache um, schreckt dabei auch im Film nicht vor starken Stimmverdrehungen zurück. Und er ist mit Orson Welles einer der wenigen, die im Film mit Schminke umgehen können. Er muß halt nicht dauernd diesen Pseudonaturalismus bedienen. Übrigens alle method-Leute, die wirklich großartig sind, wie Al Pacino oder Shelley Winters, haben ihre Technik anderswo gelernt und kamen im Grunde bereits „fertig“ zum Actor’s Studio.
AM Kommen wir doch noch einmal zurück auf den Gegensatz von Viel und Wenig in der Technik der Filmschauspielerei. Das Wenig-Machen wird als alleinseligmachend deklariert, und das Viel-Machen ist als theatralisch und damit unfilmisch verpönt. Gibt es Beispiele für Schauspieler, die viel machen und bei denen es trotzdem nicht abgefilmtes Theater ist?
FK Nehmen wir etwas ganz Elementares - nehmen wir das Gehen im Film. Etwas boshaft gesagt, stellt die filmische Technik an den Schauspieler, neben einer ausreichenden Lockerheit der Muskeln, noch eine weitere technische Anforderung, nämlich während der Dauer des Takes von Punkt A nach Punkt B zu kommen, und zwar möglichst ohne das Mobiliar dabei umzuwerfen, wie Spencer Tracy einmal sagte. Diese Aufgabe, die oft die einzig wirklich technische Anforderung an einen Schauspieler im gegenwärtigen Film ist, besteht darin, sich in einem ziemlich engen, durch das gesetzte Licht und die Kameraposition festgelegten Korridor zu bewegen, aber das so zu machen, daß diese Einengung für den Zuschauer nicht spürbar wird. So weit, so wenig. Bloß, daß allein schon mit diesem Gehen spannende Sachen anzustellen wären, wenn nur nicht ... Aber beginnen wir mit Robert Mitchum. Ausgerechnet er gilt als exemplarisches Beispiel eines Schauspielers, der angeblich nichts tut, und das auf eine so beängstigende Weise, daß sogar seine Kollegen am Drehort sich darüber gewundert haben sollen. Und gerade dieser Schauspieler, der dem Klischee des „Nichts-tun“ zu entsprechen scheint, macht in seinen guten Rollen sehr sehr viel, ungeheuerlich viel, und scheut, wie etwa bei den wunderbar grotesken Mitteln, die er sich für Night of the Hunter (1955) hat einfallen lassen, keine Risiken. Von Mitchum gibt es eine lustige Technik, die als Emblem für das gängige Schauspiel im Film gelten könnte. Ein Regisseur hat ihn dabei beobachtet, wie er beim Lesen eines Drehbuches auf fast jeder Seite eine Abkürzung, bestehend aus drei Buchstaben, anbrachte, nämlich „N.A.R.“. Man fragte ihn, was dieses „N.A.R.“ zu bedeuten habe, und er hat geantwortet: „No Acting Required“ (Schauspielen überflüssig). Und selbstverständlich wird Mitchum bei jenen Einstellungen ein N.A.R. gesetzt haben, wo das Gehen von ihm verlangt wurde. Nun gibt es aber fast nichts Ereignishafteres als gerade das Gehen von Mitchum. Das ist kein einfaches Sichbewegen von A nach B, sondern ein sehr komplexes Manöver, womit sich dieses Schiff in Bewegung setzt, mit einem sehr merkwürdigen schläfrigen Blick. Es ist eine sonderbare Kombination von stillgelegten körperlichen Elementen und bewegten Teilen, eine Kombination von ganz großen Gesten, wie diesem sehr starken Aus-der-Hüfte-Schwenken, der ebenso starken Gegenbewegung der Schultern, den dagegen relativ unbeweglichen Armen und jenem etwas schläfrigen, abwesend wirkenden Blick, wodurch eine in sich widerspruchlose Verschachtelung entsteht; da wechselt, verstehst du, etwas ziemlich Polyphones den Ort. Es gibt bei großen Schauspielern im Film gewisse Achsen, die immer gleich bleiben und um die herum sich jener Mikrokosmos, genannt „Charakter“, entwickelt, ja, man bekommt fast den Eindruck, er ist daran aufgezäunt. Man könnte diese Achsen als die „toten Punkte“ bezeichnen. Bei Erich von Stroheim etwa kannst du das gut beobachten. Mit seinem steifen, wie von einem Korsett gehaltenen Oberkörper wirkt das, was er körperlich macht, als würde er um ein totes Zentrum kreisen. Dadurch erscheinen auch kleine Gesten wie abgenabelt; seine große Aktivität wird durch „Lähmung“ ausbalanciert. Bei Buster Keaton ist es das Pokerface, das scheinbare Stillegen der Gesichtszüge bei einer äußerst agilen Körpersprache; bei der Dietrich diese wie am Licht klebende Grundpose. Mit solchen „toten Punkten“ kann eine merkwürdige Körperspannung erzeugt werden, die den Blick gefangen hält, ohne daß ihr Zustandekommen sofort analysiert werden kann. Und das braucht gar nicht als Markenzeichen nur gewissen Stars Vorbehalten zu bleiben. In Die sieben Samurai (Shichinin no Samurai, 1954) gibt es einen Typus von Laufen, der diesen toten Punkt bei mehreren Schauspielern hervorruft und der zudem perfekt auf eine bestimmte filmische Technik abgestimmt ist. Kurosawa sind ja einige filmische Erfindungen zu verdanken - die auffallendste davon ist gewiß das „Kurosawa-Travelling“. Das ist eine sehr, sehr rasche Fahrt, meist mit Leuten, die auf Pferden durch Wälder reiten. Und dabei ist es so, daß Kurosawa dann Sträucher, Gräser, Gestrüpp im Vordergrund hat, so nah und meist auch derart lichtfangend, daß sie eine starke Unschärfe aufweisen. Durch das extrem rasche Travelling werden diese unscharfen Objekte noch radikaler verwischt und lösen sich gleichsam zu einem cinéma pure auf, als würde man nur noch die Emulsion flattern und flitzen sehen. In Die sieben Samurai nun gleicht die Art, wie die Schauspieler sich beim schnellen Laufen bewegen, diesen Kurosawa-Travellings. Sie halten den Oberkörper nahezu unbeweglich, als würden sie still stehen, gleich einem Reiher, der auf das Opfer wartet. Aber sie wechseln dennoch in ihren rockähnlichen Hosen rasend schnell den Ort. Diese Hosen sind sehr bunt bemalt, und die Beine gehen so schnell, daß im Grunde genau das gleiche passiert wie bei diesen raschen Travellings. Die Kamera schwenkt oder fährt mit, hält dabei den Oberkörper im Bildzentrum fixiert, während die Beinbewegung so rasch ist, daß Unschärfen auftreten. Das sind magische Momente, nicht wahr, weil im gleichen Bild, ohne daß ein Trick dabei ist, Stillstand und alles auflösende Geschwindigkeit in ein und derselben Person Zusammentreffen.
Aber gehen wir doch auf diese Geste des Gehens im Film etwas umfassender ein. In einem der ersten Filme von Stanley Kubrick, The Killing (1956), läßt sich dieses Gehen genauer analysieren. Bezeichnenderweise hatte Kubrick damals noch kein Geld für richtig große Stars, d.h. der Film ist ausschließlich mit supporting actors, mit bitplayers besetzt, mit Schauspielern also, die immer kleine Rollen haben, die nie in den Vordergrund treten, die aber in diesen kleinen Rollen sehr charakteristisch und prägnant sein müssen. Es sind Schauspieler, die darauf spezialisiert sind, in einem System, das das Darstellen verpönt, zu schauspielern. Sie sind gewissermaßen das Reservat, in das die Schauspielkunst in Hollywood sich zurückgezogen hat. Und Kubrick hat in The Killing die Rollen ausschließlich mit solchen Leuten besetzt und schaffte so die Voraussetzung für einen Film, in dem die schauspielerischen Leistungen nachgerade sensationell sind.
In diesem Film, der über die Planung und die Ausführung eines Überfalls auf die Kasse dieser Rennbahn berichtet, gibt es ein immer wiederkehrendes Travelling: Dreimal im Verlauf der Handlung fährt die Kamera durch die große Halle der Rennbahn, an den verschiedenen Schaltern vorbei über einen mit Figuranten ziemlich gefüllten Raum. Und dreimal geht einer der Hauptakteure vom Eingang dieser Halle nach rechts, wo sich eine kleine Bar befindet. Sicherlich sind aus arbeitsökonomischen Gründen diese drei über den ganzen Film verteilten Travellings hintereinander gedreht worden. Weil es eine sehr lange Plansequenz ist, weil es sich um gute Schauspieler handelt und weil Kubrick, was er auch in anderen Filmen bewiesen hat, eine große Sensibilität für schauspielerische Qualitäten hat (in seinen Filmen wird meist besser agiert als von den gleichen Schauspielern in anderen Filmen), haben die Leute, schon um sich nicht zu langweilen, sich bei diesen Gängen etwas einfallen lassen. Der erste Gang, unmittelbar nach dem Titelvorspann bringt also gleich eine erste Variation des Geh-Themas mit dem Schauspieler Jay C. Flippen. Sein Gang ist sehr ruhig, aber er macht dabei seltsame kauartige Kieferbewegungen. Der Parcour wird ihn zur Theke führen, wo er, groß herausgestellt, mit der einen Hand seinen faltigen Hals vom Kinn abwärts streicht. Diese Bewegung wird begleitet von einer zweiten, die eigentlich ganz nebenbei stattfindet, sich aber als die Hauptaktion herausstellt. Er hat nämlich während seines Ganges aus seiner Hosentasche ein Zettelchen gezogen und trommelt damit leicht auf der offenen Handfläche. An der Theke angekommen, bestellt er ein Bier und legt den Zettel wie einen Bierfilz auf den Tisch, stützt dann aber seinen Ellenbogen auf den Zettel ab, so daß dieser nicht mehr sichtbar ist. Der Barkeeper bringt das Bier mit einem richtigen Filzuntersatz, und in dem Augenblick hebt der Gast kurz den Ellbogen, worauf der Barkeeper rasch den Zettel an sich nimmt. Diese zentrale Aktion wird dadurch vorbereitet, daß eigentlich dauernd von ihr abgelenkt wird, sei’s mit dieser auffallenden Geste des wiederholten Streichens des Halses, sei’s und mit der seltsamen kauenden Mundbewegung, oder sei’s mit jener wunderlichen Zettelstrategie.
Etwas später - ganz genau die gleiche Einstellung, wieder nach den gleichen Schnittbildern des Pferderennens (es wird von Kubrick richtiggehend formalisiert) - läuft in dieser menschenreichen Halle in einem identischen Travelling ein Schauspieler, der eigentlich kein Schauspieler war, sondern ein Laie, ein Freund von Kubrick, Kola Kwariani, den wir einige Szenen vorher als Besitzer eines Schachclubs kennengelernt haben. Etwas in seinem Körperbau - er ist kahlköpfig und kurz gedrungen, ein unglaublicher Muskelprotz, und widerspricht zutiefst dem Klischee eines Intellektuellen, eines Schachspielers - erregt unsere Aufmerksamkeit. Der Mann scheint schwer „gegen den Typ“ besetzt. Da läuft er jetzt durch die Halle und, obwohl er sehr ruhig geht, sind seine Schritte merkwürdig rudernd und von ziemlich ausgreifenden Armbewegungen begleitet, als wanderte er nicht auf einer geraden Ebene, sondern als stiege er einen Berg an. Dieser Mann investiert einen großen Energieaufwand in ein einfaches Gehen, was nicht nur im Widerspruch zum flachen, ebenen Boden steht, sondern auch zu seiner lächelnden, freundlichen Gelassenheit und zu der Kraft, über die dieser Mann sichtbar verfügt. Warum strengt ein Mensch sich bei einem so einfachen Gang derart an? Er hält an der Bar inne, bestellt ein Bier und schaut sich ganz freundlich um. Das ist zunächst das Ende der Einstellung. Später stellt sich heraus, daß dieser Mann dorthin bestellt ist, um vom eigentlichen Überfall abzulenken, indem er eine Riesenschlägerei vom Zaun bricht. Der Überschuß an Energie, der in diesem Mann, in seinem Gang und durch Besetzung gegen den Typus potenziert vorhanden ist, erweist sich als die eigentliche Überraschung, wenn er als Muskelprotz plötzlich mit sich selbst identisch wird. Er war ganz und gar nicht gegen den Typ besetzt. Es sah nur so aus.
Dann gibt es zum dritten Mal das gleiche Travelling: die gleiche Rennhalle, die gleiche Kamerabewegung, die gleiche Komparserie. Und Sterlin Hayden, zu jener Zeit noch ein typischer bitplayer, geht durch die gleiche Halle. Hayden war insofern schon damals der geborene Star, als er immer sehr gelassen ist. (An Helden prallen die Ereignisse bekanntlich ab.) In diesem Gang aber geschieht etwas, was sowohl dem dargestellten Charakter wie der schauspielerischen Technik von Hayden vollkommen widerspricht. Er scheint unsicher, fast schüchtern. Er geht durch die Halle, und sein Blick wandert scheu durch den Raum. Wie sich nachher herausstellt, ist auch das eine reine Finte. Der Mann hat nie in seinem Leben so genau, bis auf die Sekunde, gewußt, was er macht, als während dieses Ganges. Er geht hin, er weiß, daß an der Theke der kleine, gedrungene Mann steht, er sieht an einem der Schalter einen anderen Komplizen, er sieht, daß ein Polizist an einer Tür, wo er nachher zur Kasse eindringen wird, unaufmerksam ist. Der Gang aber drückt eine Unsicherheit und eine Verlegenheit aus, die witzigerweise völlig im Gegensatz steht zu der eigentlichen Funktion dieses Ganges. Er schauspielert bewußt, als hübsches Präsent an den genauen Beobachter und als Falle für den weniger aufmerksamen. Drei identische Gänge, die in anderen Filmen der Rede nicht wert gewesen wären, wurden in The Killing zum Ereignis.
Darf ich noch ein bißchen beim Gehen bleiben?
AM Gewiß.
FK In Malina (1987), einem Film, auf den wir sicher noch zurückkommen werden, weil er, wenigstens was die Leistung der Hauptdarstellerin Isabelle Huppert angeht, ein Musterbeispiel einer Gegenstrategie zum üblichen Agieren im Film ist, nimmt auch das Gehen einen breiten Raum ein. Das Gehen, das Sichbewegen ist überhaupt etwas, das im Film noch immer unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt: Leute gehen oder fahren in Autos. Das Sich- fortbewegen ist im Film, dramaturgisch gesehen, überproportional vorhanden, weil wir uns offenbar in einem so frühen Stadium der Filmgeschichte befinden, daß die Motorik der bewegten Bilder noch immer als Ereignis empfunden wird. Wir haben da offenbar noch immer diesen naiven Blick des Lumièreschen Zuschauers von L’Arrivée d’un train en gare (1895). Aber das nur nebenbei.
Bei Huppert nun wird das Gehen dadurch merkwürdig, daß sie sich in Innenräumen so bewegt, wie man sich sonst nur im Freien bewegen würde. Sie rennt fast, als sei ihre Aktivität ein zielgerichteter Spurt gegen die Zeit. Aber da sie das sehr lange macht und immer wie in einem Labyrinth in ihrer Wohnung herumirrt, merkt man, daß es sich genau umgekehrt verhält: Die äußerste Bestimmtheit des schnellen Ganges ist Ausdruck einer absoluten Richtungslosigkeit. Sie weiß nicht, wo sie hingeht; sie ist zu Hause in der Fremde, und bei jeder Kurve, die sie nimmt, richtet sie einen ganz und gar verwunderten Blick auf das, was da wohl kommen mag. Und was wird schon kommen? Räume und Korridore einer Wohnung, in der sie schon seit zehn Jahren lebt! Hupperts schauspielerische Mittel heben das Alltägliche in ein wunderliches Unbekanntes und charakterisieren so eine Frau am Rande eines Nervenzusammenbruches. Daß das nicht nur ihre eigene schauspielerische Entscheidung ist, zeigt sich unter anderem an den Zwischenschnitten. Ihre Verwunderung über das, was an der nächsten Ecke wohl auftauchen mag, sieht man nämlich nur in diesen, funktional eigentlich überflüssigen, die Zielgerichtetheit des Gehens fast behindernden Zwischenschnitten in einer Halbnahen. Regisseur Werner Schroeter hat in Malina die Huppert offensichtlich immer ermutigt, alles zu tun, um die typischen Grundhaltungen des filmischen Naturalismus ja nicht erst aufkommen zu lassen. Denn nur durch engste Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Schauspieler, das heißt durch ein unbedingtes Vertrauen, das jenem zwischen Hochseilartisten nicht unähnlich ist, kann ein Schauspieler überhaupt so weit gebracht werden, sich gestisch derart zu exponieren.
AM Das kann ja sehr leicht ins Peinliche gehen.
FK Oh ja! Einer der Gründe, warum Schauspieler als „Nichtspieler“ so Erfolg haben, ist, daß sie damit nichts falsch machen können. Wegen der schlechten oder fehlenden Proben, wegen der Unruhe am Drehort und weil man ihn mit seiner Rolle oft allein läßt, ist es für den Schauspieler natürlich ein absoluter Segen, daß es heute Norm ist, nichts zu machen. Wer sich auch in den Großaufnahmen nicht entäußert, kann auch nicht peinlich auffallen, und auch nicht durch den Schnitt in seiner schauspielerischen Leistung denunziert werden. Wenn jemand wie Huppert, die auch entsetzlich konventionell und alltäglich, comme il faut, agieren kann, in einem Film wie Malina so mit sämtlichen Gesetzen des aktuellen Agierens bricht, so kommt das, weil sie vom Regisseur dazu verführt worden ist, das zu machen, und weil auch das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden so groß ist, daß sie sich derart weit vorwagte. Soviel zum Gehen und sich Gehenlassen im Film.
AM Dein Begriff des Gestischen bezieht, und das erstaunt mich, auch Körperbewegungen wie das Gehen und anderes ein. Könntest du deine Auffassungen über die Geste genauer darlegen?
FK Ich glaube, daß die filmische Schauspieltechnik eine Technik sein sollte, die vordringlich all jene Körperbewegungen, die nicht vom Willen gesteuert werden, die reflexartig und unwillkürlich ablaufen in den Bereich des Willkürlichen zu heben hat. Juri Hofman definiert sie als Gesten, die keine Zeichenhaftigkeit besitzen und deshalb zumeist unbemerkt bleiben. Sie sind, wie er es nennt, bedeutungsfrei. Mit etwas Übertreibung könnte man sagen, daß, während im Theater mit bedeutungstragenden Bewegungen gearbeitet wird, der Film das Terrain der willkürlichen, weitgehend bedeutungsfreien Geste ist. Das allerdings stellt neuartige, nicht gerade leichte Anforderungen an den Schauspieler. Denn dazu bräuchte es ein intensives Training, um all jene dauernd ablaufenden Muskelspannungen und unwillkürlichen Aktivitäten, die an der Oberfläche unseres Körpers ständig auftauchen, der Willkür des schauspielerischen Willens zu unterwerfen. Und warum? Weil in einer Großaufnahme des Gesichtes genau das zum „Schlachtfeld der Persönlichkeit“ wird, der Blick genau darauf eröffnet wird. Es ist nicht nur das Augenaufschlagen oder das sarkastische Lächeln oder der beschämt sich senkende Blick. Das wäre auch in einer Halbnahen oder sogar in einer Totalen sichtbar. Was nicht in einer Totalen sichtbar ist, und was auch nicht auf einer Theaterbühne zeigbar ist, das sind all die scheinbar nicht gesteuerten Reflexe, die sich in einem Gesicht und in einem Körper abspielen. Und die sind, und das ist das Überraschende, nur in den seltensten Fällen psychologischer Natur. Das macht sie eben so spannend und ihre bewußten Einsatzmöglichkeiten so vielfältig. Wenn ein Jucken zum Beispiel Zusammentritt mit einem beschämten Augenniederschlagen, entsteht eine Komplexität, ein Reichtum der gestischen Äußerungen eines Menschen, der direkt, als würde man Blut spenden, vom Leben zehrt. Wenn du irgendwo Leute beobachtest, die sich unbeobachtet wähnen, so ist es schwindelerregend, auf wie vielen Ebenen der Mensch gleichzeitig funktioniert. Da ist also der reine Organismus mit seinen Bewegungen, die meist nur wie Schatten durch unsere Aktivitäten huschen, da sind all jene oft blitzartig aufleuchtenden Reflexe auf äußere und innere Vorgänge. Wenn man diese Elemente in ihrem Zusammenspiel genau observiert, dann ist es nicht so, wie man das immer wieder im Film vorgeführt bekommt, daß eine Ebene, meist die psychologische, die andern derartig dominiert, daß diese gleichsam davon verdrängt werden oder höchstens eine ornamentale Bedeutung zugestanden bekommen. Jemand weist auf seine Stirn, um damit anzudeuten, der andere sei ein Idiot. Diese Eindeutigkeit der Geste ist in der Realität die Ausnahme. In der Wirklichkeit kann dieser Finger, der auf die Stirn zugeht, durch einen Juckreiz gestört werden oder von einer unerklärlichen Neigung, vorher die Zunge anzutippen. Die Eindeutigkeit der einen Geste interferiert mit der Unbestimmtheit einer anderen. Du hast in der Wirklichkeit, bei Leuten, die entspannt in ihrem Alltag aufgehoben sind, immer eine extreme Polyphonie der gestischen Aktivitäten, die sich behindern oder verstärken. Der Mensch ist eben etwas chorisches, wenn auch selten so im Kino. Aber es gibt Ausnahmen. In Angelheart (1987) trifft Mickey Rourke seine Freundin, er küsst sie flüchtig, und im Moment, wo er den Kopf wieder zurück nimmt, ist es, als ob ihm auf einmal etwas im Mund steckt, ein Stück Brot oder so, etwas, was unbedingt zerkaut werden muß. Solche Nebenschauplätze des Gestischen einzuführen, verlangt den Mut zu einer gewissen Willkür, aber ihre Faszination für den Zuschauer liegt gerade darin, daß sie, paradox formuliert, „bedeutungslose“ Zeichen setzen.
AM Die Chance, den ganzen Bereich der gestischen Maschine, der gestischen Landschaft in den Griff zu kriegen und vorführbar zu machen, wird offenbar Tag für Tag verpaßt.
FK Eine Modellszene dafür, wie es sein könnte, ist die Telefonszene in Malina - du merkst, ich komme immer wieder auf die gleichen Filme zurück, einmal weil es dadurch eine gewisse Konzentration gibt, wenn man nicht hunderte von Filmen zitiert, andererseits, weil es sehr wenige Filme gibt, die vom mainstream acting abweichen. In dieser Telefonszene macht Huppert so gut wie ausschließlich Gesten, die (einmal abgesehen vom Telefonieren, was eine bewußte Sache ist: man nimmt den Hörer ab, stellt die Nummer ein, schließt die Tür, spricht, und so weiter) ablaufen und die funktionale Handlungsgestik pausenlos durchkreuzen. Denn das Typische an Reflexgesten ist, daß sie sich nicht an das Metrum der Handlung halten, sondern sich quer dazwischen schieben. Ihr nasses Haar, das an der Stirn klebt, streicht sie mit fahrigen, nicht sehr präzisen Bewegungen weg (etwas technisch sehr Schwieriges, weil das Fahrige präzis gespielt werden muß). Sie macht abgehackte rasche Bewegungen mit der Hand, sie zieht mehrmals die Lippen nach innen, als wollte sie das Lippenrouge ausgleichen, es gibt ganz merkwürdige Zuckungen, ein kurzes knappes Lachen ... All das gestaltet Huppert zu einem atemberaubenden Spektakel. Wie mit einer Schrotflinte wird eine Aktion durch reflexartige Störelemente durchlöchert, und das mit einer schauspielerischen Virtuosität, die selten ist. Bei jemandem, der so auf seine Karriere und seinen Marktwert bedacht ist wie Huppert, ist das auch schon deshalb ein Ereignis. Auf dem Theater wäre das allein schon technisch so gut wie unspielbar, weil ein Mensch nur für eine kurze Zeit der Konzentration sich derart verausgaben kann. Man könnte nicht zwei bis drei Stunden durchhalten, wenn jemand auf eine solche Art des Spielens setzen würde, einmal abgesehen davon, daß das meiste im Saal verloren ginge. Das wird nur sichtbar dank diesem Kameraauge. Für mich bildet dieses Spiel mit unwillkürlichen Bewegungen das Zentrum des Filmischen Agierens, auch wenn es von Schauspielern nur ganz selten aufgegriffen wird.
Eine dritte Kategorie der genuin filmischen Geste bilden all jene Alltagsroutinen, die - meist aus beruflichen Gründen - von bestimmten Mensch so schlafwandlerisch perfekt beherrscht werden, daß so eine Art „Überbewältigung“ der Aufgabe entsteht. Vielleicht erinnerst du dich an jene wunderbaren Lichtgeschwindigkeiten, womit in Mystery Train (1989) der Japaner mit seinem Feuerwerk hantierte. Geschwindigkeit ist nunmal etwas, das der Film über alles liebt. Es wird zwar heute viel über all das Atemlose geschimpft, und das mag als Ideologiekritik eine gewiße Berechtigung haben, obwohl ich mir da auch nicht mehr so sicher bin - dem Film ist das wurscht. Er schnurrt wie ein Kater, sobald er etwas Schnelles vor die Lupe bekommt. Sehr rasche Gesten haben im Film eine gewisse Magie. Sehr vieles von Keatons Zauber hängt damit zusammen, daß er den Prozeß der Internalisierung einer zunächst feindlichen Welt durch Handlungsperfektionierungen, durch ein virtuoses Übererfüllen der Aufgabe vollzieht, das dann in ein derartiges Prestissimo mündet, daß sogar das schnelle Filmkorn Mühe hat, mitzukommen.
Bei Keaton fällt mir noch ein weiterer Typus der Geste ein, der für den Film grundlegend ist, nämlich das Choreographische, das filmisch so ungeheuer wirkt. Sicher ist da der große Anwalt Chaplin, der im Grunde alles, sämtliche Gesten, sämtliche Bewegungen zu einem Ballett umfunktioniert. Aber der körperlich wohl innovativste Akteur ist doch eindeutig James Cagney, der wohl nicht zufällig, bevor er zum Film kam, Steptänzer war. Seine körperliche Supplesse rührt daher. Die außerordentliche Bedeutung, die einer Choreographierung von filmischen Handlungsabläufen zukommt, hängt mit dem zusammen, was ich die Kompensation des fehlenden Körpers im Kino nenne. Alles Physische erhält im Film, im Gegensatz zum Theater, wo der Körper zwangsläufig gegeben ist, eine ganz eigentümliche Qualität, weil Präsenz dort reine Simulation ist: Den Kinnhaken spürt der Zuschauer zwar bis in den Kinosessel, und er findet trotzdem nicht statt. Das Merkwürdige am Film ist ja gerade, daß du alles hast, was die Präsenz eines Menschen, eines Dinges oder auch einer Landschaft ausmacht: die Farben, die Bewegung, die Illusion der Tiefe und dergleichen. Nur die Körperlichkeit fehlt, und gerade diese Tatsache veranlaßt das Kino zu oft atemberaubenden Kompensationsgeschäften.
AM Unter der Hand hast du eine zweite Argumentationsebene eingeführt. Während du zu Beginn die rein schauspielerische Arbeit analysiert hast, die von der Kamera beobachtet wird, verläßt nun, mit dem Begriff der Kompensation, die filmische Apparatur ihre bisher passive Rolle und greift sozusagen direkt in die gestischen Abläufe ein.
FK Auch diese Dialektik zwischen Schauspieler und Apparatur ist etwas, das meiner Meinung nach zu wenig reflektiert wird. Nimm zum Beispiel dieses bereits früh auftretende Verbot, in die Kamera zu schauen.
AM Die Herstellungsart des Films produziert offenbar bestimmte Effekte, die dann relativ rasch ästhetisch als ungewollt empfunden wurden, wie Anschlußfehler, Kontinuitätsfehler und so weiter.
FK Genau. Ein ganz frühes Verbot betraf eben das In-die-Kamera- Schauen. Es war bald verpönt. Und heute noch, wo das eigentlich immer wieder vorkommt, ist es vor allem ein Verfremdungsmittel. Es wird eingesetzt, um die Situation des Filmemachens bewußt zu machen. Etwa bei Godard, wo das immer wieder geschieht, oder genauer: geschah. Das Schauen in die Kamera sollte dem Publikum bewußt machen, daß es keine Wirklichkeit anschaut, sondern einen Artefakt, etwas Gemachtes. Und so legitim (wenn auch nicht sehr aufregend) das ist, so verschenkt ist das doch, wenn alles, was nicht naturalistisch ist, auf diesen einen desillusionierenden Effekt aufbaut. Denn eigentlich zementiert das den Naturalismus. Man schaut in die Kamera und sagt: „Jetzt wende ich mich aus der filmischen Realität heraus in eure. Wenn ich wieder zurückgehe, bin ich wieder reine Natur.“ Laß mich ein paar Beispiele aus der Filmgeschichte zitieren, wo der Blick in die Kamera nicht diesen desillusionierenden Effekt hat. Als ich mich fragte, warum die Brechtsche Technik eigentlich für den Film absolut unfruchtbar ist, habe ich unter anderem den Blick in die Kamera, der immer als desillusionierend gedeutet wird, genauer untersucht. Und da habe ich bei sehr vielen Regisseuren gesehen, wie reich dieser Ausdruck des In-die-Kamera-Schauens ist, und daß es überhaupt nicht diesen desillusionierenden Effekt zu haben braucht. Es gibt sehr früh, in Orphans of the Storm (1921) von D.W. Griffith, eine Szene, wo Lillian Gish direkt in die Kamera schaut. Sie hat ihre Schwester verloren, und in dieser Szene hört sie draußen ihre Schwester singen. Da sie aber in ein Gespräch mit einer andern Frau verwickelt ist, spielt sich ihre Wahrnehmung plötzlich auf zwei Ebenen ab. Bewußt redet sie mit dieser Frau weiter, während auf einer unbewußten Ebene der Gesang ihrer Schwester von draußen zu ihr dringt. Das müßte im Grunde, weil sie diese schon seit langem sucht, zu einem unmittelbaren Abbruch dieses Dialogs führen, indem sie auf den Balkon rennt und so etwas ruft wie: „Da bist du ja endlich!“ Aber irgend etwas filtert dieses Bewußtsein aus ihr raus, daß das die Stimme ihrer Schwester ist, die von draußen zu vernehmen ist. Griffith macht das, indem er die Gish zu jener Partnerin im Innenraum weiter reden läßt, währenddem sie aber anfängt, direkt in die Kamera zu schauen. Und dieses Direkt-in-die-Kamera-Schauen wirkt nicht als Dekuvrierung der filmischen Technik oder der Illusion, sondern verstärkt die Nichtanwesenheit der Schauspielerin auf der Leinwand. Weil sie uns anschaut, wird in dem Moment, in diesem ganz bestimmten Kontext, für uns erfahrbar, daß diese Lillian Gish, die uns anschaut, nicht real da ist, nicht wirklich bei uns ist. Das potenziert die Abwesenheit, und das ist genau das, was mit ihr psychologisch in diesem Moment geschieht.
Ein weiteres Beispiel: Es gibt eine Situation in Les fantômes du Chapelier (1982) von Claude Chabrol, wo Michel Serrault, dieser wunderbare Schauspieler, plötzlich in die Kamera schaut. Er spielt einen Frauenmörder, der meint, er morde eigentlich aus ganz rationalen Motiven, während für den Zuschauer immer deutlicher wird, daß er in einem Kreis gefangen ist, daß er, wenn der Grund zum Morden vorbei ist, weiter morden wird. Bei diesem Wendepunkt des Films gibt es eine Szene, wo der ermüdete Serrault nach Hause kommt und sich von seiner Haushälterin die Stiefel ausziehen läßt. Die Kamera ist auf dieser Aktion des Stiefelausziehens, schweift dann mit so einem typischen langsamen Chabrolschen Schwenk ab ins Leere. Im Hintergrund ist ein Kamin zu sehen, man hat den Eindruck, die Kamera schwebe weg ins Nichts der Zeit. Man sieht ausgebreitet Unbedeutendes, was ja oft bei Chabrol die Momente sind, wo sehr Bedeutendes geschieht, und die Kamera wie abschweift, um dann ins Herz des Films vorzustoßen. Genau das geschieht auch hier, wenn der abwesend wirkende Serrault plötzlich groß ins Bild kommt und direkt in die Kamera starrt. Ich sage dir, das wirkt wie ein Schock. Es ist der Ausdruck einer immensen Verzweiflung, mit der man als Zuschauer plötzlich konfrontiert wird. Die Situation wirkt wie ein Hilferuf, wie im Puppentheater, wo der Kasperle sich unmittelbar an die zuschauenden Kinder wendet. Der Effekt dieser Szene ist, daß man als Zuschauer beim Anblick dieser unglaublich anrührenden Verzweiflung aufspringen möchte. Serrault spielt jemanden, der mit allen möglichen Menschen Kontakt sucht, diesen aber dann nie in die Augen schaut. Das Auf-den-Boden-Schauen oder Weg-Schauen ist in diesem Film ganz extrem etabliert. Im Moment der höchsten Verzweiflung aber, wo die Sinnlosigkeit des Mordens zu seiner eigenen wird, schaut er jemanden, nämlich uns, an. Und wir? Wir sind nicht da! Serraults Machtlosigkeit schauckelt sich an unserer Machtlosigkeit hoch. Kennst du Nachtasyl (Donzoko,1957) von Akira Kurosawa? Da gibt es am Schluß eine Szene in diesem auf einer sehr verzweifelten, sozialrealistischen Theatersache von Maxim Gorki basierenden Film, wo sich ein Schauspieler umbringt. Er bringt sich in einem Augenblick um, der im ganzen Film der fröhlichste ist. Von allen Schauspielern, die im Film Vorkommen, wird ein japanischer Volkstanz aufgeführt, und jedes Instrument, das üblicherweise zu diesem sogenannten „Bakabayashi“ gespielt wird, wird dabei nur mit der Stimme nachgeahmt. Das ist eine witzige, schauspielerisch perfekt dargebotene Jahrmarktsnummer. Da kommt die Nachricht rein, daß der Schauspieler, der im Film auch einen Schauspieler darstellt, sich umgebracht habe. Abrupt bricht der Tanz ab, und einer der Spieler schaut in den letzten Sekunden des Films direkt in die Kamera und sagt so etwas wie: „Der Idiot! Jetzt fing der Spaß erst an.“ Kurosawa schneidet darauf unmittelbar in Schwarzfilm um. Schockartig beendet er den Film. Es gibt einen lauten Trommelschlag, wodurch die Großaufnahme des in die Kamera schauenden Schauspielers wie weggefegt wird. Jene artistische Tanznummer, die als ein einziger Spaß inszeniert ist, schlägt durch den Suizid plötzlich um in „die Ernsthaftigkeit des Lebens“. Und die filmische Simulation (ein Film ist ja die Projektion von Abwesendem) wird auf einmal durchbrochen, indem sich der Schauspieler nach 90 oder 100 Minuten Spieldauer auf einmal direkt an uns richtet und sagt: „Jetzt, wo es so schön wird, ist der Spaß vorbei.“ Es ist, als ob der Schauspieler aus dem Film heraus kurz real ins Präsens springt, um dann sofort durch jenen harten Umschnitt ins Schwarze erst richtig ins radikal Nichtanwesende geschleudert zu werden. Das setzt zum Schluß eine ungeheure Energie frei. Auch da hat das In-die-Kamera-Schauen wieder eine ganz eigene Wirkung. Sogar ein relativ bekannter Effekt wie das In-die-Kamera-Schauen kann also x-welche Bedeutungen und x-welche ästhetische Wirkungen haben, die nicht darauf reduzierbar sind, einfach nur Nicht-Naturalismus zu meinen.
AM Steht denn der zeitlich extrem befristeten Inszenierungsarbeit auf dem Set eine wirkliche Entfaltung der schauspielerischen Kunst entgegen?
FK Ja und nein. Das typisch Filmische an der Darstellungskunst wird durch die Produktionsbedingungen zugleich behindert und ermöglicht. Aus Kostengründen oder aus welchen andern Gründen auch immer wird auf Proben so gut wie verzichtet. Das ist keine neue Tendenz. Schon Wsewolod Pudowkin beklagt sich in seinem Buch über die Filmschauspielkunst darüber, daß die Proben beim Film eigentlich eine Farce seien. Meist wird erst kurz vor dem Drehen die Situation besprochen. Das verführt den Schauspieler dazu - und das ist ihm nicht vorzuwerfen - auf sicher zu spielen, keine Risiken einzugehen. Denn einmal ist die Situation, die er vorfindet, neu für ihn, und die Filmaufnahmen finden oft zu einem Zeitpunkt statt, wo er sich erst einmal auf die konkreten Anforderungen des Drehortes einstellen muß. Dadurch ist der schon derart ausgelastet, daß er leicht vergißt, auch mal Nicht-so-auf-der-Hand-Liegendes in Erwägung zu ziehen. Der zweite Grund ist, daß er als Schauspieler die Konsequenzen, wenn er anders spielen würde als möglichst zurückgenommen, möglichst wenig preisgebend, nicht absehen kann. Sobald er seine Rolle austauschbar anlegt, das heißt, so wenig wie möglich macht, kann er sich auch kein Ei legen, nicht wahr. Denn gesetzt den Fall, ihm fällt etwas ein, was er drei Wochen später, wenn der Anschluß gedreht wird, vielleicht gar nicht durchhalten kann, entweder weil er es inzwischen schlicht vergessen hat oder weil es am neuen Ort oder im Rahmen der gewählten Kameraausschnitte nicht anzubringen ist. Kurz: Invention setzt zwangsläufig voraus, daß intensiv geprobt wird. Von Broken Blossoms (1919) von Griffith wird berichtet, er habe sechs Wochen mit der ganzen Equipe geprobt. Heute wäre das unvorstellbar und einfach nicht zu bezahlen. Für Way Down East (1920) ließ er sogar acht Wochen proben. Und für Nachtasyl von Kurosawa wurde vierzig Tage in Kostümen vor laufender (wenn auch nicht geladener) Kamera geprobt. Dadurch bekommt der Schauspieler überhaupt Zeit, erfinderisch zu werden, und dadurch konnte zudem etwas entstehen, was man eigentlich seit Jahrzehnten im Film nicht mehr sieht, nämlich das Ensemblespiel. Üblicherweise bereitet sich jeder völlig individuell auf seinen Part vor, und wenn das dann auf einandertrifft, nun ja, dann entsteht eben ein relativ zufälliges Geben und Nehmen. Filme, wo die Geste eines Schauspielers von der Geste eines anderen aufgefangen wird und fast musikalisch instrumentierte Verläufe in einer Gruppe von Menschen stattfinden, wo Anschlüsse nicht nur durch den Schnitt gemacht werden, wo echte rhythmische Flexibilitäten möglich sind, wo Tempi Umschlägen können und durch eine ganze Gruppe aufgefangen werden, und nicht zufällig ein Schauspieler ein wenig schneller oder langsamer als ein anderer ist, solche Filme sind nur dank langen Proben möglich. Aber ich höre schon brüllen: „Da geht die Spontanität verloren.“ Scheiß auf die Spontanität, sage ich, wenn dabei immer nur dieses Zombie-Theater herauskommt!
AM Aber reden wir über das fragile Verhältnis zwischen Regisseur und Schauspieler.
FK Der Schauspieler ist das verletzlichste Element im Film überhaupt. Er gleicht einem Schmetterling, der den Staub auf seinen Flügeln vorführt. Die Zeichnung ist so fein und fragil, daß es wenig braucht, um sie zu zerstören. Aus diesem Grund braucht der Schauspieler einen unbedingten Rückhalt bei den Leuten hinter der Kamera, nicht nur beim Regisseur. Wie dieser Rückhalt vom Regisseur - sagen wir ruhig - inszeniert wird, ist dann eigentlich gleichgültig; das kann in Ausnahmefällen sogar durchaus ein „Messer im Rücken“ sein, wie Orson Welles es manchmal praktizierte. Wie etwa im Falle von Glenn Anders in The Bay from Shanghai (1946), den er zwischen den Takes bewußt derart verunsicherte, daß der arme Mann beim Drehen ganz durcheinander geriet, was seinem Porträt eines Schurken eine eigenartige Nervigkeit verlieh. Mit anderen - und waren es auch Kleindarsteller - hat Welles oft tagelang geprobt, wie etwa mit dem damals noch unbekannten Dennis Weaver für dessen Rolle als Motelwächter in Touch of Evil (1958). Das Resultat ist einer der gewiß unkonventionellsten, aus allen Rahmen fallenden Kurzauftritte der Filmgeschichte. Im gleichen Film dagegen hat er Dietrich zu einer ihrer besten Leistungen verführt, nur indem er ihr den Tip gab, doch mal eine schwarze Perücke zu tragen.
Alle Kunst arbeitet doch mit der nachvollziehbaren Bewältigung von Aufgaben. Darum ist überall dort, wo ein Schauspieler eine Rolle kriegt, die ihm nicht auf den Leib geschrieben ist, im Prinzip mal eine interessantere Interpretation zu erwarten, als wo ihn eine Gesichtsdeformation oder eine ganz bestimmte Halslänge für eine Rolle prädestiniert. Wirklich große Regisseure wie Erich von Stroheim haben für ganz ernste, außerordentlich tragische Rollen etwa in Greed (1923) Schauspieler wie Za Su Pitts genommen, die bis dahin nur komische Rollen spielten. Das waren Leute, die vom Vaudeville kamen, vom Revuetheater. Ich glaube auch, daß das Umgekehrte manchmal nicht schlecht wäre. Bei Bruno Ganz etwa, der im Film immer so ein Seelenleid vor sich herschiebt, derart auf diesen Mein-Gott-wie-es-mir-heute-wieder-mies- geht-Blick abonniert ist, daß - also, ich weiß nicht...!
AM Bruno Ganz sollte eigentlich nur in komischen Rollen eingesetzt werden.
FK Ah, das glaubst du also auch! Ein bißchen Ahnung hat man davon bekommen, nicht wahr, als er vor kurzem in einer Fernsehserie als Detektiv nach einem Stoff von Martin Walser auftrat, wo er tatsächlich eine etwas komische Figur spielte und der Mann plötzlich aufzublühen begann.
Ich glaube, daß diese Tendenz, die immer stärker wird - die Castingbüros überschwemmen mittlerweilen auch Europa -, ganz fatal ist. Selbstverständlich hängt sie mit der Ideologie des Nicht-Spielens zusammen, denn wenn jemand nicht spielt oder nur kurz da ist, muß man ihn durch etwas anderes charakterisieren als durch Darstellungskunst, etwa durch fliehendes oder besonders ausgeprägte Tränensäcke. Wer gegen den Typ besetzt wird, ist allein schon dadurch gezwungen, statt seine Physiologie spazieren zu führen, sich etwas einfallen zu lassen. In dem Film, den ich sonst nicht besonders schätze, Anna Göldin (1991) von Gertrud Pinkus, gibt es eine Szene mit Dimitri, in der er, der sonst im Film wenig überzeugt, weil er leider versucht, naturalistisch zu spielen, was nun wirklich sein Bier nicht ist, vor ein Gericht geholt und gefragt wird, ob er derjenige war, der einen verzauberten Kuchen gebacken habe, wodurch ein Kind krank geworden war. Dimitri spielt diese Szene als Clownnummer und sagt: „Na klar hab’ ich das gemacht.“ Er nimmt dieses Inquisitionstribunal nicht ernst, läßt nichts spüren von der Lebensgefahr, in der er schwebt. Er macht daraus, durch Grimassen und Gesten, eine sehr lustige und flotte Nummer und spielt vor, wie er das mit dem Kuchen gemacht hat und liefert sich natürlich dadurch erst recht ans Messer. Indem die Gefahr nicht auf das Spiel abfärbt, diese dem Zuschauer aber selbstverständlich gegenwärtig ist, wird die Szene in ihrem Flunkern auf schwarzem Grund sozusagen zu einem richtigen Bijou. Da wurde nicht nur gegen den Typ besetzt, sondern auch kühn gegen die dramaturgische Anlage der Szene gespielt.
AM Aber sollte schauspielerische Kreativität, so wie du sie an verschiedenen Beispielen beschrieben hast, nicht notwendigerweise durch filmische Kreativität des Regisseurs reflektiert werden?
FK Die schauspielerische Invention und die filmische Invention bedingen sich gegenseitig, sollten es zumindest. Ich habe es immer als ein schmerzliches Manko empfunden, daß in den Filmen von Sergej Eisenstein den Akteuren keinerlei Gelegenheit geboten wurde, dem filmischen Einfallsreichtum des Regisseurs Paroli bieten zu können. Eine Schwäche der Filme Peter Greenaways ist, daß ein auch nicht gerade um Ideen verlegener Filmemacher mit Schauspielern offenbar nichts anzufangen weiß und sie fast wie Kulissen in seinen Werken herumschiebt. Sein „horror vacui“ in der Bilderarbeit steht in negativem Kontrast zur Leere und Attrappenhaftigkeit seiner Schauspieler. Ein John Gielgud in Prospero’s Books (1991) kann seine unbestrittenen schauspielerischen Qualitäten, nur zu einem sehr geringen Teil einbringen. Dabei wäre gerade Greenaways Manierismus, seine barocke Maschinerie auf die Lebendigkeit von Schauspielern angewiesen. Aber auch das Umgekehrte ist der Fall. Wenn eine große schauspielerische Inventivität vorhanden ist, ist es fast eine Vorbedingung, daß sie in filmische Invention eingebunden wird. Auch da wieder das Beispiel Kurosawa: In Nachtasyl oder in fast allen seinen Filmen treibt er seine Schauspieler an, schöpferisch und mutig zu sein und auch vor Maskenhaftem oder überraschenden Gesten nicht zurückzuschrecken. Denn das wird in fast allen Filmen durch kongeniale filmische Erfindungskraft aufgefangen und weitergeführt. Sobald das aber wegfällt, und das scheint jetzt in letzter Zeit bei ihm zur Regel zu werden - wie übrigens bei Kubrick auch -, wirken diese großen Gesten, diese Maskenhaftigkeit und das merkwürdig purzelnde und gauklerische Agieren, wirkt das ganze Spiel plötzlich peinlich, wie schlechtes Theater.
AM Bekanntlich werden Filme in den seltensten Fällen „chronologisch“, d. h. in der Reihenfolge der Szenen, wie sie das Drehbuch vorsieht, gedreht. Und sie werden in den seltensten Fällen in so langen Plansequenzen gedreht, daß Entwicklungen innerhalb einer Einstellung oder für den Schauspieler in Realzeit möglich sind. Filme werden vielmehr in äußerster Diskontinuität gedreht und müssen dann wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Welchen Einfluß hat das auf die schauspielerische Arbeit?
FK Leider wird Diskontinuität als etwas Negatives empfunden, das vertuscht werden muß. Es widerspricht eben zutiefst der vom Mainstreamkino getragenen Ideologie der mit sich selbst identischen Rolle, wonach jemand einen bestimmten, in sich geschlossenen Charakter darzustellen hat. Aber eigentlich ist das nicht Sache des Films, sondern wenn schon des Theaters. Der Film hat dank seiner Produktionstechnik die Möglichkeit, Menschen so zu zeigen, wie sie wirklich sind, d. h. überhaupt nicht ununterbrochen mit sich selbst identisch. Die große Chance des Films bestünde darin, die Ideologie der geschlossenen und damit auch gepanzerten Persönlichkeit aufzubrechen. In einer Halbtotalen in Orphans of the Storm klagt Lillian Gish Danton ihr Leid, daß sie ihre Schwester verloren hat, und Danton beruhigt sie und ist ganz väterlich zu ihr. Dann gibt es einen Zwischenschnitt auf Danton in einer Halbnahen, die dem völlig widerspricht. Er hat die Augen ein bißchen zugekniffen und den Mund gespitzt und drückt auf einmal etwas Lauerndes aus. Dann wird wieder zurückgeschnitten in die Totale, wo er eben weiter väterliche Ruhe ausstrahlt. Das ist natürlich ein klassischer Anschlußfehler. Der Charakter wird nicht konsequent entfaltet, die Väterlichkeit geht in der Nahaufnahme flöten. Aber gerade dadurch wird der Charakter von Danton erst interessant. Es entstehen so zwei Ansichten der gleichen Person, eine öffentliche und eine private (eine Totale ist immer sozialer als eine Großaufnahme, welche die Person isoliert). In der Totalen spielt er dem Mädchen gegenüber, das allein und hilflos ist, den väterlichen Beschützer, aber dann geht die Kamera näher heran und zeigt die lüsterne Absicht. Das wird zwar im Film nicht weiter verfolgt, weil es bestimmt wie eine Panne reingeriet. Aber das macht zunächst nichts. Für einen Augenblick bekommst du die Zwiebel geschält. Solche Diskontinuitäten eröffnen der Schauspielerei ganz und gar filmische Landstriche. Es ist erstaunlich, wie gerade in den produktionstechnischen Grundlagen des Films noch darstellerisches Brachland versteckt liegt. Es sollte vielleicht endlich mal beackert werden.
AM Offenbar ist das, was im Laufe der Zeit dem Film als nicht dazugehörig ausgetrieben wurde, seine eigentliche Potenz, die auch dem Schauspieler den Rücken stärken könnte, um Neuland zu betreten.
FK Wenn auch sehr primitiv und auf der Ebenen einer bloßen Maskerade taucht in vielen Musikvideos der letzten Zeit allerdings ein Menschenbild auf, wo die übliche Vereinheitlichung der Person nicht länger bedient wird. Du kennst diese Dinger sicher, wo die Sänger, ohne daß sich das auch nur im Geringsten auf deren Gesang auswirken würde, in einer bunten Vielfalt von Aufmachungen, Orten und Situationen herumpurzeln. Die Musik und eine oft raffinierte Verwendung von Bewegungsanschlüssen sind da oft die letzten Konstanten in einem vorher aufgefächerten Identitätenleporello. Das heutige Kino fürchtet aber alles, was zu dieser Versplitterung und Vermehrung und Polyphonie der Identitäten beitragen könnte, die der Film im Grunde braucht wie der Fisch das Wasser.
AM Wir sollten vielleicht auf die Versuche von Straub und Godard in den 60er Jahren, die Brechtsche Spielweise im Film einzuführen, noch etwas eingehen.
FK Mit minimalstem Ergebnis. Bei Godard reduziert sie sich auf Illusionszerstörung (in die Kamera schauen oder nochmal ein Take machen). Der Produktionsvorgang selbst wird vorgezeigt, was im Grunde nur ein Nebenzweig der Brechtschen Verfremdung ist. Auch die Ansätze von Craig oder Artaud wurden nicht am Film ausprobiert, und dort, wo sie ausprobiert wurden, wie durch Artaud selbst in Napoléon (1925-27) von Abel Gance, sind die Ergebnisse so erschreckend, daß nur die Aura um die Artaudsche Figur die Szene halbwegs erträglich macht. Als Schauspiel wirkt das derart unangenehm forciert, daß sie weiter keinen Eingang im Film gefunden haben.
Aber es gibt eine Theatermethode, die tatsächlich ein zukunftsträchtiger Gegenentwurf zu Stanislawskys Methode wäre, das ist das Theater von Wsewolod Meyerhold, der in den 20er Jahren in der Sowjetunion die sogenannte Biomechanik entwickelt hat. Aus dieser Schule kommen zwei große Filmregisseure, Grigori Kosinzew und Leonid Trauberg, die 1922 in Leningrad die „Fabrik des exzentrischen Schauspielers“, die FEKS, gegründet haben. Zunächst machten sie Theaterproduktionen, später produzierten sie, als Kollektiv, Filme. Die FEKS verfügte über eine feste Gruppe von Schauspielern, mit denen kontinuierlich nach einer präzisen und ausformulierten Methode trainiert wurde. Die Methode ging von der „exzentrischen Geste“ aus. Diese exzentrische Geste und die ganze FEKS-Bewegung hat sich weniger vom Theater her entwickelt als vom amerikanischen Slapstick und dem frühen Detektivfilm.