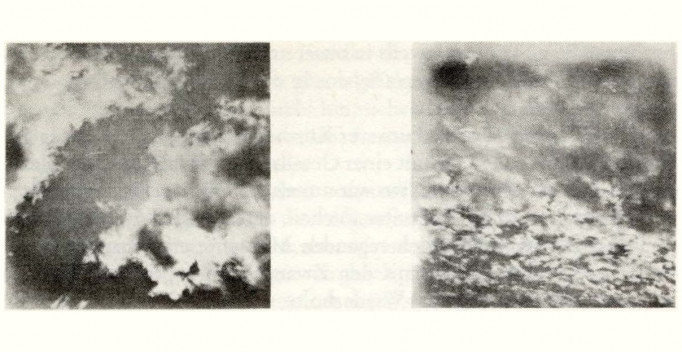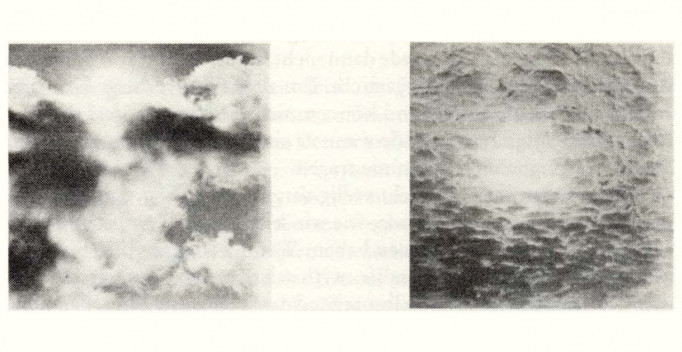Dank an Jean Luc Godard
Das Gesehene ist das von mir selbst Gesehene. Das Gehörte ist das von mir selbst Gehörte. Das Einzusehende ist das von mir selbst Einzusehende. Wir selbst Sehenden müssen uns selbst sehend behaupten und beweisen, nicht nur darin, dass wir das zu Sehende für den Sehenden nachprüfbar darstellen. Wir müssen uns sehend nicht nur im Gesehenen beweisen. Wir finden uns auch selbst sehend unter selbst Sehenden zu vertreten und durch unser eigenes Sehen in der Gesellschaft derer, die das auch zu tun finden, einzustehen.
Das Gesehene ist also nicht einfach das Wirkliche, das in der Gesellschaft von uns für sich selbst zeugt. Es bedarf des selbst sehenden Zeugen in der Gesellschaft von uns. Wir müssen uns immer wieder selbst sehend beweisen unter solchen, die das zu tun finden, die einmal zum ersten Mal das zu tun gefunden haben. Anders gewinnt auch der Augenschein keine gesellschaftliche Realität. Es zeigt sich uns Heutigen, dass wir an die Wirklichkeit oder an unser Sehen, an unsere sehende Substanz nicht einfach glauben können. Denn wir behaupten uns selbst sehend verschieden, und zwar unter solchen, die das tun, und solchen, die das nicht tun, die nur in Ritualen von selbst Sehenden, im blinden Agieren von Sehtraditionen uns behaupten.
Unsere Gesellschaft und ihre Institutionen sind der Art, dass sie darauf angewiesen sind, dass wir selbst Sehenden in der Tat hier und heute selbst sehen und dieses eigene Sehen unter solchen behaupten und beweisen, die es ihrerseits selbst zu behaupten finden. Dies darum, weil wir uns in dem Offenbaren der unvermittelten Gesellschaft von uns finden, in der wir mit einem Herrschenden, einem von uns gemeinsam anerkannten Glauben nicht mehr rechnen können. Wir können also auch nicht mehr darauf rechnen, dass wir Sehende sind, dass wir im Glauben an unsere Subjektivität als Sehende das Unvermittelte unserer Gesellschaft vermittelt glauben können. Es zeigt sich, wir finden diese Autorität nicht anerkannt. Wir können nicht darauf hoffen, dass wir irgendwann werden einklagen können, dass jeder von uns die Autorität des selbst Sehenden anerkennt. Gerade, wo wir selbst sehen in der Gesellschaft von uns, müssen wir anerkennen, dass wir auch nicht sehen, dass wir unserem Glauben, unserem Hörensagen vertrauen. Und das auf vielfältige Weise. Die offenbare Macht unserer gesellschaftlichen Indifferenz erlaubt uns nicht mehr, der Illusion von selbst Sehenden zu vertrauen, dass sich das Gesehene der Wirklichkeit einfach herrschend macht, dass also die Wirklichkeit der selbst Sehenden schliesslich und letztlich einfach gelten wird. In dem Offenbaren unserer Gesellschaft behaupten wir uns verschieden in dem Unvermittelten der Wirklichkeit. Wir machen verschiedene Wirklichkeiten geltend. Die Bedürfnisse des Glaubens sind verschiedenartig. Sie decken sich nicht mit dem Bedürfnis, Offenbares als offenbar anzuerkennen.
Trotzdem zehren unsere vielfältigen, in keinem Herrschenden vermittelbaren Institutionen unserer gesellschaftlichen Behauptung von der Entschlossenheit, in der wir selbst zu sehen Entschlossenen uns selbst sehend beweisen — beweisen nicht einfach in Bezug auf das einfach Gegebene, sondern — unter solchen, die das in eigener Entschlossenheit selbst tun, selbst zu tun finden. Ohne die vielfältige, im jeweiligen Hier und Jetzt unserer Gesellschaft bewiesene Entschlossenheit von selbst Sehenden fehlt unserem gesellschaftlichen Handeln in unseren Institutionen das, woraus sie leben, worin sie ihren Bestand erhalten. Denn die Entschlossenheit der Glaubens kann dem Unvermittlten dieser pluralistischen Gesellschaft von uns keine Gewähr geben. Trotzdem können wir nicht glauben, der vielfältige Glaube von uns liesse sich am Ende von uns selbst Sehenden einfach verbieten. Wir unterschätzen dann, wie vielfältig wir auch auf diesen vielfältigen Glauben angewiesen sind, auch wenn wir dann und wann uns selbst sehend beweisen. Nur der Glaube hilft nicht, die Indifferenz der Gesellschaft von uns zu bewältigen. Wir bedürfen der verschiedenen Entschlossenheiten von selbst Sehenden, die uns selbst sehend beweisen unter ebensolchen, denn nur durch sie wird sich das vielfältig Unvermittelte der Gesellschaft von uns anerkennen lassen. Nur sie erspart uns die vielen Kriege, die wir in der Illusion, wir könnten den jeweiligen Glauben in der Gesellschaft von uns herrschend machen, führen müssen.
Unsere Gesellschaft ist wie jede andere davon bedroht, dass die ihr Gewähr gebende Entschlossenheit, die Entschlossenheit der Anerkennung von Verschiedenheit, in ihrer Wiederholung verlorengeht und sie sich selbst nicht mehr versteht. Aber anders als dort, wo eine Entschlossenheit von uns herrscht, wo das Vertrauen in ein Herrschendes, einen Vater dieser Gesellschaft Gewähr gibt, hat die Wiederholung der uns Gewähr gebenden Entschlossenheit in der pluralistischen Gesellschaft von uns weiter reichende Folgen. Wo wir — wie in der Gesellschaft von uns Heutigen — darauf angewiesen sind, dass wir uns unvermittelt in der unvermittelten, vielfältigen Gesellschaft von uns entschlossen zeigen, hat das Vertrauen in das Gegebene eines Seins von uns — und dies ein Sein von uns Sehenden — irritierendere Folgen für unsere gesellschaftliche Behauptung.
Wo in einer Gesellschaft der Anspruch von selbst Sehenden behauptet wird und dieser Anspruch unvermittelt unter solchen behauptet wird, die ihn unvermittelt behaupten und nicht behaupten, sind wir in der unvermittelbaren Gesellschaft von uns darauf angeweisen, dass wir zu diesem Anspruch stehen und uns in der Tat selbst sehend beweisen unter solchen, die das im jeweils unvermittelten Hier und Jetzt dieser Gesellschaft tun. Aber das heisst nicht, dass wir — selbst sehend — nicht auch lernen müssten, die Rituale der Wiederholung zu meistern. Statt selbst zu sehen, selbst zu hören und selbst zu verstehen, geraten wir in die Lage, dass wir bloss die Gewohnheiten von selbst Sehenden agieren. Wir werden Agenten von Ritualen des selbstständigen Sehens und terrorisieren in der Behauptung dieser ritualisierten Traditionen unsere Entschlossenheit selbst zu sehen und das sich offenbar Zeigende selbst zur Kenntnis zu nehmen unter solchen, die das selbst und unvermittelt zu tun finden.
Wo wir aber in einer pluralistischen Gesellschaft den Anspruch unvermittelt erheben, selbst zu sehen, können wir das nur als solche unter solchen tun, also als solche, die das unvermittelt selbst tun, und sich darin unter ebensolchen beweisen müssen. Wir können nicht einfach aufhören, uns derart unvermittelt zu beweisen, wir können das auch nicht zugunsten eines Glaubens an das Gegebene des sehenden Subjekts. Der Glaube an das Gegebene der Subjektivität, des Sehenden von uns Sehenden, kann uns nicht ersparen, dass wir selbst sehen und uns selbst sehend zeigen, beweisen und darstellen müssen unter ebensolchen. In der Folge ergibt sich uns daraus, dass wir auch das Unvermittelte der Gesellschaft von selbst Sehenden, von selbst unser Sehen Behauptenden — und nicht Behauptenden — anerkennen. Wir können in dieser Gesellschaft nicht aus der einmal für uns selbst übernommenen Verantwortung aussteigen. Wir können das auch nicht so, dass wir glauben, dass sich die Eigenverantwortlichkeit der Subjekte gegeben zeige und diese Subjektivität unserer selbst das Unvermittelte der Gesellschaft von uns schon vermitteln werde.
Es gehört also zur Eigenart unserer gesellschaftlichen Kultur, dass wir selbst Sehenden uns als selbst sehend unter ebensolchen zu beweisen finden. Dass wir uns so darzustellen finden, uns so darstellen können und so darstellen müssen. Wir finden in unserer Gesellschaft geltend zu machen und geltend zu erhalten, dass wir selbst sehenden und selbst hörenden Subjekte selbst sehen und hören. Wir geben uns so den Grund, uns wechselseitig achten zu können, so aber auch achten zu müssen. Wo wir uns selbst sehend beweisen unter solchen, die das tun und nicht tun, findet unser in seinen vielfältigen Zwecken gleich gültiges Handeln an diesem unserem Beweis unserer selbst einen konkreten Grund und eine konkrete Grenze seines Handelns. Weil wir einander brauchen als selbst Sehende, jegliches selbst Verstehende hat unser Handeln einen letzten Zweck darin, uns in dieser Fähigkeit achten zu lernen. Denn wir können uns in dieser Fähigkeit nicht zum Mittel oder Werkzeug unseres Handelns machen wollen.
Je nachdem wie entwickelt unsere gesellschaftliche Kultur ist, zeigen wir uns mehr oder minder fähig, uns so zu achten. Und das nicht erst seit heute.
Zunächst und zu Anfang zeigen wir uns allenfalls fähig, die Subjektivität von uns selbst Sehenden so zu achten, dass wir eine mythisch hingenommene Wirklichkeit des von uns Gesehenen achten. Wir glauben an das von uns selbst Erzählte als an ein erzählbar Gegebenes. Wir achten das von uns selbst Gesehene, das zu Sehende, das von uns als das zu Sehende Gezeigte. Wir achten noch nicht diese unsere gesellschaftliche Kapazität, das von uns selbst Gesehene selbst zu sehen und uns selbst zu zeigen. Wir nehmen das von uns Gezeigte als das An-sich der sich uns beweisenden Götter. Wir bilden Götter ab, erzählen das von ihnen zu Erzählende. Wir tun das mit Hilfe des von uns Gesehenen und tun das als selbst diese Götter Abbildende. Aber was wir dabei achten, ist zunächst nur dies, dass sie unsere Götter sind und dass Götter sind, nicht dies, dass wir sie uns so zeigen, wie wir sie uns selbst zeigen müssen.
Wo wir etwa einen gekreuzigten Christus einmal zum ersten Mal gebildet haben und dieses von uns selbst Gebildete in der Gesellschaft von uns seinen nicht zu verkennenden Ort darum erhält, weil wir ihn uns selbst gezeigt haben, ist von uns allerdings sichergestellt, dass wir den leidenden Menschen sehen, dass wir ihn auch in unserem Herrschen über uns nicht übersehen machen können.
Aber nicht die Bedeutung des Abbildes, des Abgebildeten, macht die letzte gesellschaftliche Bedeutung der Darstellung aus, sondern schliesslich dies, dass darin derjenige unverkennbar wird, der uns das von uns Sehende zeigt, der Autor der Abbildung ist, der so abbildend uns einen Beweis dafür gibt, dass wir uns das Gezeigte gezeigt sein lassen. Das also wir selbst Sehenden uns das von uns selbst zu Sehende zeigen. Nur weil wir selbst sehen, können wir selbst Gesehenes abbilden und als Abbild, als Bild verstehen und gebrauchen. Wo wir Bilder von uns als Bilder in Gebrauch nehmen, beweisen wir unsere Fähigkeit uns als selbst Sehende, als Autoren unseres Sehens zu achten. Auch dann, wenn wir uns daneben auf die Bedeutung des Gesehenen unvermittelt beziehen und so davon absehen, dass wir selbst Sehenden uns selbst Sehenden ein selbst zu Sehendes gezeigt haben. Wo wir den Gekreuzigten abbilden, lässt es sich nicht verhindern, dass dieser Gekreuzigte abgesehen davon, dass er der von uns unter uns Gekreuzigte und von uns so Gezeigte ist, als „Gott“ für die Zwecke unserer privaten Herrschaft nutzen. Aber ganz vergessen machen können wir in diesem Gebrauch nicht mehr, dass dieser Gott eben der so abgebildete, der gekreuzigte „Gott“ ist.
Wo wir uns als selbst Sehende achten in der Gesellschaft von selbst Sehenden, tun wir das in dem Mass, wie wir der Behauptung von uns selbst Sehenden Raum geben. Wir tun das, wo wir die Darstellung von Subjekten dieser Darstellung, von Autoren als solche Darstellung von Autoren achten und uns das von ihnen Gezeigte so gezeigt sein lassen, dass wir selbst zur Kenntnis nehmen, worauf die Darstellung uns selbst Sehende weist.
Aber nicht überall, wo wir Gebilde, Darstellungen benutzen, gebrauchen wir sie als Darstellungen von Autoren dieses Darstellens so, dass wir uns das Gezeigte gezeigt sein lassen. Wir können die Darstellung anstarren, sie verehren oder als zu diesem oder jenem nützlichen Mittel für einen Zweck benutzen. Wir können vergessen, dass die Bilder Bilder sind, und dass sie als solche Beweise von Autoren sind, die, selbst sehend, uns selbst Sehenden das zu Sehende zeigen. Wir müssen jeweils selbst Gebrauch machen von dem Bild und finden uns darin zu beweisen. Wo wir es anders tun, kommen wir nicht umhin unsere Beschränktheit ebenso beweisen zu müssen, sie uns also kenntlich zu machen. Es bedarf für den selbst Sehenden keiner Kritik dessen, dass ein Bild schliesslich und endlich keine Kapitalanlage ist. Wir selbst Sehenden müssen uns nur durch den Beweis unseres eigenen Sehens dagegen wehren, dass uns die Bilder zu ihrer Nutzung entzogen werden.
Wenn wir Heutigen in die Lage kommen, zu vergessen, dass wir selbst sehen, dass das Gesehene nur das von uns selbst Gesehene ist und wir in unserem Darstellen nur uns selbst Sehenden das von uns selbst zu Sehende zeigen können, so liegt das nicht an einer Macht, die uns als Mittel zur Behauptung ihrer eigenen privaten Macht ausbeuten könnte. Eine zielbewusst und erfolgreich sich in ihren privaten Zwecken in der Gesellschaft von uns verwirklichende Macht kann sich in dem Unvermittelten unserer Gesellschaft, in ihrer offenbaren Indifferenz nicht mehr erfolgreich verwirklichen. Sie bedürfte dazu einer Ideologie, die uns in dem Unvermittelten von uns nicht mehr erreicht, sich in der Indifferenz von uns nicht mehr herrschend beweisen kann.
Wenn wir Heutigen also in die Lage kommen, uns als selbst Sehende nicht mehr zu achten und anzuerkennen, so liegt das nur an der Gekränktheit unserer Entschlossenheit selbst zu sehen. Wir möchten nicht selbst sehen unter selbst Sehenden. Wir möchten an die Subjektivität von uns selbst Sehenden glauben. Wir finden uns in diesem Glauben gekränkt, weil wir erfahren müssen, dieser Subjektivität von uns lässt sich verschieden und gleich gültig glauben. Wir können entsprechend nur verschieden und gleich gültig im Namen dieser Subjektivität Herrschaft beanspruchen und finden uns in der Folge in diesem Anspruch immer wieder gekränkt. Dass wir selbst sehen und uns selbst sehend beweisen unter ebensolchen, kann niemand hindern. Wir finden uns allenfalls angewiesen darauf, dass wir selbst Sehenden uns darauf verständigen, dass wir selbst sehen unter selbst Sehenden, dass wir unserem eigenen Sehen nicht vorgreifen können dadurch, dass wir das im Interesse von uns selbst Sehenden zu Tuende befehlen. Wir finden also anzuerkennen, dass wir in dem Unvermittelten der Gesellschaft von uns Heutigen darauf angewiesen sind, dass wir uns in der Tat selbst sehend behaupten unter ebensolchen, dass wir uns also auch in dieser Angewiesenheit aufeinander, auf die unvermittelbare Selbstständigkeit von uns achten müssen. Wir schulden nicht einem Glauben an die Subjektivität von uns diese Achtung, sondern nur der Entschlossenheit, uns selbst sehend zu beweisen. Allem anderen muss und kann unsere Nichtachtung gelten. Es kann niemandem von uns nützen, wenn wir dort, wo wir sehen müssen, wo wir selbst uns sehend beweisen müssen, glauben. Wir schulden also auch dem Glauben durchaus keine Achtung, wir schulden sie dem anderen nur insofern, als er sich in diesem Glauben immerhin auch selbst sehend beweist. Es ist ein Unding, wenn wir dem, der eine nichtige und sich selbst täuschende, illusionäre und vergebliche Herrschaft über uns behaupten will, in diesem Wahn zu achten versuchen. Er zeigt auf diese Weise nichts, das wir achten können. Wir liefern uns so nur der Unentschlossenheit, für uns selbst einzustehen, aus.
Wo wir in der Gesellschaft von uns durchaus verschieden darstellen, verschieden sehen — also nicht nur Verschiedenes sehen, und nicht nur als Verschiedene sehen, als Verschiedene, denen wir ein Subjekt dieses Sehens unterstellen könnten — in der Gesellschaft, in der wir also arbeitsteilig sehen, arbeitsteilig das zu Sehende darstellen und jedes eigene Sehen von uns gebraucht wird, reicht es nicht mehr hin, dass wir in unserem Sehen eine Subjektivität von Sehenden achten. Wir finden in der Gesellschaft von uns nicht diese Subjektivität zu achten, wir finden die Entschlossenheit unseres jeweils selbständigen Sehens zu achten. Und in ihr nicht so etwas wie die Originalität, die Gottebenbildlichkeit des Subjektes. Wir finden uns in unserer jeweiligen Entschlossenheit unseres eigenen Sehens zu achten unter solchen, die uns so zu achten finden. Wir geraten anders in die Lage, dass wir die Darstellungen unseres vielfältigen Sehens nicht mehr als die Darstellungen unseres Sehens gebrauchen. Wir nehmen sie stattdessen als Beweise eines in ihnen verschieden und gleich gültig sich behauptenden Subjekts. Weil wir in der unvermittelten Gesellschaft von uns anzuerkennen finden, dass wir uns verschieden darstellen, dass wir uns also Verschiedenes zu zeigen finden und sich uns dieses — wie selbstverständlich — weder in einen Begriff des zu Zeigenden, noch in einen Begriff des Zeigenden selbst vermittelt, möchten wir vergeblich meinen, wir könnten uns die Darstellungen von uns uns nicht mehr als Darstellungen von uns gezeigt sein lassen müssen. Wir werden in jeder Beziehung gleichgültig. Wir starren allenfalls die Darstellung an, um sie im nächsten Moment wieder zu vergessen. Wir lassen uns nicht mehr gezeigt sein, was uns gezeigt sein wird und finden keine Gelegenheit, das Gezeigte ruhig zu erwägen.
Wir finden uns zwar genötigt, die Macht dessen zu anerkennen, der sich in dem selbst Gesehenen selbst sehend behauptet und beweist. Er zeigt sich „stärker“ als der, der sich in etwas behauptet, das er nur vom Hörensagen kennt, der dafür nicht in eigener Darstellung einzustehen vermag. Da wir aber in dem Verschiedenen Zeigen uns glauben nicht anerkennen zu müssen, erklären wir die Macht seiner Behauptung kurzerhand als die Macht blosser Behauptung seiner Macht. Wir fügen uns dieser Macht so gleich gültig wie jeder das blosse Hier und Jetzt ihrer unbegreiflichen Macht behauptenden Macht. Wir gehorchen so dem ritualisierten Hier und Jetzt unserer Gesellschaft, in dem uns nicht als dieses je und je ritualisierte Hier und Jetzt sich zu bekunden scheint. Wir finden jede Entschlossenheit, sei dies die Entschlossenheit eines Glaubens, eines Darstellens oder auch nur die Entschlossenheit zur Behauptung unserer Behauptung in diesem ritualisierten Hier und Jetzt zermahlen.
Da wir unserer verschieden sehenden Subjektivität verschieden und gleich gültig gedacht finden, glauben wir uns überhaupt nicht mehr achten zu dürfen und finden diese Nichtachtung vergeblich herrschend zu machen.
In dieser Lage von uns, bedürfen wir mehr als irgend eine vergangene Modernität der aktuellen Kunst, die uns gelassen zeigt, wie wir uns in der Gesellschaft von uns zu zeigen finden.
Niemand von uns kann uns nötigen, nicht selbst zu sehen und selbst zu hören. Aber auch niemand kann uns zwingen, ruhig und gelassen zu vernehmen und das Vernommene gelassen und ruhig zu erwägen. Weder das Schicksal, noch der Geist, noch der Vater oder sein Feind, waltet in uns, wenn wir uns etwas zeigen und uns dieses Gezeigte gezeigt sein lassen. Nur als verängstigte Erben, als die Tradition bloss Wiederholenden, als ohne ein vernehmendes Verhältnis zu dem gleich Gültigen dieser Traditionen, glauben wir jeweils, es sei Gott, der Geist oder der Vater, der uns das zu Sehende als zu sehen zeigen könnte. Umgekehrt, auch von Gott haben wir selbst Sehenden geredet, um uns in ihm das von uns selbst zu Sehende zu zeigen.
Das Gesehene ist das von uns selbst Gesehene, das Gehörte ist das von uns selbst Gehörte. Das zu Verstehende ist das von uns selbst zu Verstehende. Wir müssen uns darum in dem von uns selbst Gesehenen, in dem von uns selbst Verstandenen darstellen unter solchen, die das eigens tun müssen. In dieser Darstellung zeigen wir uns das von uns selbst zu Sehende, damit wir es selbst sehen und uns jeweils eigens in ihm darzustellen lernen. Unsere Gesellschaft ist die Begegnung der so selbstständig uns Darstellenden, ihr wechselseitiger Austausch. Sie ist nicht die Darstellung von solchen, die Subjekte sind und sich nun ausserdem noch in einem An-sich der Gesellschaft wie in einem Raum oder Gott finden könnten. Wir sind nicht, wir stellen uns dar, unter solchen, die uns darstellen. Das ist von uns Heutigen nicht mehr zu verkennen, weil offenbar ist, dass unsere Darstellungen verschiedene und gleich gültige Darstellungen von uns sind, in denen wir uns im gesellschaftlichen Verkehr anzuerkennen lernen müssen. Wir können nur vergeblich darauf warten, dass ich schliesslich die eine Darstellung von uns als die Heimat aller anderen Darstellungen erweist, dass sich in dem einen Darstellen sich uns die Verschiedenheit unseres eigenen Darstellens aufhebt.
In dieser Lage besteht allerdings für uns dauernd die Möglichkeit, dass wir uns gleich gültig in den gleich gültigen Darstellungen von uns einfach wiederholen und als Wiederholende in einem vorgeblichen So-sein von uns vergeblich Herrschaft beanspruchen. Statt uns jeweils in unserem Sehen selbst sehend zu beweisen, agieren wir die Traditionen dieses Sehens in der Prätention, wir seien das, worin wir uns jeweils bloss darstellen.
Der offenbare Zustand unserer Künste, die ungelösten Schwierigkeiten ihrer Reproduktion in die Zukunft einer Gesellschaft von uns Heutigen, machen uns offenbar, dass wir selbst dort, wo wir uns entschlossen selbst darstellen, nicht mehr verstehen, dass wir das tun unter solchen, die das tun. So verbergen sich uns die da und dort immer wieder sich regenden Momente erwachender Sensibilität. Wir decken sie immer wieder mit den Zwangshandlungen unseres Wiederholungswahns zu. Wir statuieren das Wiederholte, wie wenn wir es nicht wiederholten, wie wenn wir durch die Wiederholung das Sein von uns in dieser Wiederholung ein für allemal statuieren könnten. Wir scheinen das zu müssen, wo wir in der Gesellschaft von Wiederholenden gleichgültig gleich Gültiges zu wiederholen finden. Wo irgend einer sich verlauten lässt, uns an uns etwas Offenbares zu zeigen, verschliessen wir uns ihm mit der Bemerkung, dass es nicht das von uns Behauptete sei. Wir wiederholen die Darstellungen, in denen wir uns einmal etwas gezeigt haben, nicht um uns das Gezeigte zu zeigen, sondern um in dieser Darstellung unser Sein zu prätendieren: Wir seien Christen, Marxisten, Sehende. Fertig. Nun möge der andere zeigen, was er sei. Und dann komme es auf den Kampf an, wessen Prätention sich gegenüber der anderen durchsetze. Derjenige, der sturer, blinder und harthöriger auf seiner Behauptung beharrt, müsse sich da wohl durchsetzen. Der Gelassenere, auf seinem Zeigen Bestehende, der in seinem Darstellen nicht prätendieren kann, dass er das Dargestellte sei, dass er vielmehr nur zeige, und zwar nur insofern und so lange er zeige, muss da wohl als der Willensschwachere erscheinen, der sich im Kampf der ihr blosses Behaupten Behauptenden nicht durchzusetzen verstehe. Doch sollten die Hysteriker des Behauptungswahns bedenken, dass selbst Darwin die Evolution der lebendigen Organismen als eine Evolution der Differenzierung zu zeigen fand. Die Prämie des Ueberlebens liegt nicht auf der Behauptungstreue, sie liegt auf der Fähigkeit, Unterschiede als Unterschiede anzuerkennen. Sie wird auch dann darauf liegen, wenn wir einsam in der Gesellschaft von einsam uns Darstellenden die offenbare Indifferenz der Gesellschaft als eine Differenz unserer Darstellung in ihr anzuerkennen finden.
Das von uns selbst Gesehene ist das von uns selbst in diesem Sehen zu Sehende. Wir sind darauf angewiesen uns in diesem Sehen darzustellen, um uns mit Hilfe dieser Darstellung in der Gesellschaft von so uns Zeigenden zu erfahren. Ich sehe einsam, aber in der Gesellschaft der einsam selbst Sehenden. Ich habe kein Motiv selbst zu sehen, still für mich selbst aufmerksam zu werden, sofern ich nicht in der Gesellschaft von ebensolchen diese Aufmerksamkeit beweisen und auch jederzeit beweisen zu können hoffen kann.
In der Gesellschaft aber in der wir auch gleichgültig gleich gültige Traditionen der Darstellung unseres Sehens wiederholen können, zeigt sich das Bestreben, das in der Gesellschaft von uns Einsamen einsam Erfahrene und zu Erfahrende uns zu ersparen. Wir meinen geradezu diese Erfahrung uns ersparen zu müssen, weil wir sie dem anderen von uns, der sich in der Gesellchaft von uns ebenso erfährt, meinen, nicht zumuten zu dürfen. Weil die gleich gültigen Traditionen unserer Darstellung, in denen wir uns repetieren, nicht hinreichen, uns das zu zeigen, was wir als ihre gleichgültigen Agenten unter ebensolchen erfahren, meinen wir uns uns überhaupt nicht mehr zeigen zu können.
Wo wir Heutigen in dieser Gesellschaft von uns fähig werden wollen, dass wir in der Gesellschaft der Heutigen uns in dieser Gesellschaft der Heutigen zeigen, so müssen wir allerdings von uns verlangen, dass wir uns auch in dieser Gleichgültigkeit zeigen. Wenn wir Heutigen uns Agenten gleich gültiger Autoren unserer Darstellung finden, so finden wir uns schliesslich darin zu zeigen. Wir brauchen Darstellungsmittel, in denen wir vor der Aufgabe unsere drohende Indifferenz darzustellen nicht resignieren müssen. Wir können in diesem Bedürfnis nicht auf Traditionen von Darstellungsweisen zurückgreifen, die wir — wie die Rede geht, mit neuen zeitgenössischen Inhalten füllen. Wir werden aber ebensowenig neue „Formen“ als neue Formen suchen können, weil wir sie gleich gültig und vielfältig darin finden können, dass wir irgend ein Altes zu einem Neuen, Andersartigen verändern.
Zu den Darstellungsmitteln, in denen wir Heutigen unvermittelt uns unvermittelt in der Gesellschaft von uns Heutigen zeigen können, gehört schon lange der Film.
Wir ahnen, dass im Film Möglichkeiten liegen, die wir kaum begonnen haben, wahrzunehmen, geschweige denn auszuschöpfen. Und doch konkurrieren wir geradezu in der Zensur dieser Möglichkeiten. Die Nutzung des Films in seinen offenbaren Möglichkeiten leidet daran, dass wir mit seiner Hilfe zunächst die Tradition der Avantgarde, die Tradition der Modernität meinten einfach wiederholen zu können. Wir haben gemeint, mit Hilfe des Films wieder einmal „moderne Kunst“ produzieren zu müssen, das heisst, alte Traditionen revolutionieren zu sollen. In dem Mass wie die wiederholte Wiederholung des Revolutionären zum Modischen entartet, haben sich die Filmautoren darauf besonnen, alten Darstellungstraditionen Massenwirkung zu verschaffen. Der Film scheint als Mittel tauglich, alte mythische Herrschaftstraditionen wiederholbar zu erhalten. Im Kino und im Fernsehen lassen sich die alten Mythen mit dem Stoff unseres Alltags füllen. Die Propagandisten einer „Gesellschaftsordnung“ und einer geordneten Gesellschaft konnten glauben, mit Hilfe des Kinos und des Fernsehens im sogenannten Bewusstsein der Massen die Wirklichkeit zu erzeugen, die ihre Herrschaftsideologie zu antworten fähig war. Es würde sich zeigen lassen, dass diese Hoffnung vergeblich war, dass die Erfahrenheit im Konsum des Films auch den einfältigsten Zeitgenossen nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass eine im Film mythisch inszenierte Wirklichkeit eben eine Kinowirklichkeit ist, die ihren Illusionscharakter gerade dem offenbart, der zu ihm seine Zuflucht nimmt. Das Kino veraltet schnell, so schnell wie eine gerade heute aktuelle Mode.
Im Film haben wir die Möglichkeit, dass wir in der Gesellschaft der Heutigen uns in der Gesellschaft der Heutigen so zeigen, dass wir das Unvermittelte von uns nicht zu leugnen gezwungen sind.
Das Gesehene ist das von mir selbst Gesehene, das Gehörte ist das von mir selbst Gehörte, das Eingesehene ist das von mir selbst Eingesehene, insofern ich mich jeweils selbst darzustellen finde unter solchen, die das selbst tun. Im Film können wir uns so zeigen,
Ich sehe den Himmel, das blühende Rapsfeld, das schmutzige Treppenhaus, die Autostrasse im Wochenendverkehr. Der Himmel, die Autostrasse ist jeweils dieses von mir selbst gesehen. Der Film kann das zeigen. Aber er zeigt nicht nur den Himmel, in den mich verlierend, ich sehe. Er zeigt auch, dass und wie jeweils ich ihn sehe. Er zeigt, dass und wie ich ihn sehe in Gesellschaft mit jenen anderen, die ihn wie ich, selbst sehen. Der Film zeigt also das von mir selbst Gesehene so, dass ich mich ganz in das selbst Gesehene verloren zeige. Er zeigt mich Sehenden in der Gesellschaft von ihn selbst Sehenden und nicht Sehenden, wie wir ihn in Gesellschaft von unseresgleichen sehen können und nicht sehen können. Im Film können wir uns — wie in keinem anderen Medium so zeigen und zugleich uns das zu Verstehende dessen dringlich zeigen, dass wir das jeweilige selbst sehen und nicht sehen in der unvermittelten Gesellschaft von ebensolchen.
Filmend können wir uns den Himmel zeigen und zugleich das damit nicht Vermittelbare, dass wir ihn uns in Gesellschaft von uns so Zeigenden zeigen. Eine Rede von uns ist dazu nicht fähig, auch nicht ein Drama, also eine Darstellung in der wir uns in den Konflikten von Redenden zeigen können. Dort können wir uns wohl zeigen, dass wir in Gesellschaft von uns, dies und jenes tun. Wir sind aber, in solchem Konflikt von Redenden uns zeigend, nicht imstande auch nur zur Kenntnis zu nehmen, dass wir sehen, und dass wir in Gesellschaft von selbst Sehenden selbst sehen. Wo wir das können und auch zur Kenntnis nehmen müssen, finden wir die Konflikte von uns nicht mehr den letzten Horizont unseres Handelns. Wir erfahren uns diese Konflikte agierend, in der gesellschaftlichen Indifferenz von uns. Wir offenbaren uns in ihr. Der Film kann das zeigen. Das Drama nicht. Wo die beziehungslos Redenden beziehungslos reden, hört der Konflikt auf. Aber damit hört nicht die Gesellschaft auf. Sie fängt erst an als die Gesellschaft von uns offenbar zu werden. Im Film sind wir nicht darauf angewiesen, das Gesellschaftliche von uns an den Konflikt, der ein Konflikt von Redenden ist, zu binden. Wir finden die Gesellschaft von uns selbst Sehenden nicht als Beziehungslosigkeit denunziert. Der Film kann uns in der Indifferenz der Gesellschaft von uns gelassen zeigen, er kann uns das Offenbare dieses Erstaunlichen zu erwägen geben. Zeigen wir in der Indifferenz von uns Heutigen uns in dieser Indifferenz im Film, so finden wir uns nicht gezwungen, uns als scheiternde Helden oder als scheiternde Subjekte in der Gesellschaft von so Scheiternden zu zeigen. Wenn wir Heutigen uns so zeigen, so liegt das daran, dass wir uns in der Wiederholung der mythischen, der epischen oder ironischen Form der Gesellschaft von uns Heutigen nähern. Diese Darstellungen sind nicht geeignet, dass wir Heutigen in ihnen uns Heutige zeigen. Wir können uns nicht so zeigen, dass wir von dem einen von uns erzählen, in dem wir uns beispielhaft erzählbar werden, dass er der gescheiterte Vater ist. Auch in der raffiniertesten Ironie unterstellen wir der Gesellschaft von uns eine Gesellschaft von Subjekten. Wir propagieren in der ironischen Darstellung, wenn wir die auf uns Heutige anwenden, den mythischen Helden des Bewusstseins, der in den Volten seines Verhältnisses zu sich selbst noch einmal als der erzählbare, mythische Vater der Gesellschaft von uns sich erweist.
Ironisch, sind wir unfähig, nüchtern und einfach den Sachverhalt anzuerkennen, dass wir selbst sehen in der Gesellschaft der selbst Sehenden und nicht selbst Sehenden. Wir sind, erzählend, auch strikt von uns selbst erzählend, dazu unfähig. Wir wiederholen in diesem Erzählen den Glauben, dass wir letztlich und schliesslich Subjekte sind, dass wir uns nicht nur als Subjekte darstellen unter solchen, die das auch nicht tun. Im Film sind wir nicht daran gebunden, dass wir erzählen, auch wenn die Erzählung vom Film genutzt werden mag. Im Film können wir in der offenbaren Gesellschaft von uns uns in der offenbaren Gesellschaft von uns zeigen und sind dabei doch nicht auf die dramatische Darstellungsform des Konflikts gebunden, indem wir selbst redend unter selbst Redenden unser Leiden an dem Glauben an den Vater uns gezeigt haben. Im Film müssen wir uns das mit unseren eigenen Augen zu Sehende zeigen und nicht nur den Konflikt der Redenden, der davon absieht, dass wir selbst Sehenden selbst sehen.
Aber auch im gemalten Bild und auf der Fotografie zeigen wir uns den Himmel oder die Autostrasse und allenfalls auch den dieses Jeweilige Betrachtenden, also den Mythos des Sehenden. Wir zeigen uns wo möglich auf einem Bild, dass wir sehen unvermittelt verknüpft mit dem, was wir sehen. Aber je nachdem ist die Darstellung des gemalten Bildes exponiert in der Differenz des Gesehenen oder in der Differenz des Sehenden, allenfalls gelingt es dem Maler, dass wir sein Bild in beiden Weisen zeigend gebrauchen können. Das gemalte Bild hat nicht Raum für die Exposition verschiedener Differenzierungen von uns. Ihm ist insofern der offenbare gesellschaftliche Raum von uns verschlossen, also dies, dass wir in der Gesellschaft von uns uns verschieden und gleich gültig darstellen unter solchen, die das hier und heute tun. Das Bild abstrahiert von dem Verschiedenen der Unterschiede, die die offenbare Gesellschaft der verschieden Unterscheidenden ist. Der Film braucht das prinzipiell nicht. Wenn der Autor des Films sich an die Exposition einer Differenz von uns bindet, so muss er das zeigen, ob er will oder nicht. Filmend kann ich mich zeigen in Gesellschaft von meinesgleichen, die auch sehen, auch selbst sehen, und so unter solchen ein Motiv finden, unter so Sehenden zu handeln im Verhältnis zu solchen, die dieses Motiv jeweils finden. Filmend kann und muß ich zeigen, wie ich sehend, handelnd, redend jeweils in Gesellschaft solcher selbst Sehenden, selbst Handelnden und selbst Redenden dies jeweils selbst zu tun finde.
Zeige ich den Himmel Sehenden, indem ich den Himmel fotografiere und zeige ich unvermittelt zugleich den, der den Himmel sieht, verknüpfe ich dann beides als unvermittelt verknüpft in einem Schnitt und zeige so den Sehenden zugleich als unvermittelt Redenden, als mit sich selbst und anderen Redenden Redenden und Schweigenden, verknüpfe ich beides nach einer mich bewegenden Idee der Erfahrung von Heutigen und hat diese Erfahrung ihren in unserer Zeitgenossenschaft aufzeigbaren Grund, so filme ich und zeige mich prinzipiell fähig, das heute von uns zu Erfahrende uns Heutigen mitzuteilen. Wir Zeitgenossen finden in diesem von uns gemeinsam zu Kenntnis zu Nehmenden einen Grund uns auf uns besinnen zu müssen. Wir klagen uns Zeitgenossen unsere Zeitgenossenschaft und machen uns so einander kenntlich, wo wir ohne diese Darstellung verloren sind. Der Film gibt uns Gelegenheit, vermag uns Gelegenheit zu geben, dass wir in der Indifferenz von uns doch diese Indifferenz von uns zu bedenken vermögen, dass wir ihr nicht nur zum Opfer fallen.
Nun meinen wir gewöhnlich und zunächst, das Erstaunliche unserer Zeitgenossenschaft gar nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. Wir glauben einfach Zeitgenossen zu sein, etwa so wie wir glauben, Deutsche, Menschen, Frauen oder Christen zu sein, wo wir das zu sein glauben. Wir glauben unserer Zeitgenossenschaft einfach unsere Substanz. Wir meinen da also gar nichts zur Kenntnis nehmen zu müssen. Wir meinen eine Darstellung, die uns Gegenwärtige uns Gegenwärtigen zeigt sei überflüssig. Wir meinen ihrer garnicht zu bedürfen. Allenfalls erwarten wir in unserem jeweiligen Glauben von der Darstellung, also auch vom Film, dass sie uns im Kampf dieser Gegenwart zu einer Waffe wird, zu einem Mittel des Terrors, mit dem wir denjenigen einschüchtern, von dem wir erwarten, dass er uns ebenso einzuschüchtern entschlossen ist. Wir meinen als Christen, Menschen, Frauen, freie Subjekte jeweils zu wissen, in welchem Kampf wir die Waffe brauchen. Wir haben keine Verwendung für den, der uns uns zeigt, der das Unvermittelte von uns uns Unvermittelten zeigt. Er stört uns in der Blindheit unserer Behauptung in dieser Gesellschaft. Er verlangt allenfalls dieser Behauptung rigoros dienstbar gemacht zu werden. Indem er uns uns zeigt, uns unvermittelt Heutige uns unvermittelt Heutigen, indem er sich uns als uns uns Zeigender nötig erweist, scheint er uns unsere Behauptungsgewalt nehmen zu wollen. Er erscheint subversiv, weil er nicht auch glaubt und uns ruhig uns zeigt. Zeigt, wie wir blind und vergeblich in Gesellschaft von uns indifferent Kämpfenden blind und vergeblich kämpfen.
Die Darstellung, die der Film ist, zeigt uns uns, nicht, weil das zu tun seine Intention sein könnte. Er tut das auch unabhängig davon, ob er sich dieses Zeigen ausdrücklich zum Ziel setzt. Er tut das so selbstverständlich wie das Altarbild, das Gott abbildet, jenseits irgend einer Gelungenheit einer Absicht, bezeugt, dass Gott Mensch geworden ist.
Der Film vermag nie vollständig davon absehen zu machen, dass er uns Heutige uns Heutigen zeigt. Er kann, selbst wo er das will, nie Zeugnis unseres Glaubens werden. Andererseits kann er sich nicht dagegen wehren, als solches Zeugnis genommen zu werden, selbst dort, wo er seine ästhetischen Möglichkeiten rein ausschöpft.
Er zeigt uns selbst Sehenden uns selbst Sehende. Achten wir nicht darauf, dass wir selbst sehen, sehen wir nicht selbst, so kann uns das wenig sagen. Wir begnügen uns als Filmkonsumenten damit, das zu sehen, was unseren Glauben bestätigt und sehen von dem ab, was wir ausserdem gezeigt bekommen. Aber wir beweisen uns doch als Filmbetrachter, als solche, die sich das vom Film Gezeigte gezeigt sein lassen. Wir können es nicht anders nehmen, selbst dann, wenn wir als Fernsehkonsumenten und Betrachter der Tagesschau auch Teilnehmer eines gesellschaftlichen Rituals sind, in dem wir zum Teil davon absehen, dass wir uns uns gezeigt finden. Der Film kann sein Zeigen nicht völlig übersehbar machen. Wir bestätigen also durch unser Bertrachten des Films, dass wir selbst sehen, und zwar das, was wir uns als selbst Sehenden zeigen.
Wir können im Film auch nie völlig vergessen machen, dass wir Heutigen in ihm uns Heutige zeigen, gerade dann nicht, wenn die Illusion der mythischen Dramaturgie vollkommen gelingt nicht. Ein alter Film verbirgt nie, dass er ein alter Film ist. Wir kennen uns und können nicht verkennen, dass der heute gedrehte Film uns Heutige zeigt, gerade wenn er ein Kostümfilm ist, zeigt er uns Heutige, wie wir Heutigen diese Kostüme tragen.
Wir können im Film nicht völlig vergessen machen, dass diejenigen von uns, die wir im Film sehen, Sehende, wie wir selbst sind, die selbst sehend die Möglichkeiten von uns selbst Sehenden haben. Wenn wir sie mythisch vermittelt zeigen, müssen wir also merken, dass sie mythisch vermittelt gezeigt werden, dass die in dem Mythos Auftretenden selbst sehend das Spiel von mythischen Figuren spielen. Wir müssen ihre Augen sehen, auch da wo sie nicht blickend gefilmt werden. Sie sind uns so etwas anderes als mythisch unvermittelt handelnde Helden.
Den Film betrachtend werden wir nie davon ganz und gar überzeugt werden können, dass die im Film handelnd Gezeigten solche sind, die selbst sehen und im Verhältnis von solchen auch handeln. Wir können ihre Selbstständigkeit der Darstellung im Verhältnis von Darstellenden, die selbst sehen, nie völlig verkennen. Der Film muss darum immer für die offenbare Indifferenz unserer Gesellschaft zeugen. Dem den Film selbst Betrachtenden kann kein Film das Offenbare dieser Erfahrung verdecken, er macht, wo er es versucht, seine Vertauschungsabsicht offenbar, auch wenn der den Film selbst Sehende sich davon keine Rechenschaft abzulegen vermag. Der Film müsste dann fähig sein, uns darüber zu täuschen, dass wir den Film selbst sehen. Er kann das nur so, dass er uns auf diese seine Täuschungsabsicht aufmerksam macht.
Wenn also der Film Gebrauch macht von besonderen Mitteln der Darstellung, wenn er Geschichten mythisch vermittelt erzählt, wenn er Konflikte aus einer Solidarität mit dem Vater exponiert, so muss er doch offenbaren, das und wie er das tut.
Er zeigt uns so das Offenbare der Gesellschaft von uns Heutigen. Auch in ihr behaupten wir uns verschieden in gleich gültigen Loyalitäten unter solchen die das tun und so die Vergeblichkeit dieses Ethos beweisen müssen.
Also gerade dann, wenn ich filmend zugleich irgend eine Tradition des Darstellens, des Geschichtenerzählens, der Konfliktexposition oder der Darstellung des sich Subjekt glaubenden Subjekts wiederhole, zeige ich uns uns. Ich zeige uns als die Indifferenz der Wiederholung von uns Klagender. Ich zeige im Film uns Heutige uns Heutigen. Ich kann den Film heute gemacht, nicht den Gestorbenen zeigen. Und ich kann im Film nicht Gestorbene zeigen. Er ist nicht für sie bestimmt, sondern für die Heutigen und so allenfalls als Zeugnis von uns Heutigen für die Künftigen.
Das Ganze des Films, das ich mache, mache ich als Heutiger, der das im Film unvermittelt zu Verknüpfende als heute unvermittelt nur zu verknüpfen zeigen muß. Aber nirgendwo sonst kann ich uns Sehende zeigen, wie wir in der Gesellschaft von uns unvermittelt selbst Sehenden, das unvermittelt zu Sehende sehen, wie es in keinem Ganzen, keiner Welt, keiner Wirklichkeit, keiner Autorität des Subjekts vermittelbar sich uns Heutigen in der Gesellschaft von uns unvermittelt offenbart.
Unter den heute Filmenden ist Godard einer der wenigen, der gelassen zur Kenntnis nimmt, was wir im Film von uns zu zeigen finden. Es ist das Offenbare unserer selbstverständlichen Einsamkeit in der Gesellschaft der Einsamen, die wir nur dadurch unerträglich machen, dass wir sie meinen leugnen zu sollen. Sensibler Autor von Filmen, in denen er sich entschlossen zeigt, das zu zeigen, was die Filme von uns Heutigen von uns schliesslich zu zeigen finden, findet er sich nach jahrtausendealtem Ritual für das verantwortlich gemacht, was er bloss zeigt. Zeigt er dann den, der ihn so verantwortlich machen will in der Gesellschaft von uns, so überschlägt sich der kritische Eifer derer, die seine Genialität rühmen oder die Verwerflichkeit seines Ethos tadeln zu müssen glauben. Es fällt ihnen nicht ein, das, was sie selbst offenbar zu machen derart beitragen, dass es von ihm abzubilden wird, sich gezeigt sein zu lassen.
Das Problem für Godard ist: Wie organisiere ich das in der Entdeckung der offenbaren Indifferenz von uns Offenbare derart, dass das unvermittelte der Differenz in dieser Indifferenz von uns kenntlich wird. Wie stelle ich das Wunder dessen dar — was finde ich da anzuerkennen? — dass wir uns in dem Offenbaren unserer Indifferenz so artikuliert different zeigen?
Lange Zeit nutzte er für diese Organisation der Zeitgenosenschaft das ebenso zeitgenössische Affektritual der Herrschaftskritik. Er schrie das nicht Zusammenhängende einer Gesellschaft von uns heraus, wie wenn die Klage einen Adressaten hätte, den abwesenden Vater, der alles so gemacht habe.
Jetzt, vertrauter mit uns und selbst Vertreter einer Generation als schlecht denunzierbarer Väter organisiert er das nicht zu Vermittelnde der offenbaren Gesellschaft von uns so, dass er diese Gesellschaft als den Grund ihrer Mythen von sich offenbart. Er entdeckt so die Offenbare Gesellschaft als den unvermittelten Grund der Mythen, in deren Vielfalt sie sich geltend macht.
Die Frau, die sich selbst unbegreiflich in dem unvermittelten dieser Gesellschaft von uns Heutigen Mutter wird, das ist Maria. Maria, das war nie etwas anderes als das. Denn es war nie begreiflicher als heute, dass und wie eine Frau in dieser Gesellschaft von uns zur Entschlossenheit der Mutter findet. Wenn wir an die Mutter einfach glauben, gleich gültig gegenüber dem, was wir anderes ebenso gültig glauben, finden wir uns zu zeigen, wie unvermittelt unser Glaube an die Mutterschaft und das Werden dieser Mutterschaft in der Gesellschaft von uns zusammen gehören.
Der Film kann die unvermittelt geltenden Mythen unserer besonderen Entschlossenheit in das Unvermittlte der Gesellschaft von uns zurückholen und uns zeigen, wie wir uns in und mit unseren verschiedenen Mythen von uns in der Gesellschaft des Heute unter ebensolchen behaupten. Mit der Kamera können wir das Unvermittelte des Hier und Jetzt zeigen. Mit dem Schnitt das Unvermittelte der Hier- und Jetztmomente unvermittelt aufeinander beziehen. In der Dramaturgie des Geschnittenen Filmganzen, der Abfolge der Schnittsequenzen können wir das Unvermittelte von uns im Unvermittelten unseres gleich gültigen Glaubens unvermittelt vermittelt zeigen.
Doch es bedarf der Erfahrung in der gelassenen Beobachtung von uns, wenn wir in dieser Gesellschaft uns triftig in dem Unvermittelten von uns zu zeigen sind. Es ist nicht irgend ein Nichts der Vermittlung, in dem wir uns unvermittelt zu zeigen finden. So verkehren wir nur in vergeblicher Enttäuschung, die Mythen des Sinns in die Mythen des jeweils korrespondierenen Unsinns. Unvermittelt uns zeigend in der Gesellschaft von uns so unvermittelt uns Zeigenden, sind wir nicht einfach das Nichts unserer Vermittlung, unsere Enttäuschung, die sich befriedigt an der Behauptung ihres partikulären Unsinns labt.
Der Film kann zeigen: Wir operieren jeweils mit einem Bild von uns in der Situation von uns. Wir tun das unter solchen, die das verschieden und gleich gültig tun. Christen kämpfen wir im Namen Gottes für die Liebe. Wir sehen nicht, wie wir in der Gesellschaft von uns so Behauptenden uns so behaupten. Wir sehen nur die Entschlossenheit der Liebe. Wir sehen nicht, wie wir uns mit ihr in der Gesellschaft von uns uns so Behauptenden behaupten. Der Film kann uns das zeigen. Schon gegen die Heiden haben wir uns mit Hilfe der Unterwerfung unter den Willen Gottes, also in entschlossener Demut, herrschend behauptet. Wir haben auch nicht gemerkt, dass wir genau so taten, wie die Heiden, die sich in derselben Entschlossenheit gegen uns behauptet haben, derart, dass wir für sie die Heiden waren, die uns in der Unterwerfung unter den Gott der Liebe zu unterwerfen trachteten. In der offenbaren Indifferenz der Gesellschaft von uns müssen wir entdecken, dass wir uns immer schon in dieser Indifferenz geltend gemacht haben. Wir bemerken es erst Heute, weil wir es heute offenbar verschieden und gleich gültig tun und nur vergeblich darauf hoffen können, ein Behaupten zu finden, in dem sich uns diese Indifferenz von uns vermittelt.
Der Film muss uns das zeigen. Er kann es uns gelassen offenbaren, so dass er uns zugleich besonnen über uns aufklärt. Wenn er zeigt wie wir sehen, selbst in das Gesehene verloren, unter ebensolchen, wie wir aber zugleich und unvermittelt jeweils gesehen werden von selbst Sehenden, wenn er weiter zeigt, wie wir so selbst sehend und selbst gesehen in der Gesellschaft von solchen und so offen motiviert zu einem Handeln hier und jetzt entschlossenen handeln unter solchen, die jeweils hier und jetzt uns so entschlossen zeigen unter ebensolchen so zeigt er einen immer noch sehr vereinfachten Ausschnitt aus dem Offenbaren der Gesellschaft von uns. Das da zu Zeigende, in dem wir uns aufzuklären finden ist das weiteste Feld. Aber es sind wir in der Gesellschaft von uns so Darstellenden, die uns uns zu zeigen finden. Wir so unvermittelt Heutige, müssen nur uns unvermittelt Heutigen anzuerkennen lernen. Der Film kann uns zeigen, was wir über uns noch nicht wissen, worin wir unvermittelt als Sachverständige aber doch agieren. Wir kennen uns nur noch nicht so sachverständig mit uns. Wir meinen das Offenbare des gesellschaftlichen als dessen Agenten wir unser Behaupten behaupten nur in der Prätention einer engen Hoffnung und ihrer Enttäuschung anerkennen zu können. Der Film, in dem wir so offenbar uns so offenbar zeigen, muss nicht auf dieser Pointe des Sinns oder Unsinns bestehen. Wir können Teilnehmer des offenbaren Geheimnisses der Gesellschaft von uns uns auch das offenbare Geheimnis dieses Gesellschaftlichen von uns zumuten und zeigen, ohne die im Film funktionslose Pointe der Satire oder Ironie. Wir müssten uns dann im Film doch zeigen, wie wir diese Satire, diese Ironie in der Gesellschaft von uns derart behaupten, dass wir Teil eines im Film von uns zu Zeigenden werden.
Der vergebliche Terror der unser jeweils privates Behaupten Behauptenden muss den Filmenden nicht in der Tunlichkeit seiner Aufgabe irritieren, er kann die Kamera auf den Zensor richten und ihn in der Gesellschaft von uns zeigen, in der Gesellschaft der indifferent die Zensur Behauptenden. Filmend behält er das „letzte Wort“. Er behält die Musse der gelassenen Betrachtung, insofern er uns filmend darstellt. Er kann die indifferenten Differenzen in denen wir unser selbstständiges Behaupten selbstständig zu behaupten finden unter ebensolchen, zu erwägen suchen und uns so besonnen darstellend im Verhältnissen von Darstellenden zeigen. Er hat filmend die ruhige Gewalt des uns Vernehmenden für sich.
Nur scheint es für den einzelnen von uns schwer, an diesem Ort auszuhalten, wenn er doch ausserdem eine sein eigenes Behaupten in der Gesellschaft von uns Behauptenden bleiben muss. Er wird schliesslich nur noch der Voyeur der Leiden, die er sich in der Ausübung seines Berufes zwangsläufig zuziehen muss. Er wird schliesslich dieses Leiden zeigen und wieder die Häme derjenigen zu spüren bekommen, die nicht anzuerkennen bereit sind, dass und wie wir in der Gesellschaft von uns gezeigt bekommen. Wir lassen uns nicht leicht das Gezeigte zeigen, um es selbst zu betrachten. Noch schwerer lassen wir uns uns zeigen. Wir fänden uns dann nur noch still zu bedenken und müssten, so lange wir das nicht getan haben, in der Frenesie unserer Behauptung innehalten.