Ausstattung Unsere Augen gehen immer über die Oberfläche der Dinge. Sie bedürfen nur einiger verstreuter Punkte, und blitzartig füllen sie die Zwischenräume. Sie erahnen viel mehr, als sie sehen, und niemals, oder fast niemals, prüfen sie die Dinge. Sie geben sich mit den Erscheinungen zufrieden, und in diesen gleitet die Welt schimmernd dahin und verbirgt ihren wesentlichen Inhalt. Diese Worte des mit sieben Jahren erblindeten Jacques Lusseyrans lassen sich einordnen in den abendländischen Diskurs von Schein und Sein. Im Gegensatzpaar von „Erscheinungen“ und „wesentlichem Inhalt“, von Schein und Essenz, konstituierten sich ganze Systeme der Moral und Wahrheitsfindung. Doch nicht nur von „Glanz und Elend der Oberfläche“ ist hier die Rede. Die visuelle Kompetenz der Menschen, das Fragmentarische und Elliptische zu ergänzen, und das heißt wohl, überhaupt etwas zu sehen, ist darin ebenso angesprochen. Von dieser Kompetenz gehen Ausstatter aus. Ausstattung umfaßt filmische Dekorationen, Bauten, Kostüme und Requisiten. Ihrer Omnipotenz und -präsenz wegen neigen wir dazu, ihn zu übersehen. Daß jemand diese Oberflächen macht und gestaltet, drängt sich nur schwer in unser Bewußtsein. Die Verantwortung des Art Directors erstreckt sich zwar auf vieles: „The person on a film crew ultimately responsible for every aspect of film decor and set construction. His duties range from designing and preparing all Studio and outdoor settings to the acquisition of all properties required by the script.“ Er sei aber wahrscheinlich der am wenigsten wahrgenommene und am meisten unterschätzte Filmkünstler. Adolf Muschg beschrieb in dem 1965 erschienenen Roman Im Sommer des Hasen einen Schweizer, Paul Weigerstorfer, der für ein halbes Jahr fast ausschließlich in Tokio lebte, sich wenig von seiner Wohnung entfernte, vielmehr von früh bis spät vor dem Fernseher saß und unter den (damals) zehn Sendern auswählte, deren Programme er sich am Vortag aus der Zeitung hatte übersetzen lassen. Dem Vorwurf, sich der Begegnung mit Land und Leuten zu verweigern und Japan lediglich „sekundär“ wahrzunehmen, antwortete er in folgender Weise: „Wenn Sie wissen, wie hier beim Film eine Szene gemacht wird, wenn Sie im Studio dabei sind, wie der Regisseur unvermutet abwinkt, etwas anderes haben will, was in Ihren Augen gut genug war, was aber dem Bewußtsein, das man hier von sich hat, nicht entsprach, wenn Sie dahinterkommen, warum nicht, warum da plötzlich Tränen fließen müssen und da keine, warum der Feind von links vorne kommen muß, warum vier Schritte zu wenig sind und zehn zu viel, dann wissen Sie mehr von Japan als jeder Kulturhistoriker, geschweige denn Lady in ihrem Reisebus. Warum soll ich nach Nara gehen und einen seit Jahrhunderten fertigen Tempel anstarren, wenn ich im Hinterhof des Studios erleben kann, wie er auf gebaut wird? Ich sehe, was man davon weglassen kann, auf welche Punkte sich die Kamera zusammenzieht, wie man sich darin bewegt, wie man sich bei Regen benimmt und wie vor dem Priester.“ „Ausstattung“ ist denn das Thema der Nummer 40 von CINEMA. Den gemeinsamen Wurzeln und vielfältigen Analogien zwischen Film und Grandhotel geht Frieda Grafe nach. Thomas Christen untersucht das Eigenleben der Gegenstände. Ihre Entbindung aus den kausalen Rastern „reflektiert“ die Verfaßtheit der Menschen der Moderne. Roland Cosandeys Analyse eines Klassikers der Filmgeschichte, L’Assassinat du duc de Guise (1908), weist dessen Status als ein Film des Übergangs von der „Einheit des Bildes“ zur „Einstellung“ (als eine Abfolge aufeinander bezogener Fragmente) nach. Von Ralph Eue stammt ein Porträt des kürzlich verstorbenen Ausstatters Alexandre Trauner. Gerhard Midding zeigt an den vielfältigen Arbeiten Richard Sylberts, wie umfassend die Kontrolle des production designers bei Großproduktionen ist. Und Philipp Jacques Baur, der unter anderem als Ausstattungsleiter arbeitet, beschreibt schließlich die gewöhnliche Arbeit eines „Bildners“ bei schweizerischen Filmproduktionen. Zu danken ist Mariann Lewinsky, die uns einige Fragen, welche die Übersetzung des Textes von Sadao Yamane aus dem Japanischen betrafen, lösen half. Alfred Messerli
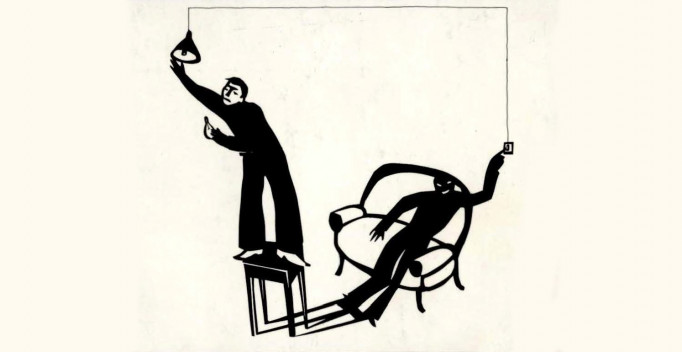
CINEMA #40
AUSSTATTUNG
EDITORIAL
ESSAY
NATUR UND ANTI-NATUR IN DEN FILMEN VON MICHELANGELO ANTONIONI
FILMBRIEF
SELECTION CINEMA
ERNESTO „CHE“ GUEVARA – DAS BOLIVIANISCHE TAGEBUCH (RICHARD DINDO)