Die kleinen Propheten und das eigene Land Jetzt sind wieder deutsche Filme in unseren Kinos zu sehen. Wer nicht an der Arbeit teilgenommen hat, die die Parallelvorführer — vor allem das Berner Kellerkino und das Zürcher Filmpodium — in den vergangenen fünf Jahren geleistet haben, könnte meinen, es sei eine plötzliche Erleuchtung über die Filmlandschaft der Bundesrepublik gekommen. Dem ist natürlich nicht so. Hinter dem Durchbruch des deutschen Films stehen eine Menge filmpolitischer Arbeit, bescheidene Anfänge, auch Fehlschlage. Trotzdem hätten unsere Kinos ein bisschen früher anfangen können, das Filmschaffen der Bundesrepublik zugänglich zu machen. Dem standen objektive und «atmosphärische» Gründe entgegen. Die objektiven: Deutsche Filme hätten rasch amortisiert werden müssen, weil sie früher oder später (meistens früher) von den deutschen Fernsehanstalten aus- und in die Schweiz eingestrahlt wurden. Die «atmosphärischen»: Zwei Vorurteile hatten die neuen deutschen Filme abzubauen; zunächst die Vorstellung, alle deutschen Filme seien ohnehin schlecht; dann aber auch diese merkwürdige Abneigung gegen alles Deutsche, die in der Schweiz mehr als anderswo (mehr sogar als in Ländern, die einmal von deutschen Soldaten besetzt und deutscher Kultur vergewaltigt worden waren) die Kommunikation mit dem Nachbarn gefährdet. Diese Nummer von CINEMA bringt drei verschiedene Aspekte auf den neuen deutschen Film. Eine Systematik war nicht angestrebt, denn in der Bundesrepublik sind in den letzten Jahren so viele Filme entstanden, dass Systematik der Darstellung auf kleinem Raum nicht mehr möglich ist, wenn man nicht auf eine gewisse Sinnlichkeit der Vermittlung zum vornherein verzichtet. Ein solcher Verzicht ist phasenweise in der Entwicklung des deutschen Films auch festzustellen. Ein Verzicht? Oder eine Unfähigkeit zur Sinnlichkeit? Unfähigkeit aus subjektiven oder objektiven Gründen? Es erscheint klar, dass viele Filmemacher auf die Disziplin, die die BRD entwickelte und forderte, um wieder ein reicher und zuverlässiger Staat zu werden, ebenso diszipliniert antworten mussten. Den kalten Zwängen einer erschreckenden Erfolgspolitik versuchten sie mit kühlen Überlegungen beizukommen. Es entstanden gescheite, systematische, aufklärerische Filme: Kalt bis ans Herz hinan. Den Dialog mit dem grossen Publikum schafften erst die sinnlichen (und leider auch die sentimentalen) Filme. Uns scheint, die deutsche Filmszene und einzelne Filmemacher bewegten sich jetzt auf jenes empfindliche Gleichgewicht von Kopf und Hand zu, das die stärksten Autoren und Phasen der Filmgeschichte auszeichnet. Der deutsche Film wurde vom «Erzfeind» entdeckt. In Paris erkannte man im deutschen Film jenen «besseren Teil Deutschlands», der das verschüttete Gespräch aufzunehmen fähig war. England, die Schweiz und sogar die USA sind nachgefolgt. Nicht aber das eigene Land selbst: Die deutschen Kinos sind nicht mehr fähig, den Reichtum der nationalen Produktion darzustellen. Die kommunalen Spielstellen funktionieren als «Ersatz-Kino»; die Abspielbasis des guten deutschen Films ist ähnlich beschränkt wie die Abspielbasis des Schweizer Films im eigenen Land. Wir sind froh, in diesem Heft auch den neuen Film von Alain Tanner vorstellen zu können. Jonas und der Aufsatz von Bruno Jaeggi lassen sich manchmal wie ein Kommentar zur Entwicklung des deutschen Films lesen. Bernhard Giger, Martin Schaub LES PETITS PROPHETES DANS LEUR PROPRE PAYS Le cinéma allemand apparaît de nouveau sur les affiches de nos salles. Qui n'a pas suivi le travail des circuits parallèles et les télévisions allemandes, pourrait croire que la scène cinématographique allemande ait profité d'une illumination soudaine. Mais, derrière le succès et l'intérêt internationaux, se cachent beaucoup de travail politique, des débuts modestes, des erreurs aussi. Une des erreurs principales fut le manque de sensualité de nombreux films. Les cinéastes répondaient avec sécheresse aux contraintes d'un état et d'une société qui aspiraient aveuglement à la conquête de stabilité et richesse. Depuis quelques années, une forte sensualité se manifeste dans le cinéma allemand. C'est elle qui a convaincu les critiques et les amateurs de cinéma à l'étranger. Ils reconnurent dans les films de Herzog, Fassbinder, Wenders et autres la meilleure part de l'Allemagne. Dans leur propre pays, les cinéastes allemands ont presque plus de difficultés. Cinématographiquement, en ce qui concerne les salles, la république fédérale allemande est un désert. Les cinéastes ressemblent aux personnages de Jonas d'Alain Tanner. L'essai de Bruno Jaeggi sur Jonas peut parfois se lire en tant que commentaire de la scène cinématographique allemande. (msch.) LEITFILME EINES JAHRZEHNTS – Films conducteurs d'une décennie 1966 Nicht versöhnt von Jean-Marie Straub. Abschied von Gestern von Alexander Kluge. Der junge Töriess von Volker Schlöndorff. 1967 Mahlzeiten von Edgar Reitz. Mord und Totschlag von Volker Schlöndorff. Tätowierung von Johannes Schaaf. Zur Sache, Schätzchen von May Spils. Lebenszeichen von Werner Herzog. Im Ruhrgebiet von Peter Nestler. Wir waren vorbereitet, für Donnerstag morgens um sechs Uhr in den Streik zu treten von Günther Hörmann. 1968 Chronik der Anna Magdalena Bach von Jean-Marie Straub und Daniele Huillet. Der Bräutigam, die Komödiantin und der Zuhälter von Straub/Huillet. Alaska von Dore O. Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos von Alexander Kluge. Jagdszenen aus Niederbayern von Peter Fleischmann. NICHT löschbares Feuer von Harun Farocki. Warum ist Frau B. glücklich? von Erika Runge. 48 Stunden bis Acapulco von Klaus Lemke. 1969 Cardillac von Edgar Reitz. Eika Katappa von Werner Schroeter. Liebe ist kälter als der Tod, Katzelmacher, Götter der Pest von Rainer Werner Fassbinder. Rote Sonne von Rudolf Thome. 1970 Leave me alone von Gerhard Theuring. Warnung vor einer heiligen Nutte von Rainer Werner Fassbinder. Lenz von George Moorse. Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach von Volker Schlöndorff. Summer in the City von Wim Wenders. Ich liebe Dich — ich töte Dich von Uwe Brandner. 1971 Der Tod der Maria Malibran von Werner Schroeter. Der Händler der vier Jahreszeiten von Rainer Werner Fassbinder. Matthias Kneissl von Reinhard Hauff. Liebe Mutter, mir geht es gut von Christian Ziewer und Klaus Wiese. Rote Fahnen sieht man besser von Rolf Schübel und Theo Gallehr. 1972 Aguirre, der Zorn Gottes von Werner Herzog. Geschichtsunterricht von Jean-Marie Straub und Daniele Huillet. Strohfeuer von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta. Die Wollands von Ingo Kratisch und Marianne Lüdcke. Die Industrielle Reservearmee von Helma Sanders. 1973 Die Verrohung des Franz Blum von Reinhard Hauff. Gelegenheitsarbeit einer Sklavin von Alexander Kluge. Willow Springs von Werner Schroeter. Spanien I von Peter Nestler. 1974 Jeder für sich und Gott gegen alle von Werner Herzog. Alice in den Städten von Wim Wenders. Lina Braake von Bernhard Sinkel. Made in Germany und USA von Rudolf Thome. Kaskara von Dore O. Makimono von Werner Nekes. Nachtschatten von Niklaus Schilling. Lohn und Liebe von Ingo Kratisch und Marianne Lüdcke. Schneeglöckchen blühn im September von Christian Ziewer und Klaus Wiese. 1975 Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Volker Schlöndorff. Faustrecht der Freiheit von Rainer Werner Fassbinder. Falsche Bewegung von Wim Wenders. Auf Biegen oder Brechen von Hartmut Bitomsky. Moses und Aron von Jean-Marie Straub und Daniele Huiliet. Tagebuch von Rudolf Thome. Es herrscht Ruhe im Land von Peter Lilienthal. Berlinger von Bernhard Sinket und Alf Brustellin. Bilder vom verlorenen Wort von Klaus Wyborny. In der Fremde von Sohrab Shahid Saless. 1976 Im Lauf der Zeit von Wim Wenders. Amalgam von Werner Nekes. Shirins Hochzeit von Helma Sanders. Paule Pauländer von Reinhard Hauff. Der aufrechte Gang von Christian Ziewer und Klaus Wiese. Der Fangschuss von Volker Schlöndorff. Verfassungsfeinde, Brühler Arbeitskreis gegen Berufsverbote. Vera Romeyke ist nicht tragbar von Max Willutzki.
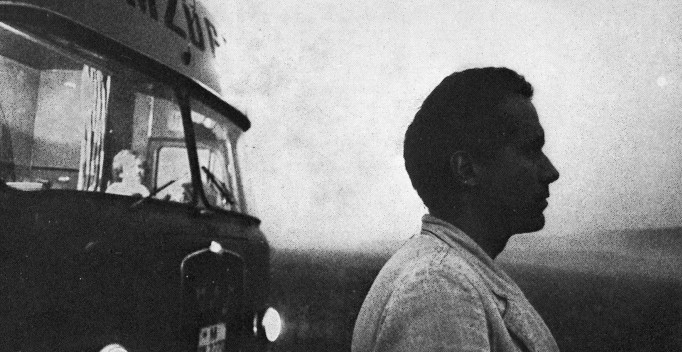
CINEMA #22/3
DEUTSCHER FILM IM LAUF DER ZEIT