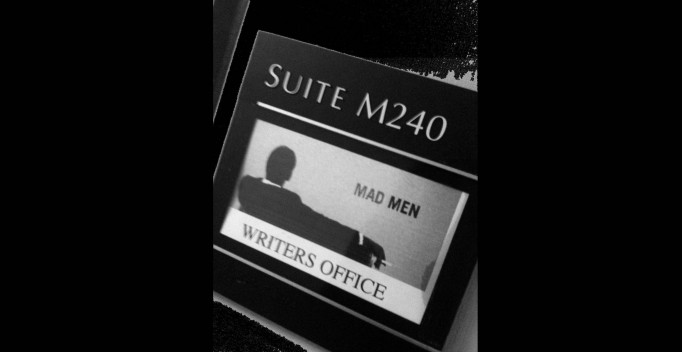Seit ich mich erinnern kann, war ich fasziniert vom Film. Als Kind klebte ich am Bildschirm bei Serien wie Guns of Paradise1, Heidi2 oder Road to Avonlea3, als Teenager kannte ich sämtliche Making-ofs auf Star TV auswendig. Der Traum von Hollywood übermannte mich nicht nur nachts, sondern verfolgte mich auch tagsüber. Diese Stadt, ja der Film überhaupt, schienen aber so unerreichbar wie eine Reise zum Mond.
Welcome to Tinseltown
Ich habe es geschafft ... dachte ich zumindest, als ich 2010 nach Los Angeles zog, um die zweijährige Drehbuchausbildung am American Film Institute AFI – vom Hollywood Reporter im gleichen Jahr zur weltweit besten Filmschule gekürt – zu absolvieren. Mit einem Koffer voll Hoffnung, trunken vor Glück und taumelnd vor Freude bin ich damals in die Filmmetropole gestolpert.
Nachdem ich mehrere Male knapp den Fängen von Betrügern entkommen war, fand ich ein Zimmer in einem schmucken Apartment Building, das mit seinem bepflanzten Innenhof und dem Swimmingpool an die TV-Show Melrose Place4 erinnert. Zum Registration Day am AFI schaffte ich es gerade noch rechtzeitig, obwohl meine Schweizer Armbanduhr ausgerechnet am Morgen des ersten Schultages stillgestanden war. Darauf hatte ich mit einem Schlag 150 Schulkameraden und (Facebook-)Freunde, von denen die meisten genauso wissensdurstig und filmhungrig waren wie ich. Mit brandneuen Joggingschuhen an den Füssen rannte ich zum Griffith Observatory und überblickte die Stadt; von Glück erfüllt und mit dem Gefühl, dass nun alles möglich sei. Das Abenteuer, das damals begann, zieht sich mit immer neuen Höhen und Tiefen und Hürden bis heute weiter.
Auch wenn ich meine Arbeit ganz schweizerisch herunterspiele, wenn andere meinen, ich hätte den interessantesten Job auf Erden, finde ich das trotzdem (meistens) selber ebenfalls. Aber auch ich habe immer mal wieder eine Krise, hinterfrage meinen Beruf und denke, ich sollte eine Arbeit suchen, die mir einen meinen drei Master-Abschlüssen angemessenen Lohn zahlt. Zu einer Fünf- statt Siebentagewoche. Ohne ständige finanzielle Ängste oder das existenzielle Hinterfragen meines Könnens. Ich komme aber immer zum selben Schluss: Filme schreiben und machen ist das, wofür ich lebe – für dieses Privileg, die vielen Chancen, die Hoffnung auf den Durchbruch, den Enthusiasmus, den kreativen Schub, für die interessanten Begegnungen und einen Alltag, in welchem nicht ein einziger Tag wie der andere ist. Auch wenn ich mir das Ganze anfänglich etwas anders vorgestellt hatte.
Damals nämlich, als ich im zarten Alter von fünf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera stand und mir als ein von Allergien geplagtes Kind die Seele aus dem Leib husten musste. Was für mich wie ein Senkrechtstart in die Welt der Stars und Sternchen gewirkt hatte, war in Tat und Wahrheit ein Instruktionsvideo für angehende Ärzte. Gesehen habe ich das Endprodukt nie. Wohl ist das auch besser so. Mein Spielpartner – ein Meerschweinchen – war bestimmt telegener als ich. Und ich hätte meine hochfliegenden Träume beim Anblick meiner selbst wohl sofort wieder begraben. Vielleicht wäre ich Tierpflegerin oder Kleinkinderzieherin geworden, Jobs, die in den 80ern bei Mädchen hoch im Kurs standen. Ich dagegen wollte zum Film. Bloss, wie?
Mit dem Theaterkurs an der Kantonsschule bot sich die Chance, mein künftiges Metier zu erkunden. Ich merkte allerdings schnell, dass meine Talente mehr neben als auf der Bühne liegen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch gleich klarstellen, dass ich eine Namensvetterin habe, die wirklich Schauspielerin und Moderatorin ist. Googelt man mich, findet man sie. Kennengelernt haben wir uns in der Luft zwischen Zürich und Los Angeles. Sie konnte anfänglich die Reise nicht buchen, da die Airline behauptete, sie sei bereits auf diesem Flug. Die Passnummer stellte dann klar: Beide Rahel Grunder wollen am selben Tag auf denselben Flieger. Darauf kontaktierte sie mich via Facebook, ich liess sie am Gate ausrufen und so sassen, assen und schliefen wir dreizehn Stunden nebeneinander und lernten uns kennen.
Du fährst Fahrrad, bist du lebensmüde?
Da die Ausbildung am AFI ein Vermögen kostet – ich hatte zwar glücklicherweise Stipendien, die einen Grossteil davon abdeckten – und man ja auch sonst noch leben muss, versuchte ich so günstig wie möglich durchzukommen. Heisst: zurück in eine WG, statt Auto ein Fahrrad. Obwohl ich von meinem autofreien Vorsatz beinah schon an demjenigen Tag wieder abkam, an dem ich mein Fahrrad in einem südöstlichen Stadtteil von LA kaufte. Ich war top vorbereitet für die Reise, da selbstverständlich aus Kostengründen kein Datenvolumen auf meinem Handy. Nach der komplizierten Hinfahrt mit Metro und Bussen konnte ich mit dem Drahtesel einfach dem Los Angeles River Bike Path folgen, der mich in ein paar Stunden nach Hause bringen sollte; fast wie die Wochenendausflüge mit der Familie anno dazumal von Schwamendingen an den Greifensee, entlang der Glatt. Bloss hatte ich bei meiner kartografischen Recherche nicht beachtet, dass zwei Flüsse von Norden Richtung Pazifik fliessen. Ich erwischte den falschen und landete nach vier Stunden in der Pampa, an einem Autobahnkreuz ohne weitere Fahrrad-Option. Mein Quartier Los Feliz kannte dort niemand. Während ich eine Stunde lang auf einen Bus wartete, von dem ich hoffte, dass er in die richtige Richtung fahren würde, verfluchte ich meinen Vorsatz. Acht Stunden später war ich bei Einbruch der Dämmerung wieder zuhause. Trotzdem besitze ich auch heute kein Auto und nach wie vor mein gelbes Rennrad aus den Siebzigerjahren, das sowohl die Security am AFI kennen wie auch der Obdachlose bei der Metrostation. Ihm drücke ich jeweils einen Dollar in die Hand, damit er meinen treuen Begleiter im Auge behält.
Dass ich auch zu Meetings mit meinem Velo pedale, verheimliche ich in Hollywood in der Regel. Obwohl man als Autor sowieso entweder sozial gestört, auf irgendwelchen Substanzen oder ganz generell durchgeknallt sein muss, will man doch niemandem das Gefühl geben, man sei derart suizidal, dass man die nächste Fassung des Drehbuches vielleicht mit ins Grab nimmt.
The Discreet Charm of Internships
Um sich die Sporen in der Industrie abzuverdienen, absolvierten die meisten AFI-Studierenden während der Semesterferien Praktika. Ich arbeitete bei einer Produktionsfirma auf dem Disney-Areal. Auch dort kannte man mein Fahrrad und mich beim Eingang nach kurzer Zeit, sodass ich vorbeikurven durfte an den verbeulten Karren der Besucher und den edlen Karossen der Studiobosse. Nach einem kurzen Weg über den Mickey Mouse Way und entlang dem Popeye Drive war ich am Ziel. Ich habe in den sechs Monaten Praktikum pro Tag zwei Drehbücher gelesen und Einschätzungen geschrieben, für die Kinder der Chefin Nannys organsiert, für den Ehemann Flüge in die Karibik gebucht und immer mal wieder das Foto abgestaubt, das die Produzentin händeschüttelnd mit Barack Obama zeigt. Gebracht hat mir das Praktikum in Bezug auf meine Karriere aber herzlich wenig. Daher war ich zurückhaltend bei weiteren Bewerbungen, bis das perfekte Angebot gekommen schien.
Was wie die Pforte zum goldenen Himmelstor Hollywoods geklungen hatte, stellte sich als Knochenarbeit im wörtlichen Sinne heraus: Mad Men5, Season 5! Es erfüllte mich jedes Mal mit Stolz, am Morgen diejenige Türe aufzustossen, die mit «Mad Men Writers Room» angeschrieben war. Hinter dieser Türe, in einem zentral-gesteuert unterkühlten Büro gehörte ich zum Rechercheteam, wo wir – wegen der Kälte in Daunenjacken – von der Gummilegierung der Autopneus über Speisekarten zu Hare Krishna alles herauszufinden hatten, was die Autoren über das Jahr 1966 von uns wissen wollten. Um zehn Uhr morgens wanderte eine Kaffeeliste von Autor zu Produzent zu Assistent. Danach spazierte man zu zweit zum nächsten Starbucks. Ich fand es stets furchtbar peinlich, zwanzig Bestellungen aufzugeben, wenn hinter mir gestresste Banker oder Mütter mit brüllenden Kindern warteten. Gott sei Dank sind die Amerikaner so geduldig und geübt im Schlangestehen. Hatte man das Warten auf die Bestellung überstanden, begann die Tortur. In Kartonschachteln trugen wir die Lattes, Ventis und Frappuccinos zurück ins Büro. Seither hasse ich Ventis, denn zwanzig davon setzen auch trainierten Armen nach einem halben Kilometer zu. Beim Gedanken ans Drehkreuz, das die L.A. Central Studios von der Strasse abschirmte, kriege ich heute noch Schweissausbrüche. Es liess sich nur mit Badge öffnen, und dies, obwohl doch überall Wärterhäuschen stehen mit netten Menschen drin, die tagein, tagaus Barrieren öffnen. Aber natürlich gab es genau bei dem Eingang, der am nächsten bei Starbucks lag, nur ein Drehkreuz, das darüber hinaus noch so eng war, dass die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung darin stecken geblieben wäre. Während ich mich mit meiner heissen Ladung vorsichtig durchzwängte, hoffte ich jeweils, dass nicht im selben Augenblick jemand von der anderen Seite flott hinauswollte und dem Kreuz einen Schwung verlieh, der auf meiner Seite ein Desaster zur Folge gehabt hätte.
Kaum hatte man sich wieder im zu recherchierenden Thema festgebissen und nach der schweisstreibenden Kaffeeaktion zu frieren begonnen, war es Zeit für den Lunch. Aus Zeitgründen assen wir alle im Büro. So konnten die Autoren im Sitzungszimmer weiterdiskutieren, während das Team hinter seinen Bildschirmen Currys löffelte oder Sushis pickte. Mein wohl peinlichstes Erlebnis: als ich am ersten Tag dem Erfinder der Show, Matthew Weiner, sein Mittagessen überreichte und ihm die dazugehörige Sauce gleich über die wohl schweineteuren Schuhe servierte. Zum Glück nahm es Matt locker. Vielleicht waren es Sponsoring-Schuhe? Noch nie habe ich erlebt, wie jemand derart mit Geschenken überhäuft wurde. Jeden Tag kamen Pakete von Firmen, die Matt mit ihren Produkten beschenkten. Matt genoss auch das Privileg, in seinem Büro rauchen zu dürfen – stilecht für denjenigen, der eine der wenigen Serien erfunden hat, in der im amerikanischen TV noch Kette geraucht werden darf. Selbstverständlich pafften die Schauspieler auf dem Set nur Kräuterzigaretten. Allerdings roch es in den Studios demzufolge wie in der Küche einer Kräuterhexe.
Nach dem Abdrehen der Staffel wurden wir alle sowohl ans rauschend-dekadente Abschiedsfest eingeladen als auch reich beschenkt. Und so schlafe ich noch heute im Sechzigerjahre-orangen Mad Men-T-Shirt, ziehe mir in der Kälte den Mad Men-Faserpelz an oder blättere im Mad Men-Kalender. Nur die Mad Men-Oberarmmuskeln, die brauchen dringend mal eine Auffrischung, allerdings lieber im Fitnesscenter als beim Kaffeetragen.
Wir schiessen unter der Brücke
Unseren AFI-Abschlussfilm drehten wir in Santa Clarita, dreissig Meilen nördlich von Los Angeles, da wir eine Zugbrücke aus der Zeit der Great Depression benötigten. Wir fanden eine intakte Brücke im Western-Städtchen Fillmore und eine halb zerfallene im idyllischen Dörfchen Piru. Fillmore kostete 2500 Dollar die Stunde, da Christopher Nolan dort einen Teil von Inception6 gedreht hatte. Wir konnten uns eine halbe Stunde leisten. Also schossen wir den darüberfahrenden Zug mit sieben Kameras gleichzeitig. Vorschriftsgemäss hatten wir auch eine Armee von Sicherheits- und Medizinpersonal dabei. Den Rest der Dreharbeiten verbrachten wir in Piru. Am letzten Tag hörten wir Schüsse. Unsere Produktionsleiterin kam aufgelöst vom Basislager angerannt. Sie habe die Schiesserei gesehen, es sei ganz furchtbar, sie habe umgehend die Polizei informiert. Nur, wie sollte sie ihre Anwesenheit am Tatort erklären? Trotz dem miterlebten Horror brach sie in ein beinah hysterisches Lachen aus. «We’re shooting under the bridge», klinge der Situation nicht eben angemessen.
Die Polizei suchte den Flüchtigen danach mit einem Grossaufgebot. Uns blieben zwei Stunden, um den Film fertig zu drehen. Nach Sonnenuntergang wurde das gesamte Tal abgeriegelt. Kleines Detail: Wir waren soeben daran, eine Selbstmordszene zu drehen, unsere Hauptdarstellerin lag blutüberströmt am Boden, während die Polizeihelikopter über ihr Kreise zogen. Uns war allen nicht wohl. Wie wir später erfuhren, ist Piru ein Drogenumschlagplatz. Die beiden in die Schiesserei verwickelten Männer kannten sich. Der Verletzte hat glücklicherweise überlebt.
Hope Floats – See der Hoffnungen
Am Ende unserer zweijährigen Ausbildung am AFI gab es für die Drehbuchautoren – auf 26 Autoren kamen in meiner Klasse nur drei Frauen – ein Pitchfest, bei welchem wir uns und unsere Bücher an Agenten, Manager und Produzenten bringen sollten. Nach wochenlangen Vorbereitungen, nach dem Schleifen der Loglines, bis man durch eine See von Sägespänen hätte waten können, und dem Eintrainieren unserer Pitches, war der grosse Tag gekommen; und nach drei Stunden, einem ausgetrockneten Mund und Blutschwitzen war der ganze Spuk auch bereits wieder vorbei. Danach löschten wir unseren Durst und verglichen die Visitenkarten, die wir hatten abgrasen können. Es fühlte sich ein bisschen an wie damals in der Primarschule, als wir vor der Turnhalle Panini-Bilder verglichen.
Nach dem Verschicken der Drehbücher hiess es warten, nachfragen, warten. Ab und an wurde ich zu einem Kaffee- oder Lunchmeeting eingeladen, das meist mit «keep me posted» oder «keep in touch» endete. Obwohl ich heute weiss, dass diese Treffen meist nirgends enden, bin ich nach wie vor immer enthusiastisch und freue mich, wenn jemand mir eine Audienz gönnt. Grosse Hoffnungen hatte ich nach einem Treffen mit einem hyperaktiven Head of Development. Er suchte für einen der grossen Haie in Hollywood neue Stoffe. Ich war ein hungriger, kleiner Fisch mit grossen Ambitionen. Deshalb unterschrieb ich einen miesen Vertrag und tippte gratis die erste Episode einer historischen Serie. Es war einer dieser ganz raren Fälle, dass ich etwas aus meiner Feder richtig umwerfend gut fand. Ja, ich war sogar stolz auf meine Arbeit. Und der Auftraggeber bestärkte mich in meiner Meinung, als er mich anrief und sagte: «Rahel, I love it.» Am Ende des Gespräches sagte ich, ich sei wirklich froh, dass er das Drehbuch gut fände und seine Antwort war: «No, I don’t like it, I love it.» Na, wenn das mal nicht der Anfang einer grossen Autorenkarriere werden sollte! Allerdings ist daraus auch sechs Jahre später und trotz halbjährlichen Meetings nichts geworden.
Spektakulär fand ich das erste Meeting bei Universal: Ich wurde mit dem Golfcart ins Büro gefahren, das neben demjenigen von Steven Spielberg lag, dessen Türklinken Köpfe von E. T. waren. Eine andere erinnerungswürdige Sitzung fand auf dem Warner-Brothers-Areal statt, im Frank-Sinatra-Gebäude. Nur schon im Wartezimmer zu sitzen und Auszeichnungen und Trophäen Sinatras zu bewundern, fühlte sich an wie ein Museumsbesuch, für den man nicht bezahlen musste.
Kämpfen, schreiben, zurücklehnen
Zweimal im Jahr treffe ich den «Career Adviser» vom AFI. Dann erzähle ich ihm von den Projekten und Aufträgen, die ich habe – und von all dem, was ich machen will, was nicht vorwärtsgeht, wo ich zu wenig Zeit und kein Geld habe. Dann ermahnt er mich stets zu Geduld. Eine Eigenschaft, die ich in unserem Beruf schwierig finde. Ich muss mich immer wieder damit beruhigen, dass ich es eigentlich schon weit gebracht habe, denn ich kann vom Schreiben und Filmemachen leben. Trotzdem ist es nicht einfach und kein Zuckerschlecken.
Nach eineinhalb Jahren arbeiten, kämpfen und strampeln nach dem Abschluss des AFI bekam ich 2014 vom Schweizer Fernsehen das wunderbare Angebot, Regie für meinen ersten Nachwuchsspielfilm7 zu führen. Ich verlegte also meinen Wohnsitz retour in die Schweiz und drehte im gleichen Jahr auch eine Dokufiction8 fürs Schweizer Fernsehen. Zwischen den Dreharbeiten unterrichtete ich die Summer School zum Ethnographischen Film an der Universität Zürich, die ich alle zwei Jahre leite. 2014 war ein sehr gutes, sehr beschäftigtes Jahr. Es war enorm viel Arbeit, aber sie war sehr lehrreich, bereichernd und trug sichtbare Früchte. Das ist keine Selbstverständlichkeit und daher extrem beglückend und Energie spendend.
2015 arbeitete ich abermals sieben Tage die Woche, es war aber – finanziell und erfolgstechnisch – eher für die Katz. Gelernt habe ich bestimmt abermals sehr viel in diesem Jahr, das mich bisweilen nicht nur fast um den Verstand, sondern auch um die Existenz gebracht hat. Ein wenig Trost habe ich in der Tatsache gefunden, dass viele Projekte entwickelt werden und nie ihren Weg auf die Leinwand beziehungsweise den Bildschirm finden. Eigentlich die meisten. Nach jahrelangem Einsatz, dem erhofften Erfolg und dem sang- und klanglosen Begräbnis eines Projekts wieder auf die Füsse zu kommen, das ist schwierig. Ich habe kürzlich einen Artikel9 von Mad Men-Erfinder Matt Weiner gelesen, der mir grossen Eindruck gemacht hat. Darin schreibt er, dass er während seiner von Misserfolgen geprägten Jahre eine Überlebensstrategie entwickelt hat: Gedeihen an Zurückweisung, festhalten an Komplimenten. Zurückweisung mache ihn wütend, rufe aber auch dieses kraftvolle und motivierende Gefühl des «Ich zeigs euch!» hervor. Er sei heute an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er Angst davor habe, dieses Gefühl zu verlieren. Weil er ohne diesen Ansporn vielleicht aufhören würde. Auf der anderen Seite gebe es nichts Bedeutungsvolleres als ein Kompliment von jemandem, den man respektiere. Gefragt, was er rückblickend am meisten bereue, antwortete er: dass er am Anfang seiner Karriere nicht einfach jeden Tag zwei Seiten geschrieben habe. Dann hätte er am Ende jeden Jahres 500 Seiten verfasst, Wochenenden nicht eingerechnet.
Diesen Vorsatz versuche auch ich mir immer wieder zu Herzen zu nehmen, wobei kein einziger Tag ist wie der andere. Manchmal recherchiere ich tagelang in einem Archiv, an einem anderen Tag schaue ich mir das Forensische Institut an, am nächsten hocke ich beim Assistenten von Brett Ratner und pitche Ideen, während er auf dem Laufband joggt. Wieder an einem anderen Tag lese ich mich durch zig Bücher, um mir eine Vorstellung von Karthago zur Zeit des Zweiten Punischen Krieges zu machen. Ich habe mich in den letzten vier Jahren unter anderem auf das Verfassen von historical fiction spezialisiert. Dabei basiere ich die Handlung und die Figuren auf wahren Begebenheiten und fiktionalisiere sie dahin, dass eine dramatische, verfilmbare Story entsteht. Daneben schreibe ich aber auch zeitgenössische Stoffe und arbeite an eigenen Projekten, die ich in absehbarer Zukunft drehen möchte.
Mittlerweile verbringe ich pro Jahr durchschnittlich sieben Monate in Zürich und fünf Monate in Los Angeles. Diesen Lebensstil betrachte ich als Luxus, den ich nur dank meines Jobs führen kann. Denn schreiben kann man überall auf der Welt. Abzureisen bereitet mir jedes Mal nach wie vor Schwierigkeiten – ob in Zürich oder in Los Angeles. An beiden Orten habe ich Freunde, ein professionelles Netzwerk, meine Lieblingsorte, meine Fahrräder, eine Wohnung mit Arbeitsplatz, welche ich untervermiete, wenn ich am anderen Ende der Welt bin. Das ist der stressigste Teil: Immer, wenn ich irgendwo ankomme, muss ich bereits die Zeit meiner Abwesenheit wieder organisieren. Wenn ich dann jeweils an der anderen Destination ankomme, geniesse ich diese Bubble, eine Zeit, in der niemand weiss, wo ich grad bin.
Manchmal ertrage ich beim Schreiben ohnehin nicht viel Sozialleben. Ich verbringe ja schon zwischen acht und sechzehn Stunden mit fiktionalen Figuren, lerne sie von immer neuen Seiten kennen, erfahre ihre Geheimnisse und tauche in ihre Innenleben mit all ihren Abgründen ein. Da habe ich manchmal keine Kapazität mehr für reale Personen und brauche me-time. Das klingt zwar beinah schizophren, denn ich sitze ja den ganzen Tag allein zuhause und führe Gespräche mit imaginären Figuren. Dabei lege ich nicht nur sie, sondern auch mich auf die Couch und versuche, Hirn- und Psychologieströme zu sortieren und herauszufinden, welche Eigenschaften, welche Ängste, Ziele und Träume meine Charaktere haben. Auch fiktionale Menschen fordern Aufmerksamkeit, rauben bisweilen Energie, und die Analyse ihres Innenlebens kostet volle Konzentration. Es gibt Tage, da stehe ich auf und schalte den Computer ein, wandle zur Kaffeemaschine und retour an den Computer, um sechzehn Stunden später zurück ins Bett zu fallen. Ein bis zwei Wochen vor Deadlines ist das meistens so. Ich muss auch gestehen, dass ich das mag. Ein Zitat der Autorin Harper Lee hat mich darin bestärkt, dass andere Autoren ähnlich empfinden: «I like to write. Sometimes I’m afraid I like it too much because when I get into work I don’t wanna leave it. As a result I’ll go for days and days without leaving the house or wherever I happen to be.» In solchen Zeiten gibt es für mich nichts anderes als die Geschichte, die Figuren. Man hat neunzig Seiten im Kopf, spürt den Rhythmus der Story, analysiert und sucht nach den perfekten Worten. Nur schon ein Telefonanruf erscheint dann wie eine Störung aus einer anderen Welt.
Stehe ich aber nicht gerade vor einer Deadline, sind mir mein soziales Umfeld und Sport enorm wichtig. Lange Zeit hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich über Mittag ins Tanztraining radelte oder morgens zu meinen Lieblingsaussichtspunkten bei der Waid oder dem Griffith Observatory joggte. Irgendwann realisierte ich aber, dass Bewegung und die Anregung beider Hirnhälften elementar sind für meine Kreativität. Nach dem Training fühle ich mich nicht nur gut, sondern ich bin auch produktiver und fokussierter. Die zwei bis drei Stunden, die ich für Sport aufwende, «verbrösmele» ich sonst wahnsinnig gut und gerne mit Prokrastination. Darin sind fast alle Autoren talentiert. Denn es gibt immer noch etwas zu tun, eine Website oder ein Filmchen anzuschauen, ja gar putzen ist manchmal einfacher, als vor einer leeren Seite mit einem erbarmungslos blinkenden Cursor zu hocken. Das Gefühl aber, wenn auf einmal Bausteine zusammenpassen, der Rhythmus wie Musik zu klingen beginnt und die Figuren wie von selbst handeln und sprechen, ist unbeschreiblich. In diesen seltenen Momenten verbinden sich Recherche, Fantasie, Wissen und Erfahrung zu einem Feuerwerk, das man nicht nur selber gestaltet, sondern auch noch eigenhändig ablassen darf.
Nach der Abgabe eines Projekts fühle ich mich jeweils wie neugeboren, wenn ich danach wieder in die andere, die reale Welt zurückgehe.