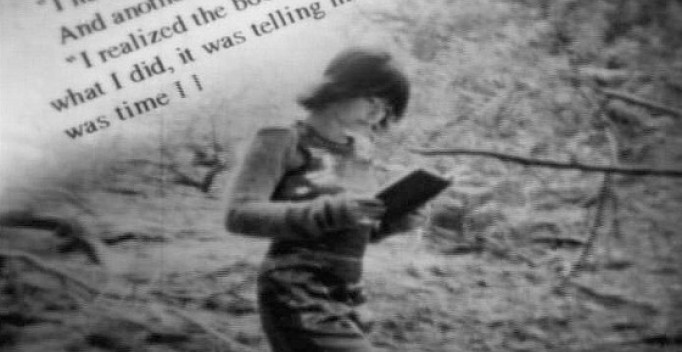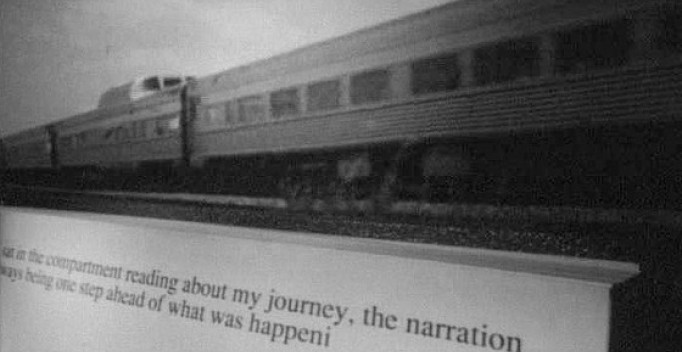Vom Urknall bis zur Geburt eines Drehbuchautors in weniger als einer Minute: Es ist eine kleine Evolutionsgeschichte im Schnelldurchlauf, was uns Spike Jonze in einer kurzen Sequenz zu Beginn seines Films Adaptation (USA 2002) vorführt. Auf gewisse Weise ist das Pop im Wortsinn, denn Popsongs beanspruchen genau das für sich, was hier inszeniert wird: Auch Pop will in weniger als dreieinhalb Minuten die Welt erklären. Aber entscheidend ist hier etwas anderes. Die beschleunigte Evolutionsgeschichte aus Adaptation ist nämlich Zitat: Regisseur Spike Jonze verneigt sich mit dieser Sequenz vor dem Musikvideo zum Track Right Here, Right Now (1999) von Fatboy Slim, einem britischen Musiker, für den Jonze selber einige Clips inszenierte. In einem vergleichbaren Schnelldurchlauf beschreibt das Video zu Right Here, Right Now (Regie: Hammer & Tongs) die Entwicklungsgeschichte von einem Einzeller über prähistorische Amphibien und frühe Menschenaffen als atemlosen Dauerlauf. Evolution wird als fieberhaftes Morphing inszeniert, und am Ende dieses Reigens der Mutationen setzt sich ein völlig verfettetes Exemplar des inzwischen zivilisierten Menschen auf eine Bank, erschöpft von der rastlosen Entwicklung seiner eigenen Spezies. Anders gesagt: Der Mensch in Right Here, Right Now ermüdet an der Geschwindigkeit, in der seine eigene Vorgeschichte erzählt wird.
Wenn nun die Gattung Musikvideo gern mit einer Ästhetik der Beschleunigung in Verbindung gebracht wird, dann unterläuft der Clip zu Right Here, Right Now dieses Tempodiktat, gerade indem er es erfüllt, weil dieses Video letztlich ja besagt: Geschwindigkeit macht müde. Das ist die ironische Pointe dieses Clips, und damit wird hier auch jene landläufige Kulturkritik gekontert, die Musikvideos (und die «Clipästhetik» von MTV im Allgemeinen) in erster Linie in Parametern der Beschleunigung sieht. Die Marke MTV ist ja längst nicht mehr nur ein Synonym für Musikvideos, sondern auch eine Chiffre für eine Ästhetik der horrenden Schnittfrequenzen und der Zerstückelung des Erzählens in diskontinuierliche Bilderfolgen.1 Überspitzt formuliert, läuft diese traditionelle Kritik stets darauf hinaus, dass die Gattung Musikvideo das filmische Erzählen kaputt mache.2 Der Clip zu Right Here, Right Now, auf den Spike Jonze in Adaptation anspielt, ist für diese Debatte nun deshalb entscheidend, weil er diese Kritik gleichsam mit inszeniert und dadurch ihren blinden Fleck aufzeigt: Denn dieses Musikvideo macht zwar Tempo, aber es kommt dabei ohne einen einzigen Schnitt aus; der Erzählfluss bleibt ungebrochen, von einer Ästhetik der Zerstückelung kann keine Rede sein.3
Das heisst nun nichts anderes, als dass die Kritik an der Clipästhetik von MTV mittlerweile zu einem Bestandteil des Programms von MTV geworden ist.4 Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, nicht mehr nur vom frenetischen Flackern der Bilder zu reden, das seit jeher als kulturelles Kernsymptom von MTV gilt, sondern den Fokus zu verschieben auf eine jüngere Generation von Clipregisseuren, die in ihren Musikvideos die alten kulturkritischen Vorwürfe gegenüber dem Musiksender oft ins Leere laufen lassen, weil sie diese Kritik gleichsam verinnerlicht haben.5 Anzeichen dafür wurden in den vergangenen Jahren gerade auch im Kino sichtbar, und zwar in den ersten Kinofilmen dreier Clipregisseure, um deren Musikvideos es hier vornehmlich gehen soll. Neben Spike Jonze sind das der Engländer Jonathan Glazer und der Franzose Michel Gondry, die das Musikvideo in den Neunzigerjahren massgeblich geprägt hatten, bevor sie sich um das Jahr 2000 herum erstmals ins Kino wagten — und wie zunächst bei Being John Malkovich (USA 1999) von Spike Jonze konnte man auch bei Glazers Gangsterfilm Sexy Beast (GB/Spanien 2000) und bei Gondrys Zivilisationssatire Human Nature (F 2001) erahnen: An einem Kino, wie es üblicherweise mit der «Generation MTV» assoziiert wird, sind diese Filmemacher nicht interessiert. Oder um es mit den Worten von Jonathan Glazer zu sagen: «doing very flashy things with huge budgets», das ist nicht, was diese drei Regisseure anstreben im Kino.6
Diese Erstlinge machen deutlich: Die Chiffre MTV taugt hier nur noch bedingt als ästhetische Kategorie. Die britische Zeitschrift Sight and Sound hat das schon anlässlich von Being John Malkovich erkannt und bemerkt, dass es verfehlt wäre, eine gemeinsame Ästhetik für Jonze, Gondry und andere Clipregisseure ihrer Generation formulieren zu wollen.7 Möglicherweise passiert in den Musikvideos jener Filmemacher aber etwas auf einer fundamentaleren Ebene als in der Form beschleunigter Oberflächenreize, die immer wieder als die «Bilderflut» von MTV beschrieben wurde. Wie Neil Feinemann in seiner Einführung zum Bildband Thirty Frames Per Second: The Visionary Art of the Music Video festhält, ist es nämlich eine der grundlegendsten Konsequenzen der Musikvideos, dass sie filmische Ästhetik als traditionelles Kriterium der Autorschaft obsolet machen: «The video’s ability to handle diverse images, styles, and techniques – often within an individual director’s portfolio – has forced us to redefine the concept of the auteur.»8 Und wenn sich die Autorschaft eines Clipregisseurs demnach gerade nicht über ihm eigene formale Signaturen bestimmen lässt, macht es auch keinen Sinn, das Kino eines Spike Jonze, Jonathan Glazer oder Michel Gondry im Kontext einer Ästhetik des Musikvideos zu sehen.
Vielleicht ist nun das, was diese drei Regisseure gemein haben, weniger in einer spezifischen Filmsprache zu suchen als in einer erzählerischen Haltung, einem eigentümlichen Verhältnis zur Narration, das gerade in ihren Clips am stärksten zutage tritt. Und vielleicht lässt sich dieses besondere Verhältnis zum Erzählen als Konsequenz ihrer Arbeiten auf dem Gebiet des Musikvideos fassen, zumal eine der fundamentalen Differenzen zwischen Clip und Kino ja gerade die Frage der Narration betrifft. Wie beispielsweise Klaus NeumannBraun und Axel Schmidt festhalten, wurde in der Forschung immer wieder darauf verwiesen, dass die Bilder der meisten Musikvideos «keinem Erzählstrang folgen, wie man ihn aus dem Erzählkino kennt»; und das, fahren sie fort, werde gerade von Vertretern der Postmoderne immer wieder als «Befreiung von etablierten gesellschaftlichen Darstellungsund Deutungsmustern» begrüsst.9 Doch wenn sich die Gattung Musikvideo kaum an die traditionellen Codes des Erzählkinos hält, ist das immer auch als Konsequenz des besonderen Funktionszusammenhangs zu sehen, in dem Musikvideos zirkulieren.
Der Kernauftrag des Clips besteht ja nach wie vor darin, einen Star und sein Image zu verkaufen, weshalb das weitaus häufigste Genre auch heute noch das klassische Präsentationsvideo ist, das den Star in irgendeiner Weise bei der Inszenierung seiner selbst zeigt. Aufgrund der Programmstruktur von MTV muss ein Clip auch möglichst so beschaffen sein, dass er seine Schauwerte selbst bei mehrfachem Sehen nicht einbüsst. Deshalb, schreibt Neil Feinemann, sei der Vorwurf auch absurd, dass Musikvideos das Erzählen kaputt machen würden: «Although it is commonly attacked for destroying narrative, for example, a plot-driven video usually gets boring the third time you watch it and unbearable soon thereafter.»10 Wenn die wenigsten Musikvideos Plotorientierte Erzählstränge aufweisen, liegt das also an der Logik der «heavy rotation», und wenn Clipregisseure ihre Musikvideos kaum je als Erzählfilme in einem klassischen Sinn gestalten, dann auch deshalb, weil die kulturelle Ökonomie von MTV sie dazu verpflichtet. Es scheint demnach durchaus berechtigt, wenn der Literaturwissenschaftler Joseph Vogl anmerkt, «dass das Verhältnis von Musikvideo und Erzählung eigentlich ein Widerspruch ist, man könnte fast sagen ein ganz kategorischer Widerspruch».11
Nun ist es aber so, dass gerade dieser Widerspruch, dieses von MTV gewissermassen institutionalisierte Diktat gegen das Erzählen von Geschichten, manche Clipregisseure zu Auseinandersetzungen mit den Bedingungen des Erzählens selbst provoziert. Man kann deshalb die These aufstellen, dass gerade das prekäre Verhältnis des Musikvideos zur Erzählung zu einem verstärkten Bewusstsein für narrative Prozesse führt. Jedenfalls haben gerade Filmemacher wie Jonze, Gondry und Glazer in ihren Musikvideos immer wieder das Erzählen selbst zum Thema gemacht, und die bestechendste Arbeit in dieser Hinsicht ist sicherlich Michel Gondrys Clip zu Bachelorette (1997; Abb. 1.1–4) von Björk, einem Märchen über die Geburt eines Stars. Diese kleine Meta-Erzählung beginnt damit, dass Björk als einsiedlerisches Mädchen im Wald ein Buch mit lauter leeren Seiten findet, während uns ihre Stimme via Voice-over gleichzeitig genau das nacherzählt: dass sie nämlich eines Tages im Wald ein Buch mit lauter leeren Seiten gefunden habe. Das Buch habe sich dann vor ihren Augen selbst zu schreiben begonnen, und wie sich so die Seiten eigenmächtig mit Text füllen, ereignet sich auf der Bildebene genau das, was das Buch auf der Textebene beschreibt: Björk sitzt im Zug, fährt in eine Grossstadt, bringt ihr Buch zu einem Verleger. Dabei findet eine Umkehrung des traditionellen Verhältnisses zwischen Ereignis und Narration statt, denn die Narration, so schreibt das Buch an einer Stelle, ist den erzählten Ereignissen immer einen Schritt voraus. Doch das ist erst der Anfang in diesem vielschichtigen Spiel um die Verselbstständigung einer Erzählung.
Denn noch vor der ersten Strophe des Songs hat sich das Buch zu Ende geschrieben, und was der Clip fortan zeigt, ist die weitere Geschichte des Buches als Kulturprodukt, das inzwischen unter dem Titel My Story in den Buchhandlungen aufliegt und als dessen Autorin das Mädchen aus dem Wald gefeiert wird. Als My Story dann als Musical auf die Bühne gebracht wird, bekommt der bislang schwarzweisse Clip Farbe, und mit dieser ersten Bühnenadaption setzt nun ein Reigen von ineinander verschachtelten Inszenierungen ein; das Musical nämlich, das ja selber schon eine Reproduktion von My Story ist, läuft dann seinerseits darauf hinaus, dass es die Inszenierung der Geschichte des Buches als Musical auf der Bühne nochmals inszeniert, als Spiel im Spiel. Innerhalb der Bühnenversion läuft also eine Kopie der Bühnenversion ab, und damit beschreibt dieser Clip eine Bewegung, die man in der Erzähltheorie mit dem Begriff der mise-en-abîme bezeichnet: Eine Figur innerhalb eines Textes produziert ihrerseits einen Text, der nahezu identisch ist mit demjenigen, von dem sie selber ein Teil ist. Man kennt dieses Prinzip aus Adaptation, dem Film über einen Drehbuchautor, der seine Schaffenskrise überwindet, indem er sich selber mitsamt seinem Schreibstau ins Drehbuch hineinschreibt: Der Film, an dem der Autor im Film schreibt, ist weitgehend identisch mit diesem Film namens Adaptation, den wir im Kino sehen. Da möchte man fragen: Ist es Zufall, dass ausgerechnet ein Film des Clipregisseurs Spike Jonze die bestechendste Kinoversion dessen liefert, was der Clipregisseur Michel Gondry in einem seiner brillantesten Musikvideos als ein märchenhaftes Essay über das Erzählen inszeniert hat?
Doch nochmals zurück zu Bachelorette. Mit dem Prinzip der mise-enabîme setzt Gondry nun eine potenziell endlose Regression in Gang: Jede Inszenierung von My Story verweist nur auf frühere Inszenierungen, mit jeder Reproduktion entfernt sich die Fiktion weiter von der erzählten Wirklichkeit. Am Ende beginnt das Buch, seinen Text eigenmächtig zu löschen, und innerhalb der labyrinthischen Kulissen des Musicals wird es schliesslich von wucherndem Gestrüpp verschluckt – der Waldboden fordert das enteignete Buch zurück, aus dem umjubelten Star wird wieder das einsame Waldmädchen von früher, und das einzige Element, das diese narrative Kreisbewegung nicht mitmacht, ist die Farbe, die am Schluss nicht wieder aus dem Film verschwindet. Das Musikvideo zu Bachelorette wird dadurch einerseits lesbar als Parabel über den Star, der sich in den mehrfachen Inszenierungen und Reproduktionen, die zu seiner Vermarktung dienen, buchstäblich abhanden kommt und der in den Kulissen des Popzirkus einen Weltverlust erleidet. Überdies verschränkt sich hier das Genre des narrativen Clips mit jenem des Präsentationsvideos, indem Björk als «Bachelorette» auch ihr eigenes Image inszeniert und reflektiert: das Image des Mädchens aus der natürlichen Abgeschiedenheit Islands, das in den Zentren der Kulturindustrie zum Star wurde. Im Kontext meiner These ist dieser Clip aber auch ein dreister Versuch, den stillschweigenden Kontrakt, wonach ein Musikvideo keine einfache Erzählung offerieren dürfe, dadurch zu unterlaufen, dass die Narration selbst zum Thema gemacht wird. Statt im eigentlichen Sinn zu erzählen, liefert Michel Gondry mit diesem Clip ein kleines Lexikon der Narratologie.
Im Extremfall hebt ein Clip den institutionalisierten Widerspruch zwischen Musikvideo und Erzählung also dadurch auf, dass die Narration dermassen ins Zentrum gerückt wird, dass aus dem Clip ein Film über das Erzählen selbst wird, und als eine der verblüffendsten Arbeiten in dieser Hinsicht darf Michel Gondrys Video zu Sugar Water (1996) des japanischen Frauenduos Cibo Matto gelten (Abb. 2.1–4). Auf dem halbierten Bildschirm laufen hier zeitgleich zwei spiegelsymmetrische Geschichten ab, und zwar je einmal vorwärts und einmal rückwärts. In der linken Bildhälfte erhebt sich zunächst Yuka Honda aus dem Bett, duscht sich, kleidet sich an und verlässt das Haus, in der rechten Hälfte macht gleichzeitig ihre Bandkollegin Miho Hatori dasselbe in der genau gleichen Abfolge – nur dass dieser Film rückwärts und spiegelverkehrt abläuft (und dass sich die Frau hier mit Zucker statt mit Wasser duscht). In der Hälfte des Clips überkreuzen sich die beiden Geschichten, die Protagonistinnen wechseln die Seiten und also gleichsam auf die andere Seite des Spiegels, der dieser Clip ist. Damit kehrt sich auch der jeweilige Bewegungsmodus von Film und Figur ins Gegenteil: Der Film, der bislang links ablief, rollt jetzt in der rechten Bildhälfte spiegelverkehrt an seinen Anfang zurück, und der Film, der bislang in der rechten Bildhälfte spiegelverkehrt im Rückwärtsmodus abrollte, läuft jetzt links dem Ende entgegen, das sein Anfang war.
Das klingt genauso kompliziert, wie es ist, und in einem noch strengeren Sinn als im Clip zu Bachelorette vollzieht sich auch in der Spiegelgeschichte, die Gondry in Sugar Water vorführt, eine narrative Kreisbewegung – allerdings eine, die letztlich nicht einfach zurück zum Anfang führt, sondern eine, die Anfang und Ende schlechterdings suspendiert. Nun darf man nicht den Fehler machen, diese zirkuläre Struktur als selbstzweckhafte Spielerei zu sehen; denn wenn dieser Clip als potenziell endlose Erzählschlaufe funktioniert, wird damit das Rotationsprinzip von MTV auf die Spitze getrieben. So wird die kulturelle Ökonomie von MTV gleichermassen bedient und entlarvt durch diesen Clip, der in jeder Hinsicht um seine eigene Achse rotiert.12 Und insofern ist dieses Video auch radikaler Pop, weil es Pop gewissermassen beim Wort nimmt: Genauso, wie sich das Palindrom «Pop» von hinten wie von vorne lesen lässt, funktioniert auch dieser Clip auf der Bildebene von hinten wie von vorne genau gleich.13
Eine einfachere Variante einer zirkulären Erzählstruktur hat unlängst Jamie Thraves mit seinem Clip zum Song The Scientist (2002) von Coldplay gezeigt, einer Ballade, in der Chris Martin von der Unmöglichkeit singt, eine gescheiterte Beziehung in einer Kreisbewegung zurück an ihren Anfangspunkt zu führen. «Running in circles / Chasing our tails», singt er da und beschwört das unmögliche Zurückspulen zum Beginn der Liebe: «Oh take me back to the start». Im Clip nun wird ihm dieser Wunsch erfüllt, denn auch dieser Film spult sich zurück, zeigt also Chris Martin, wie er rückwärts durch die Welt geht.14 Gegen Ende seines Wegs kommt der Sänger auf eine Waldlichtung, wo das Wrack eines Autos und eine tote Frau am Boden liegen, und hier macht sich dann in Zeitlupe der Autounfall rückgängig, der die Freundin des Stars in den Tod gerissen hat, während er selber unverletzt geblieben ist. Wenn die beiden am Schluss dieser filmischen Rückgängigmachung nebeneinander im Auto fahren, ist dies das glückliche Ende des Films und insofern ein klassisches Happyend. Mit dem Schlussbild vom glücklichen Paar benutzt der Clip zu The Scientist also eine konventionelle Formel aus dem klassischen Erzählkino, doch dadurch, dass sich der Film zurückspult, wird das Happyend hier als Auftakt zur Tragödie umgedeutet, weil es in der eigentlichen Chronologie der Ereignisse den Beginn des Verlustes markiert. Der Clip erzählt insofern vom Erzählen selbst, als er eine der ältesten Konventionen des Kinos einer Umwertung unterzieht – und damit geht er auch über die blosse zitathafte Aneignung der Ikonografie des Erzählkinos hinaus, von der im Zusammenhang mit Musikvideos so oft die Rede ist.
Das gilt auch für Jonathan Glazers alptraumartiges Musikvideo zu Rabbit in Your Headlights (1998) von Unkle. Glazer verdichtet hier mehrere Narrative zu einem intertextuellen Zeichenkomplex, der zunächst lediglich eine wörtliche Inszenierung der Titelzeile des Songs zu sein schient: Das Sprachbild vom Kaninchen im Scheinwerferlicht wird hier übersetzt in das Drama eines zerlumpten Mannes in einer Kapuzenjacke, der durch ein Strassentunnel hastet, gejagt von den Scheinwerfern der Autos, die ihn passieren. Deren Motoren- und Hupgeräusche übertönen immer wieder den Song, ebenso wie die Stimme des Kapuzenmannes, der unverständliches Zeugs murmelt und mitunter Laute ausstösst, die wie Verwünschungen klingen. Bleibt dieser Irrläufer im Tunnel zunächst noch unberührt, so wird er bald immer wieder von vorbeifahrenden Autos gerammt, aber auch wenn sein Körper dabei in grotesken Verrenkungen durch die Luft katapultiert wird, richtet er sich immer wieder auf und eilt unversehrt weiter wie eine Figur in einem Videogame. Wenn man nun aber unter der Kapuze den französischen Schauspieler Denis Lavant erkannt hat, erweist sich dieses Szenario serieller Kollisionen als albtraumhafte Um- und Weiterschrift der Anfangsszene von Les amants du Pont-Neuf (Leos Carax, F 1991). Denn auch dort spielt Denis Lavant einen Clochard, der anfangs auf offener Strasse von einem Auto angefahren wird.15 Mit diesem Filmzitat kommt aber auch der Schauplatz Paris ins Spiel. Und indem Glazer den Ort der Kollisionen in einen Tunnel verlegt, ruft er eine weitere Referenz auf, nämlich jenen tödlichen Unfall, der im Jahr vor der Veröffentlichung von Rabbit in Your Headlights zu einem internationalen Medienereignis wurde. In einem Pariser Strassentunnel kam Prinzessin Diana ums Leben, bei einem Autounfall auf der Flucht vor den Blitzlichtern der Paparazzi – und damit bringt uns der Clip wieder zurück in den Text des Songs, in dem Thom Yorke von Radiohead singt: «I’m a rabbit in your headlights / Scared of the spotlight». Und ein paar Zeilen weiter könnte er auch von der «Queen of Hearts» singen, wenn es heisst: «She laughs when she’s crying / She cries when she‘s laughing». Glazers Musikvideo zu Rabbit in Your Headlights ist also aus drei narrativen Strängen gebaut, die ineinander greifen wie in einem borromäischen Knoten, der zerfiele, sobald auch nur eine der Schnüre zerschlagen würde. Und für diesen komplexen Knoten aus Songtext, filmischem Intertext und dem Tod von Lady Diana als massenmedialem Referenztext fungiert die Musik als Bindemittel.
Dass ein Musikvideo fürs Erzählkino seinerseits zu einem eigentlichen filmhistorischen Bindemittel werden kann, zeigt schliesslich Spike Jonzes Clip zu It’s Oh So Quiet (1995) von Björk. Wenn die Sängerin hier in Zeitlupe durch stille Alltagsszenen spaziert, bis sich jeweils im Refrain die Passanten zu einer Tanzgruppe formieren und wie in einem klassischen Hollywood-Musical die Protagonistin tänzerisch umschwärmen, kann man in diesem Clip zweifelsfrei einen Anstoss für Lars von Triers Neo-Musical Dancer in the Dark (Dänemark u.a. 2000) erkennen. Dort feiert wiederum Björk als Hauptdarstellerin die Verzauberung ihres Alltags durch Musical-Fantasien, und die Freundin an ihrer Seite, die sich jeweils nur widerwillig auf die Lieder einlässt, wird gespielt von Catherine Deneuve. Das ist nun deshalb von Bedeutung, weil schon It’s Oh So Quiet von Spike Jonze eine Hommage an das Musical Les parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, F/BRD 1964) war, in dem Deneuve die Hauptrolle spielte.16 Und hier zeigt sich denn, dass das Musikvideo längst nicht mehr nur ein einseitig parasitäres Verhältnis zum Erzählkino pflegt, indem es dessen Ikonografie plündert und zu Parodien und Pastiches verarbeitet. It’s Oh So Quiet ist ein intertextueller Knotenpunkt, der nicht einfach zitathaft auf die Filmgeschichte zurückverweist, sondern der seinerseits das Kino inspiriert hat.
So prägen Clipregisseure wie Jonze, Glazer und Gondry mit ihrem narrativen Bewusstsein ihrerseits das Erzählkino – und zwar gerade auch dort, wo man das auf den ersten Blick gar nicht sieht, weil die Filmbilder nicht frenetisch flackern, wie man das von MTV zu kennen meint. Denn MTV hat nicht nur die Sehgewohnheiten verändert, wie es immer heisst, und es bedeutet auch nicht einfach die Zerstückelung des Erzählens in einer Ästhetik der Beschleunigung. Vielmehr haben Filmemacher der Generation um Jonze, Glazer und Gondry aus dem eigentlich paradoxen Verhältnis zwischen Musikvideo und Erzählung einen hochgradig selbstreflexiven Umgang mit Narration entwickelt, der keineswegs den Untergang des Erzählens bedeutet. Im Gegenteil: Indem sie sich MTV als Testgelände des Erzählens zunutze machen, steigern sie mit ihren Clips die narratologische Kompetenz des Publikums. Das darf man durchaus als Versprechen für das Erzählkino sehen, wie es sich um diese Clipregisseure nun allmählich herausbildet – ein Erzählkino, das viel von MTV gelernt hat, auch wenn man ihm das äusserlich nicht ansieht, weil es in seiner Bildsprache gerade nicht den gängigen Vorstellungen einer Clipästhetik entspricht.17