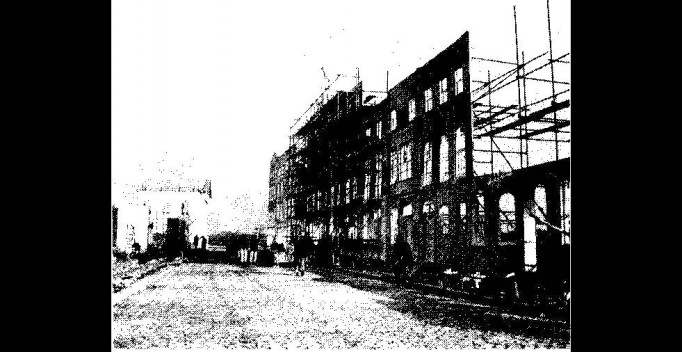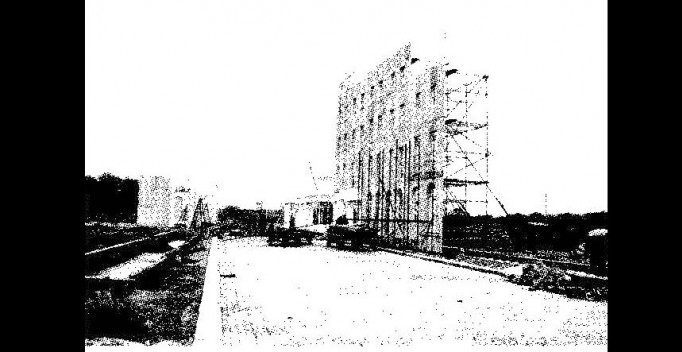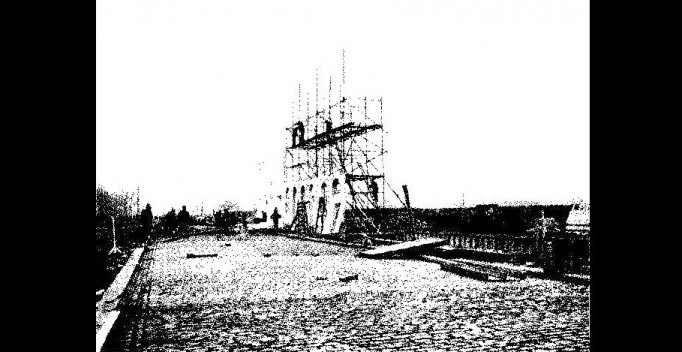„,Ich lobte an den Franzosen’, sagte ich,,daß ihre Poesie nie den festen Boden der Realität verläßt. Man kann die Gedichte in Prosa übersetzen und ihr Wesentliches wird bleiben‘“
-Johann Peter Eckermann1
Wenn Agenturen Ende 1993 den Tod des französischen Ausstatters Alexandre Trauner am 6. Dezember 1993 vermeldeten, dann ist daran das Datum zutreffend. Falsch ist die Nationalität und unpräzise die Berufsbezeichnung. Der Irrtum hinsichtlich der Nationalität kommt nicht von ungefähr: Die französische Kapitale adoptierte - gerade in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts - mit großer Nonchalance nichteinheimische Künstlerpersönlichkeitcn. Pablo Picasso, Max Ophüls, Salvador Dali, Romy Schneider, Alberto Giacometti und Luis Bunuel waren dabei nur die prominentesten.
Alexandre Trauner - am 3. September 1906 in Budapest als Sohn einer jüdischen Schneiderfamilie geboren - war tatsächlich Zeit seines Lebens ein „Gesinnungspariser“. 1928, mit dem Aufziehen des Horthy-Faschismus, flüchtete der damalige Kunststudent nach Wien und setzte sich dort, anders als viele seiner Studienkollegen, die Moholy Nagy zum Dessauer Bauhaus folgten, in den Zug nach Paris. Einem vitalen Bedürfnis folgend, strebte er der Heimat von Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Aristide Maillol und vor allem Henri Matisse zu.2
Und schließlich: seine Bauten für Filme - von Sous les toits de Paris (René Clair, 1930), an dem er als Assistent von Lazare Meerson arbeitete, über Hôtel du Nord (Marcel Carné, 1938) und Les portes de la nuit (René Clair, 1946) sowie Irma la douce (Billy Wilder, 1962) und Du Rififi chez les hommes (Jules Dassin, 1954) bis Subway (Luc Besson, 1985) und Autour de minuit (Bertrand Tavernier, 1986) - haben wesentlichen Anteil an dem Bild, welches sich das Kino von Paris gemacht hat: Träume aus Gips, Licht und Wind, wie es Jacques Prévert, Weggefährte über viele Jahre, in einem Gedicht3 über den Szenenbildner Trauner genannt hat, womit hier fürs erste auch seine profession umschrieben sein soll.
I
„In einem Hotelzimmer eines dicht bewohnten Vorstadtviertels streckt ein Mann einen anderen durch einen Revolverschuß nieder. Die Polizei verhaftet den Mörder, der sich widersetzt und Verteidigungsstellung bezieht. Die Belagerung dauert eine Nacht, in deren Verlauf François (Jean Gabin) die einfache und schmerzliche Geschichte seiner Liebe, die ihn zum Mörder gemacht hat, an sich vorüberziehen läßt, um dann bei Anbruch des Tages zum Selbstmord zu schreiten.“4
So beschrieb André Bazin die Handlung von Le jour se lève (Marcel Carné, 1939) und fährt an späterer Stelle fort:
„Man sieht, wie der Realismus Carnés es versteht, indem er der Wirklichkeit der Ausstattung treu bleibt, dieselbe poetisch umzugestalten, nicht indem er sie durch eine förmliche und bildliche Umwandlung verändert, wie es der deutsche Expressionismus tat, sondern indem er die den Gegenständen innewohnende Poesie löst und sie zwingt, ihre geheimen Beziehungen zur Handlung zu enthüllen. In diesem Sinne kann man von einem ‚poetischen Realismus' sprechen [...]. Das Vollkommene in Le jour se lève ist die Tatsache, daß die Symbolik nie der Wirklichkeit vorauseilt, sondern sie gewissermaßen ergänzt.
Man beachte auch den Ort der Handlung (die Banlieue von Paris), die Wahrheit der Dekoration, das zum Himmel aufstrebende Gebäude. Man sollte meinen, daß dieser aussätzige Ort häßlich sei. In Wirklichkeit haben wohl die meisten Zuschauer eine paradox erscheinende poetische Stimmung empfunden. Vielleicht deswegen, weil die Dekoration den meisten echt erschien. Und doch handelt es sich um eine künstliche Dekoration, die vollständig im Studio entworfen wurde.
Wir rühren hier an ein wichtiges Ausstattungsproblem des Films. Wir sagten schon, daß er realistisch und peinlich wirklichkeitsgetreu sein müsse. Wenn man aber an Ort und Stelle in einer Vorstadt filmen würde, die der des Films ähnlich wäre, dann würde der Film wahrscheinlich einen viel weniger ‚echten’ Eindruck machen, weil sich die Gegenstände weniger der Handlung anpassen und nicht jene bittere Poesie der Dekoration Trauners ausatmen würden. Um wirklichkeitsgetreu zu erscheinen, muß die Dekoration als abhängig von der Handlung aufgefaßt werden. In einer natürlichen Dekoration wäre es auch unmöglich, die Kameraeinstellung den Bedürfnissen entsprechend zu wählen und die Scheinwerfer so genau einzustellen. Diese technischen Gründe würden allein schon genügen, um einen künstlichen Aufbau zu rechtfertigen, aber es kommt noch mehr hinzu. Als Trauner diesen Ort der Banlieue von Paris zeichnete, hat er wie ein Maler sein Bild entworfen. Indem er sich ganz den Forderungen der Wirklichkeit unterwarf, hat er ihr doch gleichzeitig diese poetische Deutung zu geben verstanden, die keine bloße Rekonstruktion darstellte, sondern ein Kunstwerk.“5
Der Großteil von Le jour se lève spielt sich in François’ Mansarde ab; oben, hoch oben, in einem Haus, das wie gegen das Querformat der Leinwand gebaut zu sein scheint. So wird die tragische Entrückung aus seiner Verankerung im quartier populaire unmittelbar sinnfällig. Der Schauplatz ist allegorisch, pure Poesie auf dem Boden der Realität.
Alexandre Trauner rückblickend:
„Dieses hohe Haus, das war nicht bloß so eine Idee. Das kam aus der Geschichte. Bei diesem Film gab es um jeden Zentimeter und wegen jeder Etage ein erbittertes Feilschen. Der Produzent hätte das Ganze am liebsten im Erdgeschoß spielen lassen. Schließlich gestand er uns wenigstens drei Stockwerke zu, aber nur indem er drohte: ‚Auf die oberen beiden Stockwerke müssen Sie einfach verzichten, sonst bringe ich mich um.’ Worauf ihm Jacques Prévert (Autor des Drehbuchs) nur sagte: ‚Es gab Schauspieler, Croupiers, Metroschaffner, die sich umgebracht haben, aber noch nie einen Filmproduzenten/ Schließlich bauten wir das Haus doch mit fünf Stockwerken. In der Geschichte ist ja Gabin schon allem Diesseitigen enthoben. ‚Der Mann da oben’, so hieß es im Drehbuch. Dieser Satz erforderte eine räumliche Distanz zwischen den vielen auf dem Platz und dem isolierten Einzelnen. Es war notwendig, dieser dramaturgischen Vorgabe Rechnung zu tragen und sie in eine räumliche Komposition einzuarbeiten. Später drehte Anatole Litvak ein Remake des Films mit Henry Fonda: The Long Night (1947). Sie haben das Zimmer im ersten Stock angesiedelt, und es hat nicht funktioniert! Die Geschichte war gut entwickelt, aber dem Ganzen fehlte die Kraft. Es ging von der Psychologie her nicht auf!“6
Ein ganzes Jahrzehnt im Schaffen von Alexandre Trauner stand unter dem Stern der Zusammenarbeit mit Jacques Prévert, dessen Höhepunkt wohl 1943/44 Les enfants du paradis (Marcel Carné, 1945) war. Der Film ist, obwohl unter äußerst prekären politischen und persönlichen Umständen entstanden - Trauner hatte während der deutschen Okkupation Frankreichs offiziell Arbeitsverbot -, in seiner Erinnerung ein glückliches Ereignis:
„Jacques Prévert kam ständig mit irgendeiner Idee: ‚Was hältst du davon? Wie könnte das aussehen?’ Dann zeichnete ich etwas, versuchte, seine Idee in der Erscheinung hervortreten zu lassen, gab bestimmte räumliche Anhaltspunkte, brachte diesen oder jenen ‚Schlenker’, den er wie das Ende eines Fadens aufnahm: ‚Und wenn man es so machen würde?‘ Es war eine enge Zusammenarbeit, gründend auf Freundschaft und professioneller Wertschätzung. Joseph Kosma, der Komponist, war auch da und gab eine Melodie dazu, aus der sich für mich und für Jacques eine Variation des ursprünglich Gedachten ergab etc.“7
Beim Durchblättern des prächtigen Albums Décors de cinéma fällt auf, wie sehr Trauner seine Arbeit im Zeichen des Zufalls und der Freundschaft sah und wie sehr sein Leben mit dem anderer verwoben war. Er zitierte Pierre Prévert, den Filmregisseur und Bruder von Jacques: „Kein Künstler, der nur aus seiner eigenen Kraft und Kreativität schöpft, er bedient sich auch der Phantasie und Intelligenz seiner Freunde. Ein Lügner, wer das Gegenteil behauptet.“8
In Frankreich, wo die Sichtweise von Film als einer kollektiven Anstrengung unterschiedlichster Spezialisten eine größere Geläufigkeit hat als im deutschsprachigen Raum - man vergegenwärtige sich nur noch einmal die Selbstverständlichkeit, mit der Bazin dem Szenenbild von Le jour se lève Rechnung trug -, galt Trauner seit je als Monument national der französischen Filmgeschichte oder vielmehr als Homme de phare, wie ihn Bernard Pivot in seiner Fernsehsendung Bouillon de culture beschrieb und der steifen Ehrung die Handfestigkeit eines Adieus einzugeben vermochte.
Was mich bei der Durchsicht der Filmographie von Alexandre Trauner immer in Erstaunen versetzt hat, war neben der schillernden Aufeinanderfolge klangvoller Regienamen die Deutlichkeit und die Unwillkürlichkeit, mit denen bereits die Buchstabenfolge einzelner Titel Eindrücke von Schauplätzen in der Erinnerung erzeugte: den übermütigen „Boulevard du crime“ aus Les enfants du paradis natürlich, den Zauberwald mit der freundlichen Waldlichtung aus Juliette ou la clé des songes (Marcel Carné, 1951 ), den ausgeklügelten Sandmechanismus im Inneren der Pyramiden aus Land of the Pharaos (Howard Hawks, 1955) oder auch die schäbigen Latrinen direkt unter dem Schlafzimmerfenster des Kolonialbeamten aus Coup de torchon (Bertrand Tavernier, 1981).
II
Poetischer Realismus, dieser Begriff bezeichnet, über die französischen Filme der dreißiger Jahre hinaus, die Gesamtheit von Trauners Arbeiten. Sie haben immer, und immer mehr als die anderer Szenenbildner, dazu herausgefordert, sie als interaktiven Beitrag bei der Erarbeitung von Filmen zu sehen, unter anderem wohl auch deshalb, weil der Zufall ihn immer wieder zu Regisseuren verschlug, die trotz einem gehörigen Maß an Skepsis bereit waren, sich seinen Visionen anzuvertrauen, zum Beispiel Billy Wilder: „Nennen Sie es,das dritte Auge', diese erstaunliche Befähigung, die Visualisierung der Dinge durch das Objektiv der Kamera direkt zu antizipieren. Es ist vorgekommen, daß ich das bizarre Arrangement, das er für die Lösung eines Problems vorgeschlagen hat, in Zweifel zog: ‚Holla Trauner, die Treppe ist aber danebengegangen. Die ist völlig krumm! Man kommt sich ja vor wie im schiefen Turm von Pisa.' Worauf er nur antwortete: ‚Wart es ab, bis du es auf der Leinwand siehst.' Und tatsächlich, dieser Schlingel hatte wieder recht!“9
Mitunter kann er gar als genuiner Mitautor seiner Filme angesehen werden. Gewiß bei Quai des brumes (Marcel Carné, 1938), diesem grandiosen und mit Einverständnis des Schriftstellers unternommenen Betrug an der Romanvorlage10, aber in anderer Weise auch bei The Apartment (Billy Wilder, 1960) und Irma la douce (Billy Wilder, 1963). Mit seinen Sets, zumal jenem „größten Büro der Welt“ (The Apartment) oder der Rue Casanova und dem Bauch von Paris (Irma la douce), schuf Trauner Bilder von Bildern, filmische Chiffren, die das Singulär-Universale der Geschichten, denen sie als Schauplatz dienen, mitformulierten.11
Trauner war ein Meister des Destillierens. Oft sind es minimale Verschiebungen, absichtsvoll arrangierte, aber immer den Eindruck des Beiläufigen vermittelnde Details, die seine Szenerien so echt erscheinen lassen. „Man kann nicht umhin“, schrieb Gerd Midding, „die Genauigkeit zu bewundern, mit der er einzelnen Details nachgeht: im ersten Akt von Irma la douce wünscht sich die Titelheldin von ihrem Zuhälter einen Haartrockner, den zu kaufen er jedoch ablehnt; später, als Jack Lemmon ihre Geschäfte übernommen hat, steht ein Haartrockner - von der Kamera fast unbemerkt - in ihrem Schlafzimmer.“12
Billy Wilder ist neben Jacques und Pierre Prévert der dritte Fixstern im Leben und Werk Trauners. „Les années Wilder“ nennt er die Zeit zwischen 1956 und 1964. Billy Wilder ist ebenso wie Alexandre Trauner Mitteleuropäer jüdischer Abstammung, und beide sind sie Jahrgang 1906. In Hollywood hießen sie auch „the funny European twins“.
III
brüderlichen Blick der Komplexität und den psychologischen Fallen, die das alltägliche Verhalten der Menschen unter der Okkupation bestimmt haben, Rechnung tragen. Trauner schilderte mir seine konzeptionellen Überlegungen pragmatisch und unbefangen: „Entscheidend war, daß der Film wahrhaftig erscheint, nicht daß er realistisch ist. Ich bin sicher, daß wir, was die Fakten angeht, nicht hundertprozentig korrekt waren, aber er war stimmig hinsichtlich der dramatischen Wirkung. Monsieur Klein ist ein junger und charmanter Bonvivant, kultiviert und kaufmännisch talentiert. Aber auch ein Blender und Profiteur, der selber in die Mühlen gerät, die ihm ein gewisses Wohlleben ermöglicht haben. Als wir anfingen, hatten wir eine ungeheure Fülle von Material über die damalige Zeit. Ich versuche immer, eng an meiner Dokumentation entlang zu arbeiten, wohlwissend, daß am Ende doch etwas ganz anderes herauskommen wird. Mir ging es nie um Vollständigkeit, sondern darum, einige visuelle Anhaltspunkte aufzubauen und darüber Verständnis zu erzeugen. Wenige exakt gesetzte Details - das kann ein Feuerzeug sein oder die Gare de l’Est - tragen mehr zur Einprägsamkeit von Filmen bei als überbordende Fülle.“
Die ersten Bilder des Appartements von Monsieur Klein vermitteln einen unmittelbaren Zugang zu Anlage, sozialer Stellung, Psychologie und Charakter.13 Später liefert der Zustand der Wohnung - sie leert sich zusehends und macht irgendwann den Eindruck, als sei sie schon aufgegeben - zum Teil diskrete, zum Teil frappierende Auskünfte über die augenblickliche Befindlichkeit der Person und den Stand der Geschichte.
Wie aber realisieren sich solch globale Erwägungen im Detail? Auf welche Weise vermögen die oben erwähnten Gaukeleien des Bildners Trauner einen neutralen Raum in eine eloquente Dekoration zu wandeln? Ein Blick zurück: Seine ersten Jobs in den Filmstudios von Paris verdankte der junge Kunstmaler seiner Fähigkeit, Perspektiven glaubwürdig zu fälschen. Zwei Szenen, die bleiben: Sie stammen aus A nous la liberté (René Clair, 1931), einem der ersten Filme, für deren Einrichtung Trauner als Assistent von Lazare Meerson verantwortlich war. Sie zeigen die Fertigungshalle einer Phonographenfabrik und den Arbeitsraum eines Gefängnisses, beides streng diagonale Kompositionen mit gemalten Hintergründen, die den Raum optisch noch weiter verlängern. Beide Sets wurden bereits perspektivisch verzerrt gebaut, und nicht nur das: die Menschen, die diese Szenerie bevölkerten, wurden entsprechend ihrer Größe plaziert, Männer von großem Wuchs im Vordergrund, kleinere Erwachsene in der Mitte und Kinder im Bildhintergrund. Dieser List bediente sich Trauner virtuos und immer wieder, bis zu seinen letzten Filmen.14
Ein Großteil seiner Zeichnungen und Skizzen ist geprägt von rasanten Diagonalen, und mitunter hat mich erstaunt, wie sehr die fertigen Einstellungen neben Gestalt und Atmosphäre gar Linienführung und Komposition des Gezeichneten aufgenommen haben. Trauners Skizzen sind keine neutralen Ansichten, sondern evidente Szenenbilder - Bildvisionen, die zum einen das Aroma der künftigen Filme in sich tragen, zum anderen, wie nebenbei, auch schon Erwägungen über Kamerastandpunkt und Lichtsetzung beinhalten, zumal dann, wenn es darum ging, Schauplätze bereits perspektivisch forciert zu bauen.15
Viele seiner Szenenbilder - gleich, ob als Zeichnung oder gebaut - laufen, Tiefe vortäuschend, auf einen fernen Punkt zu. Manche machen den Eindruck von diagonal ins Fremdland implantierten Schauplätzen.16 Andere ziehen den Blick mittels Objekten oder graphischen Verstärkern diagonal zum Bildzentrum hin, wo sich dann Verzweigungen auftun,17 und wiederum andere setzen dominierend mittig verlaufende Trennwände. Das, was auf den ersten Blick lediglich bildstrukturierende Funktion zu haben scheint, ist jedoch selten ein acte gratuit, sondern, wie Bertrand Tavernier anläßlich Coup de torchon schildert, eine Lösung, die sich aufs engste mit der Handlung und ihrer Inszenierung zu verschmelzen sucht:
„Trauner kommt sofort zum Wesentlichen. Er hebt ein Detail hervor, das ein Dekor auf eine Weise organisch macht, die weit über oberflächlichen Realismus hinausgeht. [...] Sein Stil? Eher ‚Beiseiteräumen’ als,Auftürmen'. [...] Bei den Dreharbeiten zu Coup de torchon hörte er mir aufmerksam zu, als ich ihm den Gehalt einer Szene erklärte, bei der es mir darum ging, die Distanz der Personen zueinander spüren zu lassen. Daraufhin baute er mir eine Trennwand mitten ins Zimmer. Ich wehrte mich, da ich den sowieso spärlich bemessenen Platz auf die Hälfte schrumpfen sah, aber als sein Set fertig war, ging mir auf, daß er mir die Möglichkeit gegeben hatte, die Trennung der Personen physisch auszudrücken, und gleichzeitig ergab sich daraus auch der Rhythmus meiner Einstellungen.“18
Am schönsten sind seine Schauplätze, wo sie Architekturen gegen die Regeln der Architektur sind, vorgebend, sie seien nicht gebaut, sondern entstanden; wie ein Korallenstock vielleicht, der bei jedem neuen Anblick überraschend ist und gleichzeitig überraschend bekannt erscheint. Diese Architekturen besitzen einen Schimmer, der auch für stumpfe Augen sichtbar wird. Ihnen sind alle märchenhaften Eigenschaften sowie die Glaubwürdigkeit von Märchen zu eigen. Sie sind gleichermaßen bigger than life wie plus vraie que nature.
Von Modellen hielt er wenig. Sie hatten für ihn Berechtigung in der Architektur. Auch beim Theater oder als internes Arbeitsmittel. Aber nicht um ein Filmszenenbild zu repräsentieren: „Es ist ein totaler Irrtum, wenn man glaubt, Modelle würden eine genauere Vorstellung von einer Szenerie erzeugen können. Diese entfaltet ihren Zauber ausschließlich in der Zweidimensionalität, welche Kniffe in der Dreidimensionalität dazu geführt haben, ist unerheblich. Man sieht das meiste von oben oder von außen, und man erfährt nichts über die Komposition. Kein außenstehender Betrachter kann den Blickpunkt der Kamera in der fertigen Dekoration einnehmen, und die wenigsten können deren Blick antizipieren. Generell ziehe ich eine Illustration vor, weil darin bereits ein Standpunkt präsentiert ist.19 Außerdem vermittelt man bereits einen Eindruck von der Stimmung - den Farben und der Helligkeit sowie der Textur der Materialien.“ Hier wird noch einmal deutlich, was Billy Wilder mit dem „dritten Auge“, das er Trauner zuschrieb, im Sinn hatte.
IV
Dreimal bin ich Alexandre Trauner begegnet. Zuerst 1987. Nach One, two, three (Billy Wilder, 1961) hatte es ihn lediglich ein einziges Mal noch nach Berlin verschlagen. Jetzt drehte er hier, 27 Jahre nach der Billy-Wilder-Komödie, erneut einen Film: Reunion (1989) unter der Regie von Jerry Schatzberg, worin er auch eine kleine Rolle spielte. Komischerweise, so erzählte er mir, hat der Zufall verfügt, daß er immer einen Bogen um die Stadt machte. Zwar fand er sie immer sehr anziehend, allerdings, so fügte er hinzu, fand er sie um so anziehender, je weiter er von ihr entfernt war; da ginge es ihm wie Billy Wilder. Aufschlußreich erschien mir auch, daß er, obwohl des Deutschen mächtig, niemals deutsch sprach, am Set ebensowenig wie im informellen Rahmen. Er war von großer Herzlichkeit, aber zumindest über die Sprache, so schien es mir, wollte er etwas zwischen sich und den Deutschen wissen - später in Paris war von ihm durchaus der eine oder andere Satz in Deutsch zu hören. Reunion war sein letzter Film. Ihm folgte, was er „aktiven Ruhestand“ nannte: die Veröffentlichung seines Buches, die Beratung seines Stiefsohns Didier Naert, der ihm seit einigen Jahren assistierte und bei Reunion Art Director war, und schließlich die Begleitung und Erweiterung der Ausstellung seines zeichnerischen und malerischen Werks.
Eine zweite Begegnung fand in Paris statt, während eines Dinners bei Nadine Musté, Galeristin und rührige Kuratorin seiner Ausstellung. Damals kränkelte er, hatte aber einen gesegneten Appetit und versprach gar, beim nächsten Besuch sein goulasch au spaezle, von dem Billy Wilder so schwärmte, aufzutischen. Er freute sich königlich auf eine bevorstehende Marokko-Reise. Nach Marrakesch und Essaouira (dem früheren Mogador) zog es ihn - dort sind Teile von Arthur Joffés Harem (1985) und Orson Welles’ Othello (1952) entstanden -, wo er sich an der Farbigkeit und dem Licht des Maghreb zu laben gedachte und den unterbrochenen Dialog mit der Malerei von Matisse wieder aufnehmen wollte.
Und ein letztes Mal sah ich ihn 1989 in Gent bei der von Paris übernommenen Ausstellung „Cités-Cinés“, wo man gerade eine begehbare Dekoration mit dem Namen „Sur les toits de Paris“ gebaut hatte. Mit Mansarde und chambre de bonne, schön verwinkelt und gerade recht, um ein Paris-Feeling zwischen Tchao Pantin (Claude Berri, 1983) und Quatorze Juillet (René Clair, 1932) anzustacheln. Ich staunte, als ich feststellte, daß ihm das nicht besonders zusagte, „trop rétro“ befand er: zu museal, zu niedlich, zu harmlos. Nicht daß er sich von seiner eigenen Geschichte abschneiden wollte, er sah sich einfach nur ein halbes Jahrhundert weiter. Der aufgebaute Métrotunnel in der Ausstellung gefiel ihm dagegen ziemlich gut.
Schlußklappe
Der Zufall wollte - wieder der Zufall -, daß ich damals gerade Henry Millers Essay über Blaise Cendrars las, und es kam mir vor, als müßte er mit seiner Beschreibung des Dichters Cendrars ebenso den Bildner Trauner vor Augen gehabt haben: „Er lebt stets mit hochgeklapptem Visier; es ist fast so, als habe er in seinem Scheitel ein Extraauge verborgen, ein Oberlicht, das alle kosmischen Strahlen eindringen läßt. Sicher ist, daß solch ein Mensch sein Lebenswerk niemals vollenden wird, denn das Leben wird immer einen Schritt voraus sein. Das Leben kennt im übrigen keine Vollendung, und Cendrars ist eins mit dem Leben.“20