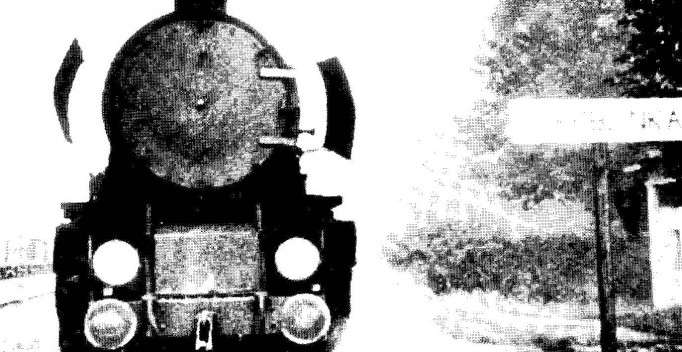Die Spuren, die heute noch an den Holocaust erinnern, drohen zu verschwinden. Die Zeitzeugen werden weniger. Vieles deutet in Europa auf ein mangelndes Geschichtsbewußtsein hin. Jugendliche „knallen sich an“ mit Bildern des Nationalsozialismus, die ihrem Bedürfnis nach Macht und Stärke entsprechen. Migranten und Randständige der Gesellschaft leiden sehr real unter ihrer Gewalt. Nationalistische Parteien gewinnen an Anhängerschaft. Die Rede von der „Auschwitz-Lüge“ trifft auf offene Ohren.
Die Auschwitz-Gedenkstätte ist vom Verfall bedroht. Der Norddeutsche Rundfunk rief im vergangenen Jahr mit einer Spendenaktion und zahlreichen Sendungen zu ihrem Erhalt auf.1 Unter dem Druck der Öffentlichkeit bewilligte die deutsche Regierung Gelder zur Rekonstruktion. Für KZ-Gedenkstätten in den neuen Bundesländern fehlten jedoch Mittel für Zuschüsse, ließ das deutsche Innenministerium verlauten. Andererseits plant die Bundesregierung für die „Neue Wache“ in Berlin eine „nationale Gedenkstätte“ für die Opfer des Zweiten Weltkriegs. Zwischen ermordeten KZ-Häftlingen und getöteten Wehrmachtssoldaten wird dabei - vorerst - nicht unterschieden. Die Gegensätze zwischen Tätern und Opfern werden auf diese Weise verdeckt. Für die Überlebenden des Holocaust und ihre Nachfahren wäre ein derartiges Denkmal wie ein Schlag ins Gesicht.
Dokumente, die an den deutschen Faschismus und die Vernichtung von Millionen von Menschen erinnern, gewinnen in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Drei Filme aus den achtziger Jahren haben auf jeweils verschiedene Art diese Themen aufgearbeitet und sind ungebrochen aktuell: Der Prozeß (1984) von Eberhard Fechner, Shoah (1985) von Claude Lanzmann und Hotel Terminus (1988) von Marcel Ophuls. Alle drei Filme sind von komplexem Inhalt und geradezu „epischem“ Umfang: Der Prozeß dauert viereinhalb Stunden, Shoah neuneinhalb Stunden und Hotel Terminus ebenfalls viereinhalb Stunden. Über der inhaltlichen Beschäftigung mit diesen Filmen ist das Problem einer ästhetischen Auseinandersetzung mit Holocaust und Faschismus manchmal zu kurz gekommen. Doch Erinnerungsarbeit ist sehr weitgehend eine „Arbeit“, das heißt: eine Frage der Mittel, die verwendet werden. Sowohl Fechner als auch Lanzmann und Ophuls haben sich immer wieder dagegen verwahrt, „Dokumentarfilme“ mit einem Objektivitätsanspruch zu machen.
Sie bestehen auf der Artifizialität ihrer Filme, dem gestaltenden Umgang mit Dokumenten und Interviews darin. Auf welche Weise sie im einzelnen vorgegangen sind, werde ich im folgenden untersuchen.
Eine andere Art zu erzählen
Eberhard Fechner ist im August des letzten Jahres gestorben. Den Prozeß hat er mehrfach als seinen wichtigsten Film bezeichnet. Er befaßte sich darin mit dem längsten und umfangreichsten Prozeß in der deutschen Rechtsgeschichte, der von 1975 bis 1981 in Düsseldorf gegen Angehörige der Wachmannschaft des Lagers Lublin-Majdanek geführt wurde. Fechner wurde vom Norddeutschen Rundfunk beauftragt, einen Film über diesen Prozeß zu drehen. Insgesamt acht Jahre lang arbeitete er daran. Der Film ist in drei Teile von je 90 Minuten Länge gegliedert. Im Mittelpunkt stehen Interviews, die mit 70 Personen - Angeklagten, Zeugen, Anwälten, Staatsanwälten, Prozeßbeobachtern und dem Richter - geführt wurden.
Fechner war einer der ersten Filmemacher, die die Methode der Zeitzeugenbefragung einsetzten, um Geschichte aufzuarbeiten. In den 60er und 70er Jahren gab es in der Bundesrepublik Deutschland vor allem die sogenannten „Kompilations-“ oder „Umwertungsfilme“, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzten. Sie montierten Wochenschau- und Archivmaterialien um, versahen sie mit neuem Kommentar und neuer Musik.2 Das änderte jedoch nichts an der faschistischen Ästhetik der Bilder, die für Propagandazwecke der Nationalsozialisten hergestellt worden waren. Es blieb ein Problem, Bilder zu finden, die etwas von der Unterdrückung und Gewalt im deutschen Faschismus verrieten.
In Klassenphoto (1975) entwirft Fechner aus den Lebensgeschichten deutscher Bürger das Bild einer Generation. Mit den vielen „kleinen“ persönlichen Geschichten erzählt er die „große“ Geschichte. Diese Methode nutzt er auch in Der Prozeß. Durch die Zeitzeugenberichte „spiegelt“3 Fechner die Geschichte des Lagers Lublin-Majdanek in seinen Film hinein. Er verzichtet weitgehend auf einen Kommentar, und seine Interviewfragen sind durch den Schnitt ausgespart worden. Der Film wird durch 31 „Kapitelüberschriften“ inhaltlich gegliedert. So entsteht zunächst der Eindruck, als nehme sich Fechner gänzlich zurück und überlasse den Erzählenden im Sinne einer „Geschichtsschreibung von unten“ das Wort. Er führt als ein Vorbild für seine Vorgehensweise ein Zitat von Cechov an: „Der Künstler soll nicht Richter seiner Personen sein, sondern nur ein leidenschaftsloser Zeuge. Beurteilen werden es die Geschworenen, das heißt die Leser. Meine Sache ist nur, die Fähigkeit zu besitzen, die wichtigen Äußerungen von den unwichtigen zu unterscheiden und sie in Beziehung zueinander zu setzen.“4 Doch Fechner untertreibt. Er ist durchaus nicht nur „leidenschaftsloser Zeuge“ in seinen Filmen. Die Aussagen „seiner Personen“ benutzt er nach eigenen Angaben „wie einen Steinbruch“5 und konstruiert daraus seine Sicht der Dinge. Mit Hilfe seiner langjährigen Cutterin Brigitte Kirsche hat Fechner aus der Fülle von Material, dem Ertrag aus 70 Interviews, ein „Mosaik“ zusammengestellt, das zum Teil aus winzigen „Interviewschnipseln“ besteht. Durch die Montage entsteht der Eindruck, als säßen die Erzählenden bei einem Gespräch zusammen. Ein Sprecher schneidet dem anderen scheinbar das Wort ab oder ergänzt die Aussage seines Vorredners oder seiner Vorrednerin. Die Bemerkungen der Täter werden durch ihre Nachredner korrigiert. Fechner konfrontiert sich widersprechende „Gesprächsbeiträge“ miteinander und läßt sie von anderen Sprechern kommentieren. Auf diese Weise tragen alle Personen zur Rekonstruktion von Geschichte bei. Vor den Augen der Zuschauer entsteht ein „Puzzle“ aus „Erinnerungssteinen“.
Fechners stark eingreifender Umgang mit seinem Filmmaterial hat ihm den Vorwurf eingebracht, sein Verfahren sei nach Oral-history-Gesichtspunkten unzulässig, Gesprächsaussagen dürften nicht von ihrem Kontext isoliert verwendet werden. Seine Filme seien letztendlich gar nicht „dokumentarisch“. Doch Fechner hatte nicht den Anspruch, „Interview-Dokumentarismus“ zu betreiben, sein Ziel waren „filmische Erzählungen“.6
Anfangs hatte Fechner vor, einen Film über den Prozeß selbst und einen anderen über das Vernichtungslager Lublin-Majdanek zu drehen. Tatsächlich ist es ihm aber geglückt, beides zu verbinden. Jede der drei Folgen beginnt mit einer Einstellung des Lagers Majdanek, das (mit Schwarzweißmaterial gefilmt) von oben aus dem Flugzeug zu sehen ist. Eine Stimme berichtet aus dem Off, das Lager habe von 1941 bis 1944 bestanden. Die nächste Einstellung zeigt (in einer Farbaufnahme) den leeren Gerichtssaal. Die Stimme erzählt, der Prozeß gegen Angehörige des Lagers habe im Zeitraum von 1975 bis 1981 stattgefunden. Die inhaltliche Dualität des Films ist also von vornherein festgelegt. Am Anfang jedes Teils wird zunächst von dem Verfahren in Düsseldorf berichtet, um dann - notwendigerweise - auf die Vergangenheit zu kommen.
Auf der Bildebene verwendet Fechner - neben Tagesschaumaterial über den Prozeßverlauf und „Hals-Nasen-Ohren-Bildern“, wie er die Aufnahmen von den Sprechenden selbstironisch nannte7 - Aufnahmen aus Jerzy Bossaks Film Majdanek: Friedhof Europas, der 1944 nach der Befreiung des Lagers entstand. Über die Aufnahmen legt er Bossaks Erzählung von der Befreiung des Lagers und den schrecklichen Entdeckungen, die er dabei machte. Mehr noch als der Zustand der Überlebenden und die halbverkohlten Leiber in den Krematorien habe ihn etwas anderes beeindruckt: die „ungeheuer großen“ und schönen Weißkohlfelder - sie waren mit menschlicher Asche gedüngt worden - und ein Gebäude, in dem wie in einem Warenhauslager peinlich genau geordnet Berge von Schuhen, Kleidern und Brillen lagen. Die häufig gezeigten Bilder verlieren in der Verbindung mit Bossaks Erinnerungen ihre metonymische Abgegriffenheit.
Die Erzählungen der Zeitzeugen werden von etwa 500 Fotos, die zwischen 1941 und 1944 in Polen aufgenommen worden sind, begleitet. Sie unterstützen die Aussagen der Opfer im „Dickicht“ der widerstreitenden Äußerungen. Auf ihnen wird sichtbar, was die Täter leugnen oder verdrängen. Zugleich verdeutlichen die Fotos eine Absurdität des Gerichtsverfahrens: Nach über 30 Jahren mußte den Angeklagten jede Tat unter Angabe von Name, Ort, Tatzeit usw. detailliert nachgewiesen werden. Verständlicherweise waren die Zeugen, die aus Polen, Israel und Amerika angereist waren und sich unter massivem psychischem Druck befanden, davon überfordert. Im Film bemerkt eine Zeugin zu dem paradoxen Umstand, ihre ehemaligen Peiniger namentlich identifizieren zu müssen: „Die haben sich nicht vorgestellt.“ Die Häftlinge gaben den Aufsehern Spitznamen: „Todesengel“ für den Aufseher Laurich, „Blutige Brigida“ für die Aufseherin Lächert. Fechner zeigt Fotos von Massenerschießungen und macht damit unmißverständlich klar, daß es im Verfahren nicht um die Privatsache einiger Angeklagter, sondern um eine Kollektivangelegenheit der Deutschen geht.
Der Prozeß in Düsseldorf war an ein umständliches Beweisführungsverfahren gebunden, der Film dagegen setzte den Prozeß der Erinnerung in Gang - bei Opfern wie Tätern. Im Verfahren verweigerten die Angeklagten fünf Jahre lang die Aussage. Im Film dagegen, der nicht im Gerichtssaal gedreht werden durfte, reden sie. Fechner sagte ihnen, er sei kein Richter - da öffneten sich Schleusen.8 Das Brechen ihres beständigen Schweigens war für sie eine enorme Erleichterung. Fechner vermied moralisierende Fragen und ließ sie erzählen. Dadurch erfuhr er ganze Lebensgeschichten. Auf diese Weise wurde Fechner, dessen Vater im KZ umgekommen war, zu einer Art „Beichtvater“ für die Angeklagten. So kommt es im Film zu Aussagen, die es im Gerichtsverfahren nicht gegeben hat.
Die Personen werden in den Untertiteln nicht mit ihren Namen, sondern nur mit ihrer Funktion innerhalb des Prozesses genannt („Angeklagter“, „Staatsanwalt“ usw.), da es Fechner nicht auf die Einzelschicksale der Personen, sondern auf ihre Zeitzeugenschaft ankam.
Für die Interviews gab Fechner seinen Kameraleuten die Anweisung, möglichst nicht zu zoomen. Außerdem wurde jeder Interviewpartner aus einer bestimmten Kameraperspektive (z.B. mit Blick von rechts nach links) gefilmt. Auf diese Weise wurden Sprünge in der Montage vermieden. Die verschiedenen Blickrichtungen der Interviewten befördern im Film noch zusätzlich den Eindruck von einem „Gespräch“ zwischen den Erzählenden.
Ein Dialog zwischen Tätern und Opfern kam jedoch auch in der Montage nicht zustande. Die Angeklagten beharrten auf ihrer Unschuld - ja, sie sahen sich selbst sogar als Opfer einer großangelegten Rufmordkampagne. Umgekehrt gab es bei den Opfern ein Schuldgefühl dafür, überlebt zu haben. Eine
Aussöhnung von Tätern und Opfern hätte im Film nur stattfinden können, wenn die Angeklagten ihre Schuld anerkannt hätten. Ihr Leugnen aber reißt die Kluft zwischen Tätern und Opfern nur um so weiter auf. Wie Jean Amery in Jenseits von Schuld und Sühne (einer der Alternativtitel für den Film) schreibt, bleibt jemand, der zum Opfer wurde, ein Opfer.9
Dieses Zerfallen in zwei Gruppen von Menschen wird noch durch die Beschreibung des Lageralltags unterstrichen: Zwei „Kapitelüberschriften“ im zweiten Teil des Films lauten „Alltag im Lager“ und „Dienstschluߓ. Der Alltag im Lager bedeutete für die einen täglich Unterdrückung und Todesangst - für die anderen war es Berufsalltag. Die Normalität der Aufseherinnen und Aufseher im Gespräch untereinander oder nach Dienstschluß stand in krassem Gegensatz zu ihrem Verhalten den Häftlingen gegenüber. Die Aufseherin Lächert beispielsweise war dafür gefürchtet, daß sie ihren Hund auf Gefangene hetzte, und einmal nahm sie an einer Jüdin eine „gynäkologische Untersuchung“ mit einer Zaunlatte vor! Dieselbe Frau ging abends mit ihren Kollegen zum Essen oder ins Kino, erwartete Briefe von zu Hause oder machte Handarbeiten. Die verschiedenen Welten lassen sich - das wird in der Montage der gegensätzlichen Aussagen klar - nicht zusammenbringen. Die Banalität des Bösen (so wie Hannah Arendt sie anhand des Eichmann-Prozesses beschrieben hat) bleibt letzten Endes nicht faßbar.
Trotz seiner Wortfülle und der Raffinesse seines Schnitts haftet dem Film angesichts des Grauens in manchen Szenen doch eine gewisse Sprachlosigkeit an. Die Frage, wie Menschen anderen Menschen so etwas antun konnten, muß offenbleiben. Wie ein Motto erscheint innerhalb des Films der Satz einer ehemaligen KZ-Insassin: „Es ist noch niemand geboren worden, der eine genug reiche Sprache hat, um zu beschreiben, was Majdanek war.“
Fechner setzt den Journalisten Heiner Lichtenstein, der Prozeßbeobachter war, durch die Montage als „Kommentator“ seines Films ein. Lichtenstein scheint die Bemerkungen seiner „Vorredner“ zu ergänzen und zu relativieren. Ihm gehört auch das Schlußwort, in dem er den Prozeß noch einmal zusammenfaßt und die Folgerung daraus zieht, für die Zukunft daraus zu lernen und den Anfängen eines neuen Faschismus zu wehren: „Und wenn es damit erreicht worden ist, ist viel erreicht worden. Dafür wird kein Toter wieder lebendig - aber damit kann man vielleicht verhindern, daß Unschuldige in der Zukunft ermordet werden.“
Der Ort und das Wort
Shoah von Claude Lanzmann ist ein Film, der inhaltlich und formal einen großen Atem entwickelt. Er ist innerhalb von zwölf Jahren entstanden. Allein fünfeinhalb Jahre brauchten Lanzmann und seine Mitarbeiter für den Schnitt. Der neuneinhalbstündige Film ist in der Kinofassung, die Lanzmann der Fernsehfassung gegenüber bevorzugt, in zwei Teile gegliedert. Shoah handelt von der Vernichtung der Juden im deutschen Faschismus.
Im Gegensatz zu Fechner verwendet Lanzmann keine Archivaufnahmen oder Fotos des Holocaust. Integraler Bestandteil von Shoah ist aber - wie bei Fechner und doch auf eine gänzlich verschiedene Art - die Befragung von Zeitzeugen. Kommen in Fechners Film zu den Opfern und Tätern die Juristen und die Prozeßbeobachter als Gesprächspartner hinzu, so sind es in Shoah die „Zuschauer“ des Holocaust. Beispielsweise wurden polnische Bauern dadurch, daß sie in unmittelbarer Nähe eines Lagers lebten, zu Zeugen der Vernichtung. Lanzmanns Fragen sind im Film mit enthalten. Auch er selbst und seine Dolmetscherinnen sind manchmal im Gespräch mit den Zeugen im Bild zu sehen. Lanzmann fragt sehr genau. Er stellt viele Detailfragen, z.B. „Wann war das, wie spät war es?“, manchmal auch absurd erscheinende Fragen: „Gab es in den Gaskammern Spiegel?“, die dazu dienen, seine Gesprächspartner in das Thema zu verwickeln. Auch in Shoah spielen die Schuldgefühle der Opfer eine bedeutende Rolle. Durch ihre Arbeit in den „Sonderkommandos“ wurden sie zu Werkzeugen der Vernichtungsmaschinerie gemacht. Deshalb gibt es in den Gesprächen immer wieder Momente, in denen die Erzähler nicht weitersprechen können oder ihrer Erinnerung durch Rechtfertigungsversuche einen Riegel vorschieben. Aber Lanzmann läßt sie nicht „entkommen“. Mit seinen Detailfragen bringt er sie dazu, den Faden der Erzählung wieder aufzunehmen. Rechtfertigende Antworten lehnt er ab: „Danach habe ich nicht gefragt.“ Er möchte wie Fechner nicht als „Richter“ erscheinen und stellt keine moralisierenden Fragen.
Dennoch verhehlt er seine Parteilichkeit nicht. In Shoah kommen die Täter weniger als in Der Prozeß zu Wort. Das gilt sowohl für den Raum, den ihre Redebeiträge innerhalb des Films einnehmen, als auch für die Weise, in der Lanzmann sie befragt. Wo Fechner ihre Aussagen durch die Montage mit gegensätzlichen Äußerungen und Archivmaterial zurechtrückt, greift Lanzmann direkt ins Gespräch ein und stellt Sachverhalte klar.
Den ehemaligen Reichsbahnangehörigen Walter Stier, der die Sonderzüge für den Transport von Juden zu den Konzentrationslagern organisierte, fragt er provokativ: „Sie waren ein Schreibtisch...“ - und läßt das Wort „Täter“ ungesagt in der Luft hängen. Aber sein Gegenüber weicht aus: „Ich war ein Schreibtischmann, reiner Schreibtischmann.“
Lanzmanns Nachfragen machen die Zuschauer an einigen Stellen auf verborgene Haltungen der Gesprächspartner aufmerksam. Ein polnischer Bauer äfft im Interview die Sprache der Juden in den Eisenbahnwaggons nach: Sie hätten „Rarara“ gemacht. Lanzmann fragt daraufhin: „War es ein besonderes Geräusch? Das Geräusch der Juden?“ Dadurch wird der Antisemitismus dieses Polen hervorgehoben. Lanzmanns Interviewfrage hat eine interne Kommentarfunktion für die Zuschauer.
Seine Befragungsart geht weit über die bloße Erinnerungsarbeit im Sinne Fechners hinaus. Die Fragen führen die Zeitzeugen tiefer in vergangene Situationen hinein. Lanzmann fordert sie auf, zu „spielen“, alte Gesten vorzuführen, bestimmte Körperhaltungen wieder einzunehmen. Er spricht deswegen von den Interviewpartnern als von seinen „Darstellern“.10 Sie erinnern sich nicht bloß an bestimmte Situationen: Sie vergegenwärtigen sie. Ich greife noch einmal eine Szene mit dem polnischen Bauern auf, um die Bedeutung des „Spielens“ zu veranschaulichen: Der Bauer erzählt, er habe immer eine bestimmte Handbewegung gemacht, um den Juden in den Waggons zu zeigen, daß sie in den Tod führen. Lanzmann fordert ihn auf, die Handbewegung zu wiederholen, und der Bauer streicht mit einem Finger an seiner Kehle entlang: das Zeichen für „Kehle durchschneiden“. Eine gewisse sadistische Freude kann er nicht verbergen. Das gleiche „Spiel“ wiederholt sich bei der Befragung anderer Bauern: Auch sie haben früher die Juden „gewarnt“. Wieder und wieder - wie zur Akzentuierung - läßt sich Lanzmann die Geste vorführen. Und immer deutlicher wird, daß es sich dabei nicht um eine Warnung handelte, sondern um eine Drohgebärde. Ganz anders ist jedoch der Eindruck, als der Eisenbahner von Treblinka die Geste vorführt: Er ist dabei voll Trauer.
In einer eindrucksvollen Szene befragt Lanzmann Abraham Bomba nach seiner Arbeit als Friseur in der Gaskammer von Treblinka. Die Frauen wurden in die Gaskammer gebracht, wo die Friseure bereits warteten. Ihnen sollte vorgemacht werden, sie bekämen dort nur einen schönen Haarschnitt. Tatsächlich jedoch waren ihre Haare zur „Weiterverwertung“ bestimmt. Nach dem Haareschneiden wurden sie vergast. Bomba war zur Zeit der Dreharbeiten schon pensioniert. Lanzmann mietete einen Friseursalon und forderte Bomba dazu auf, die gleichen Gesten wie damals am Kopf eines Freundes auszuführen und dabei zu erzählen. Das Interview wird hier gänzlich zur Inszenierung von Geschichte. Als Bomba von einem Kollegen zu erzählen beginnt, der in der Gaskammer seiner Frau und seiner Schwester begegnete, versagen ihm die Worte. Er weint und möchte aufhören. Aber Lanzmann zwingt ihn, sich in die Erinnerung zurückzubegeben, die Situation wieder zu erleben.
Wo Fechner die Aufnahme abbricht oder die Tränen der Opfer im Schnitt verbirgt, bleibt Lanzmann „drauf“. Oftmals erscheint sein Umgang mit den Gesprächspartnern erbarmungslos. Doch es geht ihm nicht darum, die Menschen bloßzustellen oder Sensationen zu präsentieren: In der „Verkörperung“ von Geschichte knüpfen die Zeitzeugen an ihr Erlebnis der damaligen Situation an. Das bloße Erzählen von der Vergangenheit als einer abgeschlossenen Handlung hätte nicht vermocht, an das Trauma, das noch in ihnen fortlebt, zu rühren.
Während Fechner mit Der Prozeß ein vielstimmiges „Erinnerungsmosaik“ geschaffen hat, in dem sich die gegensätzlichen Positionen für die Zuschauer zu einem Geschichtsbild zusammenfügen, liegt Shoah eine psychoanalytisch inspirierte Gedächtniskonzeption zugrunde. Durch das Wiederholen von Situationen im „Spiel“ will Lanzmann das, was durch den traumatischen Schock der Erinnerung entzogen ist, zur Sprache bringen. Nicht die Erinnerung, sondern das Nachspielen weckt die verdrängten Erlebnisse, aus denen Lanzmann für die Zuschauer ein Bild des Holocaust rekonstruiert. Gertrud Koch faßt Lanzmanns Ansatz folgendermaßen zusammen: „So ist Shoah ein Film nicht der und für die Erinnerung, sondern mimetische Konstruktion eines Gedächtnisses, das aus der Teilnehmerperspektive kein Vergessen kennt und aus der Beobachterperspektive mit Faktizität gefüllt werden muß.“11
In einem Interview erklärt Lanzmann zu dem „Spiel“ seiner Gesprächspartner: „Es ist ihre eigene Geschichte, die sie erzählen. Doch es reicht nicht aus, sie nur zu erzählen. Sie mußten spielen, das heißt irreal machen. Dieser Akt des Irrealisierens definiert das Imaginäre.“12 Lanzmann knüpft hiermit an eine Idee seines Freundes Jean-Paul Sartre an.13 Das Imaginäre, also die Vorstellung, ist die „Anwesenheit einer Abwesenheit, die außerhalb des raum-zeitlichen Kontinuums der gegenwärtigen Vorstellung liegt“14, wie Gertrud Koch es formuliert. Lanzmann setzt die Vorstellung der Geschichte - im doppelten Wortsinn - in Szene, indem er Fotos und Archivmaterial ausspart. Aufnahmen der Vernichtung lehnt Lanzmann als „Bilder ohne Imagination“ ab. Er sagt, so etwas sehe man alle Tage.15
Mit dem Problem, das Unvorstellbare darzustellen, geht er um, indem er an die Stätten der Vernichtung reist und die Aufnahmen dieser Orte in ihrem gegenwärtigen Aussehen mit den Erzählungen von der Vergangenheit verbindet. Er betont, sein Film sei ein „topographischer, ein geographischer Film“16. Ein Alternativtitel für den Film lautete: „Der Ort und das Wort“, weil ihm die Spannung zwischen der Erzählung und den gegenwärtigen Orten wichtig war - aber der Titel kam ihm doch zu „abstrakt“ vor. Wie Ophuls und Fechner hatte Lanzmann damit zu kämpfen, daß kaum noch Spuren der gigantischen Vernichtung zu finden waren. Im wahrsten Sinne des Wortes war „Gras darüber gewachsen“: Der Wald von Sobibor bedeckte ein Gelände, auf dem Massenexekutionen vorgenommen worden waren. Die Deutschen hatten Kiefern anpflanzen lassen, um alle Spuren zu verwischen.
Lanzmann verbindet lange Landschaftsschwenks mit Erzählungen von der Vergangenheit. Ton- und Bildebene liegen sowohl räumlich als auch zeitlich weit auseinander. Der Erzählende sitzt beispielsweise in Israel und erzählt von seiner Deportation, während im Bild eine polnische Landschaft zu sehen ist. Erzählung und Landschaftsaufnahme wirken gegenseitig aufeinander: Die Landschaft bekommt eine andere Bedeutung - Geschichten werden in ihr angesiedelt. Und die Erzählung bekommt eine Weite, eine Vorstellbarkeitsspanne, die sie ohne das Bild nicht hätte. Zwischen diesen Polen entsteht für die Zuschauer das eigentliche - nicht sichtbare - Bild dessen, was sich ereignet hat.
Doch manchmal scheinen die sonnigen Bilder der Gegenwart nicht mit dem Berichteten zusammenpassen zu wollen. In einer Einstellung sind Leute in Israel zu sehen, die Wasserski laufen - während Abraham Bomba von Treblinka erzählt. Und die Bilder vom Hafen, von der Altstadt und einer Pferdewagenfahrt in Korfu stechen von dem Bericht eines Auschwitz-Überlebenden ab, der von hier verschleppt wurde. Die Festung, in der die Juden fünf Tage lang gefangengehalten wurden, sieht in der Einstellung aus wie auf einem Urlaubsfoto. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart klafft ein Abgrund, der durch die Gegensätzlichkeit von Aufnahmen und Erzählungen noch betont wird. Einmal fragt Lanzmann einen polnischen Eisenbahner: „Und es gab so schöne Tage wie heute, nehme ich an...?“ Dieser antwortet: „Leider ja, es gab Tage, die noch schöner waren als heute!“ Der Alltag der Vernichtung ist kaum zu begreifen.
Lanzmann versucht, mit einer besonderen Bild-Ton-Dramaturgie die Unvermittelbarkeit zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzuheben. Michael Marek unterscheidet vier verschiedene Bild-Ton-Ebenen in Shoah. Es gibt (A) Szenen, in denen der Erzähler im Bild zu sehen ist, an einem Ort, der nichts mit dem Gegenstand der Erzählung zu tun hat; (B) ist der Erzähler am Ort der Erzählung zu sehen; (C) ist der Ort, über den aus dem Off berichtet wird, im Bild zu sehen; und (D) wird ein Ort gezeigt, der mit der Erzählung nicht unmittelbar etwas zu tun hat.17 Beispielsweise erzählt der ehemalige Häftling Richard Glazar vom Konzentrationslager, während das Bild Schnellboote auf dem Rhein bei Basel zeigt, wo Glazar wohnt. Als Zusatz zu (D) ließe sich noch eine Bild-Ton-Ebene benennen: In einigen Szenen illustrieren Bilder die Erzählungen bzw. wirken als Kontrapunkt dazu.
Lanzmann verschränkt die verschiedenen Ebenen ineinander, so daß die Erzählung dramatisiert wird: Im zweiten Teil von Shoah schildert Ruth Elias ihren Transport von Theresienstadt nach Auschwitz. Mit subjektiver Kamera stellt Lanzmann ihren Blick aus dem fahrenden Zug nach. In der nächsten Einstellung ist ihr Gesicht zu sehen. Sie erzählt von ihrer Ankunft in Auschwitz. Während sie davon berichtet, daß sie in das „Familienlager“ geführt wurde, fährt die Kamera langsam durch das Tor von Auschwitz. Unaufhaltsam nähern sich damit auch die Betrachter des Films dem Lagergelände. Lanzmann bringt nicht nur die Augenzeugin dazu, sich das Vergangene zu vergegenwärtigen, sondern auch die Zuschauer.
Sobald Ruth Elias vom Lager B II B erzählt, setzt ein Schwenk über das Lagergelände ein, von innen gefilmt, immer am Zaun entlang. Uber demselben Schwenk berichtet Rudolf Vrba von der Ankunft der Juden aus Theresienstadt. Sein Bericht bestätigt und ergänzt die Erzählung von Ruth Elias. Vrba, der jetzt im Bild zu sehen ist, erzählt, er sei damals bereits Mitglied der Widerstandsbewegung gewesen. Er wußte, daß die Juden aus Theresienstadt nach einer sechsmonatigen „Quarantäne“ vergast werden sollten. Die Widerstandsbewegung versuchte, Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Sie stieß unter ihnen auf einige Mitglieder der Internationalen Brigade in Spanien.
Lanzmann kommentiert diese Nachricht mit einer Einstellung, in der Kaninchen am Zaun des Konzentrationslagers zu sehen sind. Vrba erzählt, es sei gelungen, etwa vierzig Leute, die auch schon früher gegen die Nazis gekämpft hatten, für die Widerstandsgruppe zu gewinnen. Eine neue Einstellung zeigt Kaninchen, die unter dem Zaun durchschlüpfen.
Lanzmanns Bilder inszenieren das Erzählte. In einigen Fällen „stimmen“ die Aufnahmen allerdings nicht. Der ehemalige Häftling Filip Müller berichtet von der Ankunft polnischer Juden. Ein SS-Mann habe sich auf das Dach des Krematoriums gestellt und den Juden eingeredet, sie bekämen Arbeit. Sie sollten sich vorher nur ausziehen und desinfizieren lassen. Auf diese Weise gelang es den Deutschen, vor der Vergasung der Juden an ihre Kleider zu kommen. Lanzmann, der sonst sehr darauf bedacht ist, die Perspektive der Opfer zu wahren, verwendet hier eine Aufnahme, die aus der Position des SS-Mannes nach unten in den Hof sieht - obwohl die Opfer und der Erzähler die entgegengesetzte Blickrichtung hatten.
Für viele Partien in Shoah hat Lanzmann jedoch treffende und poetische Bilder gefunden. Bereits die erste Szene des Films ist großartig inszeniert. Simon Srebnik, der als Kind regelmäßig mit einem SS-Mann in einem Kahn den Fluß hinabfahren und singen mußte, wird erneut in einem Kahn den Fluß hinabgefahren und singt: ein schönes und trauriges Bild. Das Gesicht des Mannes, der ihn fährt, ist nicht zu erkennen. Er erinnert an Charon, den Fährmann ins Totenreich - und tatsächlich bezeichnet diese Flußfahrt ja den Einstieg in einen Film voller Sterben.
Ein häufig wiederkehrendes Motiv in Shoah ist die Lokomotive. Heike Hurst fragt Lanzmann in einem Interview, ob die Reise das Gerüst des Films bilde. Lanzmann verneint: Das Gerüst des Films sei die Radikalität der Vernichtung. Die Eisenbahn ist in Shoah eine Metapher für die Verschleppung und den Tod.18
Der „Kommentator“ innerhalb Lanzmanns Film ist der US-Historiker Raul Hilberg. Lanzmann teilt seine Ansicht, die Massenvernichtung sei ein Prozeß von kleinen Schritten gewesen, gestützt durch eine gut funktionierende Bürokratie, die - von den Vergasungswagen bei Chelmno bis zu der „fabrikmäßigen“ Tötung in den Vernichtungslagern - technisch „lernte“. Hilbergs Ansätze zeichnen sich auch im Aufbau des Films und in den Fragestellungen Lanzmanns ab. Im ersten Teil von Shoah erläutert Hilberg seine Methode, die programmatisch für den Film gelten kann: „Bei meiner ganzen Arbeit habe ich nie mit den großen Fragen begonnen, weil ich fürchtete, magere Antworten zu bekommen. Ich habe es daher vorgezogen, mich der Präzisierung und den Details zuzuwenden, um sie zu einer ‚Gestalt‘ zusammenfügen zu können, zu einem Gesamtbild, das - wenn schon keine Erklärung - doch wenigstens eine umfassende Beschreibung dessen wäre, was sich ereignet hat.“ Lanzmann möchte - wie Hilberg - den Holocaust nicht erklären, sondern ihn so genau wie möglich beschreiben. Auch der Film fügt die alltäglichen
Details, die Daten und Abläufe der Vernichtung zu einer „Gestalt“ zusammen. Die Äußerungen der Zeitzeugen und die Erklärungen des Historikers über die Logik und die Entwicklung des Holocaust ergänzen einander.
Shoah ist nicht durch „Kapitelüberschriften“ gegliedert wie Der Prozeß, sondern durch eine strenge Montage, die das Filmmaterial in „eine symphonische Konstruktion mit Themen und Leitmotiven“19 verwandelt. Der Film setzt immer wieder von vorne an, schildert die Deportation der Juden, die Teilschritte und den Ablauf des Holocaust. Mal für Mal fährt der Zug durch Europa, auf die Vernichtungslager zu. Am Ende des Films wird über die Zerstörung des Warschauer Gettos berichtet. Noch vor dem drohenden Ende sind Bilder von rauchenden Schloten im Ruhrgebiet und von „Schuh-Bergen“ in Auschwitz zu sehen. Lanzmann legt Wert auf den „Tonfall des Scheiterns“20 in seinem Film. Die Zuschauer wissen schon, was geschehen wird - und was eigentlich nie hätte geschehen dürfen.
Mit den Tätern geht Lanzmann nur äußerst distanziert um. Er präsentiert den ehemaligen SS-Unterscharführer Franz Suchomel nicht gleich, direkt nach der Aussage eines Opfers, sondern zeigt zuerst in der Totale einen Aufnahmewagen, der in einer Straße steht, dann den Wagen von näher, dann die Antenne auf dem Dach und schließlich das Innere des Wagens mit seiner „Besatzung“, die einen verschneiten Schwarzweiß-Bildschirm überwacht, auf dem der Täter zu sehen ist. Über seinen Augen flimmert ein dunkler Streifen. Die komplizierte Annäherung macht auf der Bildebene deutlich, daß Suchomel mit versteckter Kamera gefilmt worden ist. Zugleich wird er durch den verschneiten Bildschirm wie durch ein „Schutzgitter“ gezeigt. Im Gegensatz zu Fechner läßt Lanzmann die Täter nicht einmal in der Montage auf die Opfer treffen. Das Interview mit Dr. Franz Grassier, der Assessor bei dem Nazikommissar des Warschauer Gettos war, isoliert Lanzmann durch Städtebilder und die Erklärungen des „Kommentators“ Raul Hilberg von den Aussagen der Opfer. Lanzmann hält es für „obszön“, eine direkte Begegnung von Tätern und Opfern durch die Montage herbeizuführen: Man solle nicht so tun, als handle es sich bei den Tätern und Opfern um alte „Kombattanten“.21
Claude Lanzmann betont, er stelle in Shoah nicht die persönlichen Geschichten in den Mittelpunkt: „Die Leute, die ich interviewe, sprechen nicht für sich selbst. [...] Sie legen für die Toten Zeugnis ab. Es ist kein Film über Überlebende, überhaupt nicht.“22 Tatsächlich aber wäre der Film ohne die Gewißheit, daß es Menschen gegeben hat, die überlebt haben, kaum auszuhalten. Darum ist die fast beiläufig mitgeteilte Nachricht von der Flucht Rudolf Vrbas aus dem Vernichtungslager für die Zuschauer wie ein Luftholen innerhalb des Films. Doch Lanzmann macht klar, wie gegenwärtig der Holocaust für die Überlebenden geblieben ist.
Wie umarmende Klammern stehen in diesem großen Film über die Vernichtung der Juden die Berichte von Menschen, die ihr Überleben als etwas beinahe Unfaßbares erfuhren. Im Einleitungstext wird Simon Srebnik vorgestellt, der in Chelmno erschossen wurde - und überlebte, weil der Genickschuß an den vitalen Zentren vorbeiging. Er hat sich gemeinsam mit Lanzmann zurück an die Orte der Vernichtung begeben. Am Ende des ersten Teils spricht der 47jährige mit dem alten Gesicht jenen sonderbaren Satz aus, der sein grenzenloses Erstaunen darüber ausdrückt, daß er als einzelner den Massenmord überlebt hat: „Der einzige auf der Welt bleibe ich, wenn ich geh los von hier.“ Einen ähnlichen Gedanken hegte Simha Rottem, der die Vernichtung des Warschauer Gettos überlebte: „Ich bin der letzte Jude, ich warte auf den Morgen, ich warte auf die Deutschen.“ Dies ist der letzte Satz des Films. Lange ruht der Blick der Kamera auf Simha Rottems Gesicht, bevor der Zug noch einmal durch das Bild fährt.
Der Ophuls-Touch
Marcel Ophuls versammelt in Hotel Terminus über 80 Zeitzeugen, die in Frankreich, Deutschland, den USA und Bolivien interviewt wurden. Die Dreharbeiten dauerten zwei Jahre lang, der Schnitt ein zusätzliches Jahr. Ophuls verarbeitete die ungeheure Fülle von 120 Stunden Material zu einem viereinhalbstündigen Film in zwei Teilen.
Anlaß für Hotel Terminus war wie für Eberhard Fechners Film einer der letzten großen NS-Verbrecher-Prozesse. Klaus Barbie war von 1942 bis 1944 Gestapo-Kommandant in Lyon. In dieser Zeit folterte und ermordete er den Resistance-Führer Jean Moulin und war dafür verantwortlich, daß 41 jüdische Kinder des Heims in Izieu und ihre Betreuer in Auschwitz getötet wurden. 1951 floh er vor den französischen Untersuchungen seiner Vergangenheit nach Bolivien und lebte dort unter dem Namen Klaus Altmann. 1983 nach dem Sturz der Militärdiktatur Hugo Banzers wurde Barbie an Frankreich ausgeliefert. Fast 40 Jahre nach seinen Verbrechen kehrte er nach Lyon zurück und wartete in demselben Gefängnis auf den Prozeß, in dem damals seine Opfer ausharren mußten. Der Prozeß wurde zahlreiche Male verschoben und fand erst 1987 statt. Marcel Ophuls wollte sich der Geschichte Klaus Barbies und seiner Zeit über die Aussagen seiner Opfer, Mittäter, Bekannten und Unterstützer nähern. Doch mehr als Lanzmann und Fechner mußte er sich mit dem Schweigen der Leute auseinandersetzen, die er gerne befragt hätte. Ophuls reagierte mit bitterem Spott. Er stellte seine vergeblichen Interviewbemühungen in Hotel Terminus zu einer Art „Potpourri“ zusammen. Einmal ist er bei der Suche nach Erich Bartelmus zu sehen, der sich am Telefon von seiner Frau verleugnen läßt. Bartelmus war Gestapo-Offizier und arbeitete mit Barbie in Lyon zusammen. Ophuls läuft durch einen Garten, ruft nach Herrn Bartelmus und hebt die Planen über den Beeten hoch, als könne er sich zwischen dem Gemüse versteckt haben. In einer anderen Szene verfolgt er den ehemaligen Gestapo-Mann Steingritt bis zum Fahrstuhl. „Gibt es denn hier keine Menschenrechte?“ ruft dieser. Und Karl-Heinz Müller, dem ehemaligen Gestapo-Chef von Toulouse, hält er entgegen: „Darf ich Sie fragen, worin bestand die reichsfeindliche Betätigung eines zweijährigen Mädchens?“, bevor ihm dieser die Tür vor der Nase zuknallt. „Fröhliche Weihnachten“, wünscht Ophuls.
Mehr noch als Lanzmann bringt sich Ophuls selbst ins Spiel. Er wird zum „Protagonisten“ seines Films - gerade in Szenen, in denen er keine neuen Erkenntnisse präsentieren kann, weil ihm Aussagen verweigert werden. Mit seinem Assistenten Dieter Reifarth führt er vor, auf welche Weise viele Telefongespräche verlaufen. Ophuls spielt in dieser „Kabarett-Einlage“ eine „Dame am Schliersee“: „Ach, wie interessant, ein Dokumentarfilm! [...] Aber wissen Sie, ich hab mit alldem natürlich gar nichts zu tun.“
Auch in den Interviews stieß Ophuls auf Blockaden. Viele Gesprächspartner traten ihm mit vorgefertigten Antworten entgegen. Je weiter er fragte, desto tiefer drang er in einen „Sumpf“ von Intrigen, Halbwahrheiten und Fehlinformationen vor. Seine Befragungsart bezeichnet Ophuls als „Peter- Falk-Columbo-Taktik“23. Wie dieser beobachtet er gutmütig und voller Geduld die Gesprächspartner beim Lügen, scheint einem Ablenkungsmanöver auf den Leim zu gehen - aber nur, um die Zuschauer darauf aufmerksam zu machen und im entscheidenden Moment auf seine Ausgangsfrage zurückzukommen. Manchmal ist es nur ein flüchtig gesagtes Wort, das ihn aufhorchen und nachfragen läßt: Eugene Kolb, der ehemalige Operationsleiter des amerikanischen C.I.C.-Geheimdienstes in Augsburg, war 1949/50 Barbies Vorgesetzter. Im Gespräch mit Ophuls nennt er die Resistance-Angehörigen „angebliche“ Widerstandskämpfer. Ophuls fragt, warum denn „angeblich“, und erfährt, daß Kolb sie für Kommunisten gehalten habe. So kommt Ophuls einer Vertuschungsaktion auf die Spur: Der C.I.C. fürchtete, daß Barbie im Falle seiner Auslieferung an die Franzosen den „Kommunisten“ in der französischen Regierung von seiner Geheimdiensttätigkeit für die Amerikaner erzählen würde. Deshalb sorgten die Amerikaner dafür, daß sich Barbie rechtzeitig nach Lateinamerika absetzen konnte.
Ophuls befindet sich bei Interviews mit ehemaligen Geheimdienstleuten wie Shute, Taylor und Browning in der merkwürdigen Situation, berufsmäßige Verhörer zu verhören. Mit geschickten Fragen gelingt es ihm, sie aus der Reserve zu locken. Er „wiederholt“ scheinbar, was sie gesagt haben, geht aber tatsächlich inhaltlich darüber hinaus und fragt dann: „Ist es das, was Sie meinten?“ So bringt er sie dazu, mehr von ihrem Wissen preiszugeben, als sie eigentlich vorhatten.
Den Leibwächter Barbies in Bolivien, Alvaro De Castro, der gemeinsam mit Barbie in illegale Waffengeschäfte verwickelt war, läßt er bei vorgetäuschten Aufnahmevorbereitungen lange im Nebenraum warten und dabei filmen: eine „Schmierenkomödie“, inszeniert für einen „Schmierenkomödianten“. Ophuls spricht ihn auf Eichmann an, mit dem sich Barbie in Bolivien traf. Nach De Castros Äußerung, er halte die Anschuldigungen gegen Eichmann und die Nationalsozialisten für „konzertierte Übertreibungen“, fragt Ophuls: „Wissen Sie, daß ich Jude bin?“ In Szenen wie dieser geht er noch offensiver mit den Tätern und Mittätern um als Lanzmann. Doch auch er vermeidet moralische Wertungen.
Ophuls nützt die Montage, um die Äußerungen seiner Gegenüber ins rechte Licht zu rücken. Die Behauptungen des C.I.C.-Agenten Kolb, Barbie sei so geschickt gewesen, daß er der Folter nicht bedurft habe, stellt er mit dem „Wechselschnitt“ auf jene Gesprächspartner bloß, die Barbies Grausamkeit am eigenen Leib verspürt haben. Ähnlich wie Fechner konfrontiert Ophuls durch die Montage einander widersprechende Bemerkungen miteinander. Er inszeniert ein spannendes „Kreuzverhör“ von gegensätzlichen Darstellungen der Geschichte. Dabei ist nicht immer eindeutig, welche Version der Ereignisse der Wahrheit am ehesten entspricht. Manchmal entsteht erst aus einer Folge von Gesprächsbeiträgen für die Zuschauer ein Eindruck von den vergangenen Geschehnissen. Im ersten Teil von Hotel Terminus, der u.a. von Verrat und Kämpfen innerhalb der Résistance handelt, gibt es keine „Lösung“ der Frage, ob René Hardy den Aufenthaltsort von Jean Moulin an Barbie verraten hat. Ophuls überläßt es den Zuschauern, über die unterschiedlichen Darlegungen der Ereignisse zu urteilen.
Zu den Teilnehmern an der großen „Gesprächsrunde“, die durch den Schnitt hergestellt wird, zählen sowohl Günter Grass als auch Serge Klarsfeld und Jean-Marie Le Pen. Ophuls, dessen Produktionsfirma bezeichnenderweise „Memory Pictures“ heißt, arbeitet an einem „Erinnerungs-Kaleidoskop“, das sich wie bei Fechner aus den „bits and pieces“ von Interviews zusammensetzt. Doch im Gegensatz zu Fechner zeigt er, mit welchen Schwierigkeiten er dabei zu kämpfen hatte. Zu seiner Erinnerungsarbeit gehören ebenso die mühsamen Ermittlungen wie die Verweigerungsstrategien seiner Gegenüber. In einem Interview sagt Ophuls, die zeitgenössische Geschichte und die Erinnerung drehten sich im Leeren, weil sie von der Weigerung, Verantwortung zu tragen, verdorben seien.24 Hotel Terminus führt vor, wie sich Personen gegen die Erinnerung sperren oder sie sogar bewußt verfälschen. Erst durch die Konfrontation ihrer Lügen mit den Aussagen der Opfer gelingt es Ophuls, den „Leerlauf“ der Erinnerung zu durchbrechen.
Die Bildebene von Hotel Terminus ist unsicherer als diejenige von Der Prozeß: Die Kameraleute sollten die Interviews in mindestens drei verschiedenen Einstellungen filmen (Totale, Amerikanisch und Groß). Vorgaben über das Zoomen gab es nicht. Deshalb bringt die Montage, die sich strikt am Inhalt des Gesprochenen orientiert, den Film manchmal mitten in einem Zoom zum Springen.
Während Lanzmann bewußt auf die filmische Nutzung von Fotos und Archivaufnahmen verzichtet, schöpft Ophuls aus einem reichen „Pool“ von Wochenschaumaterial, Fotos, Schriftstücken usw. Da René Hardy starb, bevor Ophuls ihn über die Ereignisse um den Tod von Jean Moulin befragen konnte, verwendet er Ausschnitte aus einem Film von Claude Bai. Für Filmaufnahmen von Barbie greift er auf eine Reportage von Ladislas de Hoyos zurück.
Ophuls erzählt den Werdegang Barbies vom „Buben“ eines Lehrers aus Bad Godesberg bis zum „Henker von Lyon“ und „Experten für Repression“ in Bolivien mit einer rasanten Abfolge von Einstellungen. Die Fotos sind dabei meist nur wenige Sekunden lang zu sehen. Sie wirken wie nach außen gebrachte Erinnerungsfetzen und dienen dazu, das Erzählte zu bebildern: Wenn von „Schiefmaul“ die Rede ist, einem französischen Informanten der Gestapo, der an Folterungen teilnahm, wird kurz nach seiner Erwähnung ein Bild von ihm gezeigt.
Wie Lanzmann inszeniert Ophuls das Erzählte mit Aufnahmen von Orten und Gebäuden. Die ehemalige Résistance-Kämpferin Lise Lesèvre berichtet von ihrer Festnahme auf dem Bahnhof Lyon-Perrache. Zunächst ist sie selbst zu sehen, dann der Bahnhof in seinem heutigen Erscheinungsbild. Sie erzählt, daß im Augenblick ihrer Verhaftung alle Angst verflogen sei. Ophuls kombiniert ihren Bericht mit der Aufnahme eines Stahltors, das ins Schloß fällt.
Das Bild einer Treppe im Hotel Terminus, wo die Gestapo ihr Hauptquartier hatte, illustriert ihren Gang zum Verhörraum. Während sie von einem Salon berichtet, in dem sie auf Barbie traf, ist eine Wand mit einem Hitler- und einem Göring-Porträt zu sehen. Auf der Wand liegt der Schatten eines Sprossenfensters. Die Einstellungen, in denen Mme Lesèvre erzählt, und diejenigen von den Orten wechseln einander ab. Als sie berichtet, Barbie habe ihr Handschellen mit Dornen an der Innenseite angelegt, ist kurz ein Foto zu sehen, das ihn als jungen Mann zeigt. Sie erzählt, die Folterung habe zwei Stunden lang gedauert. Die Kamera sieht aus dem Fenster. - Mme Lesèvre wurde neunzehn Tage lang von Barbie verhört, davon neun Tage in der Folterkammer. Ihr Bericht darüber ist trocken und detailliert. Sie erzählt auch davon, daß ihr Mann und ihr sechzehnjähriger Sohn festgenommen wurden, um sie unter Druck zu setzen. Sie nahm alle Schuld auf sich. Dennoch folterte Barbie ihren Sohn zu Tode. Auch ihren Mann sah sie nie wieder. - Nach zwei weiteren Berichten von Folterungen folgt ein Interview mit einem französischen Polizisten, der mit den Deutschen zusammenarbeitete. Entkommen ließ er nur die einflußreichen Leute, unter anderem den Sohn eines Ministers, der heute ein großer Käsefabrikant ist. Ophuls kommentiert diese Information mit einem Zwischenschnitt auf eine „vache-qui-rit“-Käsepackung, die die Zuschauer anlacht. Zu dem Vichy-Polizisten sagt er mit sarkastischem Unterton: „Mir scheint, häufig im Leben, nicht nur unter der Besatzung, ist es besser, reich und berühmt zu sein als weder reich noch berühmt.“ Ophuls reflektiert damit gleichzeitig über seine eigene Privilegiertheit. Als Sohn des berühmten Regisseurs Max Ophüls blieb ihm das Schicksal der Kinder von Izieu erspart.
Ophuls hat den bösen Witz mit der Käsepackung an dieser Stelle eingefügt, um sich von der Traumatisierung durch das Erzählte zu befreien. Auch für die Zuschauer ist sein Zwischenschnitt innerhalb der Zeitzeugenberichte über Korruption, Folter und Mord eine Erleichterung. In einem Brief schreibt Ophuls, er habe einige Zeit gebraucht, um sich von dem Ergreifenden der Zeugenaussagen zu befreien und „einen Tonfall“ zu finden, „der mir entspricht und der keiner offiziellen Version verpflichtet ist, wie wahrhaftig diese auch immer sein mag“25.
Ein wichtiges Merkmal des „Tonfalls“ von Hotel Terminus ist die Ironie. Ophuls durchsetzt den Film mit Spielfilmsequenzen, Volksliedern und Bildzitaten, die das Erzählte kommentieren und konterkarieren. Der ehemalige Geheimagent Kolb meint, eine Operation zur Ergreifung von NS-Offizieren, die im Deutschland der Nachkriegszeit lebten, sei „im Stil von Mack-Sennett- Filmen“ durchgeführt worden. Seine Bemerkung wird mit einem Ausschnitt aus einem Slapstickfilm von Mack Sennett kombiniert, in dem ein Mann vor der Polizei flüchtet. Der Szene ist eine Stummfilm-Klaviermusik unterlegt. Ophuls macht mit dieser Einstellung deutlich, wie „ernst“ den Amerikanern die Verhaftung von Barbie war. Seine zahlreichen Fluchten werden von den Stimmen der Wiener Sängerknaben begleitet: „Nun ade, du mein lieb Heimatland“, „Muß i denn“ und „Das Wandern ist des Müllers Lust“ durchziehen den Film als „running gag“. Ophuls läßt die Heiterkeit der Lieder und die von verschiedenen Geheimdiensten gedeckten Reisen des vielfachen Mörders Barbie aufeinanderprallen. Ursprünglich wollte er den Film „Wanderlust“ nennen - aber die amerikanischen Produzenten waren dagegen. So wurde der Film nach dem Hotel in Lyon benannt, das für viele Gefangene der Gestapo zur „letzten Station“ wurde.
Sobald sich Barbie - und damit die Erzählung des Films - im Anflug auf Lateinamerika befindet, wird das „Nun ade“ von indianischer Panflötenmusik abgelöst. Vom Flugzeug aus sind die Anden zu sehen. Lamas laufen über eine Hochebene. „Postkartenaufnahmen“ von lachenden Polizisten, einer Frau im Poncho und einem Kindergesicht stimmen die Zuschauer auf Barbies Südamerikaaufenthalt ein. Kurz nach diesen idyllischen Bildern erzählt eine bolivianische Journalistin davon, daß Barbie bei ihrer Folterung anwesend war.
Ein häufig wiederkehrendes Motiv in Hotel Terminus ist die Weihnachtszeit. In einer Art „Prolog“ des Films vor dem Titel redet Ophuls mit Johannes Schneyder-Merck, dem ehemaligen Nachbarn und Geschäftspartner Barbies in Lima. Dieser schlägt mit einem höhnischen Lachen vor, Barbie ein Hitler-Bild in seine Zelle nach Lyon zu schicken. Eine Großaufnahme zeigt ein Adventsgesteck. Die Wiener Sängerknaben singen ein Weihnachtslied. Ophuls verbindet Schneyder-Mercks Bemerkung mit Gegenständen, die an das „Fest der Liebe“ denken lassen, und gibt damit einen Vorgeschmack auf den Film, in dem so viel Heuchelei zum Vorschein kommt.
Die Abfolge der Themen in Hotel Terminus orientiert sich an dem Verlauf des Prozesses, der mit dem Mord an Jean Moulin begann und mit Barbies Entdeckung des jüdischen Kinderheimes in Izieu endete. Doch Ophuls durchbricht die Chronologie immer wieder mit assoziativen Querverweisen und mit „Nebenstrecken“ der Erzählung.
Mit seinen Eingriffen sowohl in der Montage als auch in den Gesprächen selbst - versucht Ophuls, dem Eindruck entgegenzuwirken, er wolle hier die Objektivität einer Geschichte entfalten. Im Wechselspiel von bitterem Ernst und Sarkasmus entsteht der „Ophuls-Touch“ seines Films. Marcel Ophuls - der übrigens auf dem „u“ ohne Trema besteht: ein Zeichen seiner „orthographischen Ausbürgerung“26, wie er selbst sagt - macht keinen Hehl daraus, daß er ein Bewunderer der amerikanischen Komödien von Capra und Lubitsch ist und sich nicht als Journalist versteht.27 Mit Hotel Terminus unternimmt er den Versuch, im Dokumentarfilm mit den Mitteln des Unterhaltungsfilms zu arbeiten. Dietrich Leder beschreibt den Film als die „fast spielfilmgleiche Darstellung einer journalistischen Recherche [...] mit dem Regisseur als Protagonisten“28. Hotel Terminus zeigt den „Krimi“ der Ermittlungen. Wie ein Detektiv aus einem Film der Schwarzen Serie stößt Ophuls auf (mindestens) ein schmutziges Komplott. Bei der Suche nach dem Mörder tritt dieser selbst immer mehr in den Hintergrund, und der „documentary-eye“ entdeckt eine korrupte Welt, in der Nazis, Kommunistenhasser innerhalb der Resistance, Angehörige des C.I.C., vatikanische Faschisten und bolivianische Militärs einander in die Hände spielen.
Anders als Shoah und Der Prozeß ist Hotel Terminus ein Film über die Gegenwärtigkeit des Schreckens, die Kontinuität von Folter, Geheimdienstmauscheleien und Waffengeschäften. Mit finsterem Humor erzählt Hotel Terminus von den Leuten und Institutionen, die den Werdegang eines Klaus Barbie ermöglichten und ermöglichen. Ophuls betont, daß Hotel Terminus nicht vom Holocaust handelt und auch keine Biographie Barbies sein soll, sondern ein Film über „das Verhalten von Leuten angesichts der Wirklichkeit dieser Karriere: über Ekel, Komplizenschaft, berechnende Gleichgültigkeit“29.
Abgesehen von dem „Protagonisten“ Marcel Ophuls gibt es eine „Kommentatorin“ in Hotel Terminus-, Simone Lagrange, deren Familie von der Tochter der Concierge als jüdisch denunziert wurde. Sie selbst wurde als Kind von Barbie gefoltert und nach Auschwitz geschickt, wo sie „das Wachsen vergaߓ, wie sie selbst sagt. - In einem Interview auf dem Flug von Bolivien nach Frankreich fragt ein Reporter Barbie: „Haben Sie Fehler gemacht?“ - „Haben Sie denn Fehler gemacht?“ fragt Barbie mit einem Lächeln zurück. In seine selbstsichere Äußerung schneidet Ophuls das Gesicht der weinenden Simone Lagrange: als Korrektiv und Zeichen gegen die Gleichgültigkeit.
In demselben Interview sagt Barbie: „Ich habe vergessen - wenn Sie mich nicht vergessen haben, ist das Ihre Sache.“ Er „stellt sich fremd“ (wie es in Christa Wolfs Kindheitsmuster heißt) gegenüber der Vergangenheit. Ophuls setzt das lebendige Gedächtnis von Simone Lagrange dagegen.
Der Film endet mit einem Besuch, den Ophuls gemeinsam mit Simone Lagrange dem Haus abstattet, in dem sie aufgewachsen ist. Als sie auf der Straße vor dem Haus stehen, sieht eine Frau aus einem Fenster. Im Gespräch mit ihr stellt sich heraus, daß sie eine Nachbarin von Simone Lagrange war. Aber während sie nichts unternahm, um ihr zu helfen, als die Deutschen kamen, versuchte eine andere Nachbarin, Mme Bontout, die junge Simone vor dem Abtransport durch die Deutschen zu retten; sie zog Simone zu sich herein. Ein SS-Mann kam jedoch zurück, ohrfeigte Mme Bontout und stieß Simone die Treppe hinunter. Ophuls stellt die Passivität der einen Nachbarin, ihre „kleine Schuld“, die dazu beitrug, daß der Holocaust geschehen konnte, dem Mut von Mme Bontout gegenüber. Dieser „guten Nachbarin“ ist der Film gewidmet.
Sucht weiter
In Auschwitz schrieben Häftlinge ihre Erlebnisse in Kassiber und vergruben sie in der Nähe der Gaskammern.30 Einige der Aufzeichnungen wurden nach der Befreiung des Lagers entdeckt. Manche waren von der Feuchtigkeit bereits stark angegriffen. - Auf einem dieser Blätter stand die Aufforderung: „Sucht weiter!“
Die Filme Der Prozeß, Shoah und Hotel Terminus haben sich in einer Zeit, in der die Spuren des Holocaust zu verschwinden drohen, auf die Suche begeben. Mit drei verschiedenen ästhetischen Ansätzen gelingt es Fechner, Lanzmann und Ophuls, die Sprachlosigkeit, die sich angesichts der Vernichtung breitgemacht hat, zu überwinden. Sie setzen bei den Zeitzeugen Prozesse der Erinnerung - oder sogar Vergegenwärtigung - in Bewegung. In den Zuschauern errichten sie ein lebendiges Gedächtnis an die Vernichtungsmaschinerie und ihre Opfer. Die drei Filme ergreifen Partei gegen Passivität und Gleichgültigkeit. Sie mahnen uns, nicht wegzusehen, wenn Menschen bedroht werden, sondern einzugreifen. Die gegenwärtige Situation in Europa zeigt deutlich, wie notwendig die Auseinandersetzung mit Holocaust und Faschismus ist.