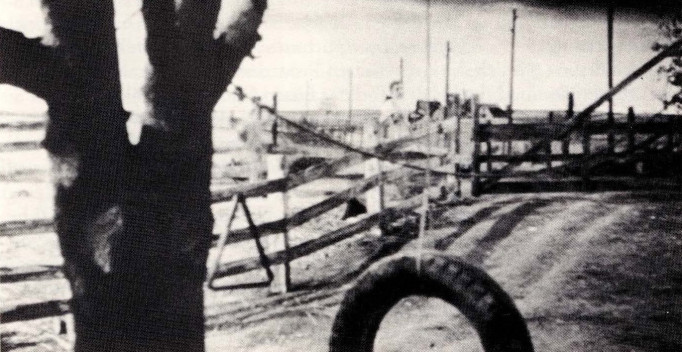Meine erste Geschichte habe ich im Alter von zehn Jahren in Bombay geschrieben; ihr Titel war „Over the Rainbow“ („Über dem Regenbogen“). Sie umfaßte etwa zwölf Seiten, von der Sekretärin meines Vaters fein säuberlich auf dünnes Papier getippt, und schließlich ging sie irgendwo auf den labyrinthischen Reisen meiner Familie zwischen Indien, England und Pakistan verloren. Kurz vor seinem Tod 1987 behauptete mein Vater, eine Kopie davon gefunden zu haben, die in einem alten Aktenordner vermoderte, aber trotz meiner flehentlichen Bitten gab er sie nie heraus, und niemand sonst hat das Ding je zu Gesicht bekommen. Über diesen Vorfall habe ich mich oft gewundert. Vielleicht hatte er die Geschichte in Wirklichkeit gar nicht gefunden, sondern war den Lockungen des Phantasiespiels erlegen, und dies sollte das letzte der vielen Märchen sein, die er mir erzählte; oder aber er fand sie wirklich und nahm sie als Talisman an sich, der ihn an unkompliziertere Zeiten erinnerte, sein Schatz, nicht meiner - sein Topf aus dem Gold elterlicher Wehmut.
Von der Handlung ist mir nicht viel geblieben. Es ging um einen zehnjährigen Jungen aus Bombay, der eines Tages auf den Anfang eines Regenbogens stößt, einen Ort, der so schwer zu fassen ist wie der Inhalt eines goldenen Topfes und ebenso voll von Verheißungen. Der Regenbogen ist breit, so breit wie der Bürgersteig und konstruiert wie ein gewaltiger Treppenaufgang. Natürlich beginnt der Junge, ihn zu erklimmen. Von seinen Abenteuern, neben denen sich The Wizard of Oz („Der Zauberer von Oz“) zum größten Teil wie Spülbecken-Realismus ausnahm, habe ich fast alles vergessen, bis auf eine Begegnung mit einem sprechenden Pianola, dessen Persönlichkeit sich in einer unwahrscheinlichen Kreuzung aus Judy Garland, Elvis Presley und den „Playback-Sängern“ von Hindi-Filmen zusammensetzte. Um mein schlechtes Gedächtnis - meine Mutter würde es eine „Vergesserei“ nennen - ist es wahrscheinlich genauso bestellt. Ich erinnere mich nur an die Hauptsache. Ich erinnere mich, daß The Wizard of Oz - der Film, nicht das Buch, das ich als Kind nicht gelesen habe - mein allererster literarischer Einfluß war. Mehr als das: Ich erinnere mich, daß die Erwägung, mich nach England in die Schule zu schicken, für mich so aufregend war wie irgendeine Reise über den Regenbogen hinaus. Vielleicht ist es schwer zu glauben, aber England schien eine so wunderbare Aussicht zu sein wie Oz.
Der Zauberer jedoch war genau da in Bombay. Mein Vater, Anis Ahmed Rushdie, war für seine kleinen Kinder ein zauberhafter Vater, aber er neigte zu Explosionen, donnernden Wutausbrüchen, Gefühlsblitzen aus heiterem Himmel, drachenhaftem Schnauben und anderen Bedrohlichkeiten jener Art, die auch Oz praktizierte, der Große und Mächtige, der erste Zauberer de Luxe. Und als der Vorhang wegfiel, und seine heranwachsenden Sprößlinge wie Dorothy hinter die Wahrheit über den Erwachsenen-Humbug kamen, fiel mir der Gedanke so leicht wie ihr, daß mein Zauberer tatsächlich ein sehr schlechter Mensch sein muß. Ich brauchte das halbe Leben, um mir darüber klar zu werden, daß die apologia pro vita sua des Großen Oz genausogut auf meinen Vater zutraf - daß auch er ein guter Mensch war, aber ein sehr schlechter Zauberer.
Ich habe diese persönlichen Erinnerungen vorangestellt, weil die Antriebskraft des Films The Wizard of Oz die Unzulänglichkeit der Erwachsenen, selbst der guten Erwachsenen, ist; dieser Film zeigt uns, wie ihre Schwäche Kinder zwingt, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und so, ironischerweise, selbst erwachsen zu werden. Die Reise von Kansas nach Oz ist ein Übergangsritual von einer Welt, in der Dorothys Ersatzeltern, Tante Em und Onkel Henry, ohnmächtig sind, ihr bei der Rettung ihres Hundes Toto vor der marodierenden Jungfer Schlund zu helfen, in eine Welt, in der die Bewohner alle gleich groß sind wie sie und sie niemals wie ein Kind, sondern immer wie eine Heldin behandelt wird. Es ist wahr, sie erwirbt diesen Status durch Zufall, war sie doch an der Entscheidung ihres Hauses nicht beteiligt, die böse Ost-Hexe zu zerquetschen; aber am Ende ihres Abenteuers ist sie mit Sicherheit in diese Schuhe hineingewachsen - oder besser in diese Rubin-Slipper. „Wer hätte gedacht, daß ein braves kleines Mädchen wie du meine herrliche Bosheit zerstören könnte“, jammert die böse West-Hexe, als sie schmilzt - eine Erwachsene, die kleiner wird als ein Kind und ihm weichen muß. Wie die böse West-Hexe verkümmert, ist Dorothy sichtlich zur Erwachsenen erblüht. Dies ist, in meinen Augen, ein sehr viel befriedigenderer Grund für ihre neuentdeckte Zaubermacht über die Rubin-Slipper als die gefühlsduseligen Gründe, die zuerst die unaussprechlich dämliche gute Hexe Glinda und dann Dorothy selbst am abstoßenden Ende des Films Vorbringen, das mir seinen anarchischen Geist von Grund auf zu verraten scheint.
Tante Ems und Onkel Henrys Schwäche angesichts von Jungfer Schlunds Wunsch, Toto auszulöschen, weckt in Dorothy den kindlichen Wunsch, von zu Hause wegzulaufen - zu flüchten. Deshalb ist sie nicht zusammen mit den andern im Schutzkeller, als der Tornado zuschlägt, und wird, als Folge davon, an einen Fluchtpunkt jenseits ihrer verrücktesten Träume gewirbelt. Später jedoch, als sie sich der Schwäche des Zauberers von Oz gegenübersieht, rennt sie nicht weg, sondern nimmt den Kampf auf - erst gegen die böse Hexe, dann gegen den Zauberer selbst. Die Unfähigkeit des Zauberers ist eine der zahlreichen Symmetrien des Films und entspricht der Schwäche von Dorothys Angehörigen; aber es ist Dorothys veränderte Reaktionsweise, auf die es ankommt.
Der Zehnjährige, der den Film The Wizard of Oz im „Metro“-Kino von Bombay sah, hatte nur sehr wenig Ahnung von fremden Gegenden und noch weniger vom Erwachsenwerden. Er wußte dagegen eine ganze Menge mehr über das phantastische Kino als irgendein westliches Kind seines Alters. Im Westen war der Film ein Sonderling, der Versuch, eine Art Disney-Trickfilm mit lebendigen Figuren zu schaffen, obwohl die Kinoindustrie längst zur Einsicht gelangt war, daß sich phantastische Filme letzten Endes als Flops herausstellten. (Tatsächlich spielte der Film nie wirklich Geld ein, bevor er, Jahre nach seiner Kinopremiere, zum Fernsehklassiker wurde; man muß ihm dabei als mildernden Umstand zugute halten, daß der Zeitpunkt der Uraufführung zwei Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkrieges seine Chancen nicht gerade verbessert haben konnte.) In Indien dagegen entsprach er dem Sproß eines der damaligen und aktuellen Hauptproduktionszweige von Bollywood, wie Inder liebevoll diesen Ort nennen, indem sie die Namen von Bombay und der Glamourstadt miteinander verschmelzen.
Es ist nicht schwer, eine Satire auf die Hindi-Filme zu machen. In James Ivorys Film Bombay Talkie („Ein Tonfilm über Bombay“) besucht eine Romanschriftstellerin (die anrührende Jennifer Kendal, die 1984 gestorben ist) ein Tonfilmstudio und beobachtet eine unglaubliche Tanznummer, in der spärlich bekleidete Bajaderen auf den Tasten einer riesigen Schreibmaschine tanzen. Der Regisseur erklärt, die Tasten der Schreibmaschine würden die „Klaviatur des Lebens“ darstellen, und wir alle würden „die Geschichte unseres Schicksals“ auf der Großen Maschine tanzen. „Sehr symbolisch“, wie Jennifer Kendal meint. „Danke!“ erwidert der Regisseur mit einem affektierten Lächeln. Schreibmaschinen des Lebens, Sex-Göttinnen in nassen Saris (die indische Entsprechung zu „Wet T-Shirts“), vom Himmel herabsteigende Götter, die sich in irdische Angelegenheiten einmischen, Superhelden, dämonische Bösewichte und so weiter bildeten seit jeher die Hauptkost des indischen Kinogängers. Es mag Dorothy zu einem Kommentar über die Hochgeschwindigkeit und Wunderlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs in Oz bewegen, daß die blonde Glinda in einer magischen Kugel im Mümmlerland ankommt; aber für ein indisches Publikum war gerade diese Form der Ankunft einer Gottheit angemessen: ex machina, aus ihrer eigenen Maschine. Gleichermaßen entsprachen die orangen Rauchwolken der bösen West-Hexe ihrem Status als Super-Bösewicht.
Es liegt aber auf der Hand, daß es trotz aller Übereinstimmungen gewichtige Unterschiede zwischen dem Bombay-Kino und einem Film wie The Wizard of Oz gab. Oberflächlich mögen gute Feen und böse Hexen den Gottheiten und Dämonen des Hindu-Pantheons gleichen, aber in Tat und Wahrheit ist einer der bemerkenswertesten Aspekte der Weltanschauung von The Wizard of Oz sein lustvoller und beinahe allumfassender Säkularismus. Die Religion wird im ganzen Film nur einmal erwähnt: Tante Em erklärt, als sie die grausliche Jungfer Schlund vor Wut nur anstottern kann, sie habe Jahre darauf gewartet, ihr zu sagen, was sie von ihr halte, „und jetzt, ja, jetzt bringe ich es als gute Christin nicht über die Lippen“. Außer in diesem Augenblick, in dem christliche Nächstenliebe beherzter Offenheit im Wege steht, ist der Film von unbeschwerter und heiterer Gottlosigkeit. In Oz selbst gibt es keine Spur von Religion - böse Hexen werden gefürchtet, gute geliebt, aber keine ist heilig -, und obwohl der Zauberer von Oz für nahezu allmächtig gehalten wird, kommt niemand auf die Idee, ihn anzubeten. Diese Abwesenheit höherer Werte vergrößert den Charme des Films beträchtlich und trägt wesentlich zu seinem erfolgreichen Entwurf einer Welt bei, in der nichts mehr wiegt als die Liebe, die Fürsorge und die Bedürfnisse von menschlichen Wesen (und natürlich von Wesen aus Blech, Wesen aus Stroh, Löwen und Hunden).
Der andere Hauptunterschied ist schwieriger zu bestimmen, denn es handelt sich letztlich um eine Sache der Qualität. Damals wie heute kann man die meisten Hindi-Filme nur als Schund bezeichnen. Das Vergnügen, das sie bereiten (und manche sind ausgesprochen vergnüglich), ähnelt dem Spaß daran, Junk Food zu essen. Dem klassischen Bombay-Tonfilm hegt ein entsetzlich schmalziges Drehbuch zugrunde, er kommt abwechselnd grell und vulgär oder beides zugleich daher und verläßt sich auf die Massenwirksamkeit seiner Stars und seiner musikalischen Einlagen, um etwas Schwung zu erzeugen. Auch The Wizard of Oz hat Stars und musikalische Einlagen, aber es ist mit ebensolcher Bestimmtheit ein Guter Film. Er nimmt das Phantastische von Bombay und fügt hohe Produktionsstandards hinzu und etwas mehr - etwas, das man im Kino sehr selten findet. Nennen Sie es die Wahrheit der Einbildungskraft. Nennen Sie es - greifen Sie jetzt zu Ihren Revolvern - Kunst.
Aber wenn The Wizard of Oz ein Kunstwerk ist, so ist es außerordentlich schwierig, den Künstler zu bestimmen. Die Geburt von Oz selbst ist bereits zur Legende geworden: Der Autor, L. Frank Baum, benannte seine Zauberwelt nach den Buchstaben „O-Z“ auf der untersten Schublade seines Aktenschrankes. Sein Originalbuch, The Wonderful Wizard of Oz („Der wunderbare Zauberer von Oz“), das 1900 veröffentlicht wurde, enthält bereits zahlreiche Zutaten des Zaubertranks: So ziemlich alle zentralen Figuren und Ereignisse sind da, ebenso wie die wichtigsten Schauplätze - die gelbe Ziegelsteinstraße, das tödliche Mohnfeld, die Smaragdstadt. Aber die Verfilmung von The Wizard of Oz gehört zu den seltenen Fällen, in denen der Film ein gutes Buch noch übertrifft. Eine der Änderungen ist die Ausweitung des Kansas-Teils, der im Buch noch genau zwei Seiten zu Beginn umfaßt, vor der Ankunft des Tornados, und gerade neun Zeilen am Schluß; eine weitere ist eine gewisse Vereinfachung der Handlung im Oz-Teil: Alle Nebenstränge wurden gekappt, etwa die Besuche der Kampfbäume, des Prozellan-Landes und des Pummel-Landes, die im Roman unmittelbar auf den dramatischen Höhepunkt folgen und seinen erzählerischen Schwung bremsen. Und es gibt zwei weitere Änderungen von noch größerer Tragweite. Frank Baums Smaragdstadt war nur deshalb grün, weil alle Bewohner und Besucher smaragdgrüngetönte Brillen tragen mußten, aber im Film ist tatsächlich alles von einem futuristischen Chlorophyllgrün - bis auf das Andersfarbene-Pferd-von-dem-Ihr-gehört-Habt. Das Andersfarbene-Pferd wechselt seine Farbe in allen aufeinanderfolgenden Einstellungen - ein Effekt, der bewerkstelligt wurde, indem man sechs verschiedene Pferde jeweils mit andersfarbener Gelatine einpuderte. (Diese und andere Anekdoten zur Produktion des Films verdanke ich Aljean Harmetz’ Standardwerk The Making of The Wizard of Oz [„Die Entstehung von The Wizard of Oz“].) Die letzte und wichtigste aller Änderungen aber sind die Rubin-Slipper. Ihr Erfinder ist nicht Frank Baum; in seinem Buch sind es statt dessen Silberschuhe. Ursprünglich folgte Noel Langley, der erste der drei aufgeführten Drehbuchautoren, der Idee von Baum. Aber in seinem vierten Skript, dem Skript vom 14. Mai 1938, bekannt als das „Nimm keine Änderungen vor“- Skript, ist das dumpf metallene und unmythische Schuhwerk über Bord geworfen und durch die unsterblichen Juwelen-Schuhe ersetzt worden. (In Einstellung 114 „erscheinen die Rubin-Schuhe an Dorothys Füßen, sie glitzern und funkeln in der Sonne“.)
Andere Autoren haben wichtige Details zur Endfassung des Drehbuchs beigetragen. Vermutlich waren Florence Ryerson und Edgar Allen Woolf für die Wendung „Es ist nirgends besser als daheim“ verantwortlich, die für mich die am wenigsten überzeugende Idee des ganzen Films ist. (Dorothys Wunsch heimzukehren, ist die eine Sache, eine ganz andere, daß sie diesem nur durch eine Lobpreisung des Ideal-Staates Ausdruck geben kann, der Kansas doch so offensichtlich nicht ist.) Aber auch darüber gehen die Meinungen auseinander; eine Aktennotiz des Studios läßt darauf schließen, daß dem zweiten Produzenten, Arthur Freed, der niedliche Slogan zuerst eingefallen ist. Und nach zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen Langley und dem Ryerson-Woolf- Team hat schließlich Yip Harburg, der Liedtextdichter des Films, die Endfassung des Drehbuchs geordnet und gestrafft: Er fügte jene Schlüsselszene hinzu, in welcher der Zauberer, unfähig die Wünsche der Reisegefährten zu erfüllen, ihnen stattdessen Symbole überreicht, und, zu unserer „satirischen und zynischen“ Befriedigung (so Harburgs eigene Adjektive), funktionieren diese tatsächlich. Der Name der Rose erweist sich am Ende als Rose selbst.
Wer aber ist jetzt der Autor von Der Zauberer von Oz? Kein einzelner Schriftsteller kann diese Ehre für sich in Anspruch nehmen, nicht einmal der Autor des Originalbuches. Sowohl Mervyn Le Roy wie Arthur Freed, die Produzenten, haben ihre Verfechter. Wenigstens vier Regisseure haben an dem Film gearbeitet, allen voran Victor Fleming, der jedoch noch vor Beendigung der Dreharbeiten den Hut nahm, um Gone with the Wind („Vom Winde verweht“) verwirklichen zu können - jener Film, der ironischerweise die Oscar-Preisverleihung 1940 dominierte, während The Wizard of Oz nur drei Auszeichnungen gewann: in den Kategorien „Bester Song“ („Over the Rainbow“), „Beste Partitur“ und einen Spezialpreis für Judy Garland. In Tat und Wahrheit kommt dieser großartige Film - bei dem die Streitigkeiten, Entlassungen und Beinahe-Patzer aller Beteiligten zu einem scheinbar reinen, anstrengungslosen und irgendwie zwangsläufigen Segen geführt haben - jenem Phantom der modernen Literaturtheorie so nahe wie nur irgend möglich: dem autorlosen Text.
Das von Frank Baum gezeichnete Kansas ist ein deprimierender Ort. So weit das Auge reicht, ist alles darin grau: Die Prärie ist genauso grau wie das Haus, in dem Dorothy lebt. Was Tante Em betrifft: „Sonne und Wind [...] hatten das strahlende Leuchten in ihren Augen gelöscht, so daß sie nüchtern und grau blickten; sie nahmen die Röte von ihren Wangen und Lippen, auch sie waren grau. Sie war dünn und hager geworden und hatte das Lächeln verlernt.“ Und: „Auch Onkel Henry lachte nie. [...] Er war ebenfalls grau, grau von seinem langen Bart hinab zu den groben Stiefeln“. Der Himmel? Er war „noch grauer als sonst“. Zum Glück blieb Toto vor dem Grau verschont. Er „bewahrte [Dorothy] davor, so stumpf und farblos zu werden wie ihre Umgebung“. Er war zwar nicht gerade farbenreich, aber seine Augen funkelten, und sein Fell war seidenweich. Toto war schwarz.
Aus diesem Grau heraus - dem versammelten Grau dieser öden Welt - kommt die Katastrophe. Der Tornado ist das ganze Grau zusammengenommen, herumgewirbelt und sozusagen auf sich selbst losgelassen. Und all dem gegenüber verhält sich die Verfilmung erstaunlich treu, indem sie die Kansas-Szenen in sogenanntem Schwarzweiß dreht (in Wirklichkeit eine Vielzahl von Grautönen) und ihre Bilder dunkel hält, bis sie vom Sog des Wirbelwinds aufgesaugt und zerfetzt werden.
Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, den Tornado zu interpretieren. Dorothy hat einen Nachnamen: Stürm (Gale). Und in mancher Hinsicht ist Dorothy der Sturm, der durch dieses kleine, abgelegene Niemandsland fegt, auf der Suche nach Gerechtigkeit für ihren kleinen Hund, während die Erwachsenen vor der mächtigen Jungfer Schlund duckmäusern; Dorothy, die bereit ist, dem unentrinnbaren Grau ihres Lebens zu entfliehen, indem sie wegläuft, und die so weichherzig ist, daß sie zurückeilt, als sie von Professor Marvel erfährt, wie verzweifelt ihre Tante Em darüber ist. Dorothy verkörpert die Lebenskraft von Kansas, genauso wie Jungfer Schlund den Tod; und vielleicht sind es Dorothys Gefühle oder der zwischen Dorothy und Jungfer Schlund entfesselte Orkan von Gefühlen, der in der großen, dunklen Wolkennatter aktualisiert wird, die sich um die Prärie ringelt und die Welt verschlingt.
Das Kansas des Films ist etwas weniger beharrlich öde als das Kansas des Buches, und sei es nur, weil die drei Landarbeiter und Professor Marvel eingeführt werden - vier Protagonisten, die ihre Entsprechungen oder Ebenbilder in den drei Reisegefährten von Oz und dem Zauberer selbst finden werden. Andrerseits ist das Kansas des Films auch bedrohlicher als dasjenige des Buches, denn hier kommt die Gegenwart des wahrhaft Bösen hinzu: die kantige Jungfer Schlund, deren Profil so scharfgeschnitten ist, daß man einen Braten damit tranchieren könnte; steif führt sie auf ihrem Fahrrad einen Hut spazieren, der aussieht wie ein Plumpudding oder eine Bombe, und nimmt als Rechtfertigung ihres Kreuzzugs gegen Toto für sich in Anspruch, das Gesetz zu hüten. Jungfer Schlund ist es zu verdanken, daß das Kansas des Films nicht nur aus der Traurigkeit bitterer Landarmut, sondern auch aus der Bösartigkeit von Möchtegern-Hundemördern besteht.
Und dies ist jenes Daheim, wo „es besser ist als Nirgendwo“? Dies ist das verlorene Paradies, das wir (wie Dorothy es tut) Oz vorziehen sollen?
Ich erinnere mich oder stelle mir vor, mich zu erinnern, daß mir Dorothys Daheim beim ersten Besuch des Films als verwahrlostes Nest erschien. Selbstverständlich würde ich gerne wieder heimkehren, wäre ich nach Oz entführt worden, denn ich hatte vieles, zu dem ich zurückkehren konnte, so meine Schlußfolgerung. Aber Dorothy? Vielleicht sollten wir sie einladen, bei uns zu bleiben; überall sieht es besser aus als dort.
Noch ein Gedanke ging mir durch den Kopf, der mich mit einer heimlichen Achtung vor der bösen Hexe erfüllte: Ich konnte Toto nicht ausstehen! Ich kann es noch immer nicht. Wie sagt Gollum über den Hobbit Bilbo Baggins in einer andern großen phantastischen Erzählung: „Baggins: Unser Haß soll ihn in tausend Stücke reißen!“ Toto: dieses kleine, kläffende Haarbüschel von einer Kreatur, dieses aufdringliche Toupet! Der bewundernswerte Frank Baum gab dem Hund eine bedeutend geringere Rolle: Er hielt Dorothy bei Laune, und wenn sie unglücklich war, pflegte er „furchtbar zu winseln“ - kein gewinnender Zug. Der einzige wirklich wichtige Beitrag des Hundes zu Baums Geschichte bestand darin, daß er zufällig gegen den Wandschirm stieß, hinter dem sich der Zauberer versteckte. Im Film zieht Toto sehr viel absichtsvoller einen Vorhang beiseite, um den Großen Schwindler zu entlarven, und dieser Eingriff erschien mir trotz allem als irritierendes Moment der Störung. Ich war nicht überrascht zu erfahren, daß der Hundedarsteller, der Toto verkörperte, von Starallüren besessen war und eines Tages sogar die Dreharbeiten durch einen bühnenreifen Nervenzusammenbruch zum Stillstand brachte. Daß Toto das einzige wahre Liebesobjekt des Films sein soll, hat mich immer gewurmt.
Der Film beginnt. Wir befinden uns in der Schwarzweiß-Welt, in der „wirklichen“ Welt von Kansas. Ein Mädchen und ihr Hund laufen auf einem Feldweg. „Sie verfolgt uns noch nicht, Toto. Hat sie dich verletzt? Sie hat es versucht, nicht wahr?“ Ein wirkliches Mädchen, ein wirklicher Hund und, von der allerersten Zeile des Dialogs an, der Beginn eines wirklichen Dramas. Kansas jedoch ist nicht wirklich - nicht wirklicher als Oz. Kansas ist ein Pastell. Dorothy und Toto sind in den MGM-Studios ein kurzes Stück „Weg“ entlanggelaufen, und diese Aufnahme wurde über ein Bild der Leere gelegt. „Wirkliche“ Leere wäre wahrscheinlich nicht leer genug. Dieses Kansas kommt dem allumfassenden Grau von Baums Geschichte verwechselbar nahe, die Leere wird nur durch zwei Zäune und die vertikalen Linien von Telegraphenstangen unterbrochen. Die Studioszenerie von Kansas suggeriert, daß Kansas genauso wie Oz im Nirgendwo liegt. Dies ist eine Notwendigkeit. Eine realistische Darstellung der extremen Armut von Dorothys Umgebung wäre eine Bürde gewesen, deren erdrückendes Gewicht den imaginären Sprung ins Geschichtenland, den Segelflug nach Oz, verunmöglicht hätte. Es ist wahr, daß der Realismus der Grimmschen Märchen oft grob ist. Bis es dem Zauberbutt begegnet, lebt das eponyme Paar in „De Fischer un sine Fru“ in einem „Piß-Pot“, wie er kurz und bündig genannt wird. Aber in zahlreichen Kinder-Versionen des Märchens wird der Piß-Pot als „Bruchbude“ oder noch zurückhaltender beschönigt. Hollywoods Blick war immer schon von diesem Weichzeichner verklärt. Dorothy erscheint außerordentlich wohlgenährt, und sie ist nicht wirklich, sondern unwirklich arm.
Sie erreicht den Bauernhof, und hier - wir halten das Bild an - taucht zum erstenmal ein wiederkehrendes visuelles Motiv auf. Die angehaltene Szene zeigt Dorothy und Toto im Hintergrund, wie sie auf ein Gatter zusteuern. Auf der linken Seite des Bildes sieht man einen Baumstamm, eine vertikale Linie, das Echo der Telegraphenstangen in der vorangegangenen Szene. Von einem ungefähr horizontalen Ast hängen ein Triangel (der dazu dient, die Landarbeiter zum Essen zu rufen) und ein Kreis (eigentlich ein Gummireifen) herab. In der Bildmitte sind weitere geometrische Elemente zu erkennen: die parallelen Linien des Holzzauns, die diagonale Holzstange beim Gatter, die das Bild teilt. Später, wenn wir das Haus sehen, wird diese einfache Geometrie wieder vergegenwärtigt und thematisiert: Alles besteht aus rechten Winkeln und Dreiecken. Durch den Gebrauch von einfachen, unkomplizierten Formen wird die Welt von Kansas, diese große Leere, als „Daheim“ bestimmt - hier finden Sie nichts von Ihrer verstädterten Komplexität. Den ganzen Film hindurch wird häusliche Geborgenheit und Sicherheit durch diese geometrische Einfachheit repräsentiert, während die Gefahr und das Böse ausnahmslos verdreht, ungestalt und unförmig sind. Der Tornado hat genau diese unzuverlässige, wirblige, veränderliche Gestalt. Als entfesselter Zufall zerstört er die einfachen Umrisse dieses schlichten Lebens.
Merkwürdigerweise beschwört die Kansas-Sequenz nicht nur die Geometrie, sondern auch die Arithmetik, denn wie verhalten sich Tante Em und Onkel Henry, als Dorothy, so stürmisch wie sie ist, zum erstenmal mit ihren Ängsten um Toto über sie hereinbricht? Warum scheuchen sie Dorothy weg? „Wir versuchen zu zählen“, ermahnen sie Dorothy, während sie eine Zählung der Küken - ihrer metaphorischen Hühner, ihrer kleinen Hoffnung auf etwas Einkommen - vornehmen, die der Tornado bald darauf Verblasen wird. Mit einfachen Formen und Zahlen setzt sich Dorothys Familie also gegen die riesige Leere zur Wehr, die zum Verrücktwerden ist; und selbstredend bieten sie keinen Schutz.
Springen wir gleich nach Oz, so wird augenfällig, daß dieser Gegensatz zwischen dem Geometrischen und dem Verdrehten kein Zufall ist. Schauen Sie sich den Ausgangspunkt der gelben Ziegelsteinstraße an: Es ist eine perfekte Spirale. Schauen Sie sich Glindas Transportmittel an, diese perfekte, strahlende Kugel. Schauen Sie sich die eingedrillten Prozeduren der Mümmler an, als sie Dorothy grüßen und ihr für den Tod der bösen Ost-Hexe danken. Gehen Sie weiter zur Smaragdstadt: Betrachten Sie sie aus der Distanz, wie ihre geraden Linien in den Himmel streben! Und nun beobachten sie im Kontrast dazu die böse West-Hexe: ihre gebückte Gestalt, ihr unförmiger Hut. Wie tritt sie auf und ab? In einer formlosen Rauchwolke. „Nur böse Hexen sind häßlich“, sagt Glinda zu Dorothy, eine Bemerkung, der jedes liberale Feingefühl fehlt; sie betont die Feindseligkeit des Films gegen alles, was verwirrend, krumm und sonderbar ist. Die Wälder jagen immer Angst ein - die knorrigen Aste der Bäume können sogar zu bedrohlichem Leben erwachen -, und im selben Augenblick, in dem die gelbe Ziegelsteinstraße Dorothy verwirrt, verliert sie ihre geometrische Form (erst spiralförmig, dann geradlinig) und splittert und gabelt sich in alle Richtungen auf.
Zurück in Kansas hebt Tante Em zu jener Schelte an, die den Auftakt zu einem unsterblichen Moment der Kinogeschichte bildet.
„Immer gerätst du in Sorge wegen nichts [...]. Such dir einen Ort, an dem du nicht in Schwierigkeiten gerätst!“
„Ein Ort ohne Aufregungen. Glaubst du, es gibt einen solchen Ort, Toto? Das muß es doch.“
Jeder, der die Idee der Drehbuchautoren geschluckt hat, dieser Film handle vom Vorzug des „Daheim“-Seins gegenüber dem „Weg“-Sein und daß die „Moral“ von The Wizard of Oz so rührselig ist wie die Stickerei „Osten, Westen, daheim ist’s am besten“ auf einem Kissen, täte gut daran, auf den sehnsuchtsvollen Ton in Judy Garlands Stimme zu achten, als sie ihren Blick gegen den Himmel richtet. Was sie hier ausdrückt und mit der Reinheit eines Archetypus verkörpert, ist der Menschheitstraum vom Weggehen - ein Traum, der wenigstens so mächtig ist wie sein Gegengewicht, der Traum vom Verwurzeltsein. Die große Spannung zwischen diesen beiden Träumen bildet das Herz von The Wizard of Oz. Aber gibt es einen Zweifel, welche Botschaft überwiegt, wenn man hört, wie die Musik anschwillt und diese starke, reine Stimme sich in die schmerzliche Sehnsucht des Songs erhebt? In seinen bewegendsten Momenten ist The Wizard of Oz unbezweifelbar ein Film über die Freuden, die einen erfüllen, wenn man weggeht, das Grau verläßt und in die Farbe eintritt, ein neues Leben aufbaut an einem Ort, „an dem du nicht in Schwierigkeiten gerätst“. „Over the Rainbow“ ist die Hymne aller Migranten dieser Welt (oder sollte es zumindest sein), all jener, die sich auf der Suche nach jenem Ort befinden, „wo die Träume, die du zu träumen wagst, sich tatsächlich verwirklichen“. Es ist eine Feier der Flucht, ein Lobgesang auf das entwurzelte Selbst, eine Hymne - die Hymne - an das Anderswo.
Einer der Hauptdarsteller unter den Mitwirkenden hat sich darüber beklagt, daß es im Film „keine Schauspielerei gab“, und im üblichen Sinn stimmte das auch. Aber als Judy Garland „Over the Rainbow“ sang, tat sie etwas Außergewöhnliches: In diesem Moment verlieh sie dem Film sein Herz, und die Kraft ihrer Verkündung ist stark, süß und tief genug, um uns über all die Einfältigkeiten hinwegzuhelfen, die folgen, ja um ihnen etwas Anrührendes, einen verletzlichen Charme zu verleihen, mit dem sonst nur Bert Lahrs gleichermaßen außergewöhnliche Schöpfung des Feigen Löwen verglichen werden kann.
Was ist noch zu Judy Garlands Dorothy zu sagen? Die allgemeine Meinung geht dahin, daß ihre Darstellung an ironischer Kraft gewinnt, weil deren Unschuld einen so starken Kontrast zu dem bildet, was wir vom schwierigen späteren Leben der Schauspielerin wissen. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Mir scheinen die Gründe des Erfolgs eher in der Darstellung selbst und im Film zu liegen. Judy Garlands Aufgabe war es, einen beinahe unmöglichen Trick zu vollbringen. Einerseits soll sie die Tabula rasa des Films sein, die Schiefertafel, auf der sich die Handlung der Geschichte Schritt für Schritt von selbst schreibt - oder (weil es sich um einen Film handelt) die Leinwand, auf der die Handlung spielt. Bewaffnet nur mit ihrem offenherzigen Blick, muß sie gleichermaßen das Objekt wie das Subjekt des Films verkörpern und sich die Möglichkeit einräumen, jenes leere Gefäß zu sein, das der Film langsam füllt. Andrerseits muß sie gleichzeitig (mit etwas Hilfe des Feigen Löwen) das ganze emotionale Gewicht des Films, seine ganze Wirbelkraft tragen. Daß ihr beides gelingt, verdankt sich nicht nur der reifen Tiefe ihrer Singstimme, sondern auch ihrer eigenartigen Stämmigkeit, ihrer linkischen Art, womit sie unsere Zuneigung gerade deshalb gewinnt, weil es nur halbschön ist, jolie-laide, und nicht jene Pose der Allerliebstheit, mit der sich Shirley Temple der Rolle angenommen hätte - und die Besetzung durch Shirley Temple wurde ernsthaft erwogen. Der Film funktioniert, weil Judy Garlands frischgewaschenes und - wenn auch nur sehr andeutungsweise - massiges Auftreten nicht sexy ist. Man kann sich die verhängnisvolle Koketterie vorstellen, welche die junge Shirley ins Spiel gebracht hätte, und dankbar dafür sein, daß Twentieth Century Fox sich geweigert hat, sie an MGM auszuleihen.
Der Tornado, der auf Dorothys Zuhause niedersaust, schafft das zweite genuin mythische Bild von The Wizard of Oz: der archetypische Mythus des Umzugs mit Kind und Kegel, wie man sagen könnte. In dieser Übergangssequenz des Films, in der die unwirkliche Wirklichkeit von Kansas der realistischen Surrealität der Zauberwelt weicht, kommen, wie es sich für einen Moment des Schwellenübertritts gehört, zahlreiche Fenster und Türen vor. Erst öffnen die Landarbeiter die Türen zum Schutzkeller, und Onkel Henry, heroisch wie eh und je, überzeugt Tante Em, daß es zu gefährlich sei, länger auf Dorothy zu warten. Dann öffnet Dorothy, die gerade zusammen mit Toto von ihrem Versuch zurückkommt, von zu Hause wegzulaufen, die Außentür des Hauptgebäudes, die sofort aus den Angeln gehoben und fortgeblasen wird. Drittens sehen wir, wie die andern die Fenster des Schutzkellers schließen. Als viertes öffnet Dorothy auf ihrer panischen Suche nach Tante Em innerhalb des Hauses eine Tür. Als fünftes geht Dorothy zum Schutzkeller, aber seine Türen sind bereits verrammelt. Als sechstes zieht sich Dorothy ins Hauptgebäude zurück, ihr Ruf nach Tante Em verhallt schwach und angsterfüllt; worauf ein Fenster sich wie das Echo auf die Außentür aus seinen Angeln löst und Dorothy niederschlägt. Sie fällt aufs Bett, und von nun an regiert die Magie. Wir haben das wichtigste Tor des Films durchschritten.
Aber dieser Kunstgriff - das Ausschalten von Dorothys Bewußtsein - ist die radikalste und schlimmste Änderung, die an Frank Baums Originalkonzeption vorgenommen worden ist. Denn im Buch steht es nie in Frage, daß Oz wirklich ist - ein Ort von derselben Ordnung, wenn auch nicht von derselben Art wie Kansas. Wie die TV-Serie „Dallas“ führt der Film gleichzeitig mit der Möglichkeit, alles Folgende nur als Traum zu verstehen, ein Moment der Arglist ein. Diese Form der Arglist hat „Dallas“ das Publikum gekostet und die Serie wahrscheinlich um ihre Fortsetzung gebracht. Daß dem Film The Wizard of Oz das Schicksal dieser Fernsehserie erspart geblieben ist, zeugt für seine Einheit als Ganzes, die es ihm erlaubt hat, sich diesem ergrauten, sich immer weiterschleppenden Klischee überlegen zu zeigen.
Während das Haus durch die Luft fliegt und aussieht wie das kleine Spielzeug, das es tatsächlich ist, „erwacht“ Dorothy. Was sie durch das Fenster sieht, ist eine Art Film - das Fenster stellt eine Kinoleinwand dar, die eine Einstellung innerhalb der Einstellung zeigt -, ein Film, der sie auf die neue Art Film vorbereitet, in den sie bald geraten wird. Die Spezialeffekte, die für ihre Zeit sehr raffiniert waren, zeigen unter anderem eine Frau, die strickend in ihrem Schaukelstuhl sitzt, als der Tornado sie vorbeiwirbelt, eine Kuh, die seelenruhig im Auge des Orkans steht, zwei Männer, die ein Boot durch die sturmgepeitschte Luft rudern, und, am allerwichtigsten, die Gestalt von Jungfer Schlund auf ihrem Fahrrad, die sich, während wir sie sehen, in die Gestalt der bösen West-Hexe auf ihrem Besenstiel verwandelt. Ihr Umhang flattert hinter ihr und ihr gewaltig gackerndes Lachen erhebt sich über den Sturm.
Das Haus landet; Dorothy verläßt das Schlafzimmer mit Toto auf dem Arm. Wir haben den Moment erreicht, in dem die Farbe einsetzt. Aber die erste Farb-Einstellung, in der Dorothy von der Kamera weg- und auf die Haustür zugeht, ist mit Absicht matt gehalten, ein Versuch, sie dem vorangegangenen Schwarzweiß anzugleichen. Dann, ist die Tür erst einmal geöffnet, überflutet Farbe die Leinwand. In unseren farbübersättigten Tagen können wir uns kaum mehr in eine Zeit zurückversetzen, als Farbe in Filmen noch vergleichsweise selten war. Wenn ich noch einmal an meine Kindheit in Bombay zurückdenke - in den fünfziger Jahren, eine Zeit, in der alle Hindi-Filme ausnahmslos schwarzweiß waren -, kann ich mich gut an die Aufregung erinnern, die das Erscheinen der Farbe ausgelöst hat. In einem Epos über den Großen Mughal, Akbar der Eroberer, das den Titel Mughal-e-Azam trug, gab es nur eine Rolle mit Farbfilm, in welcher die sagenhafte Anarkali einen Tanz bei Hofe aufführte. Aber diese Filmrolle alleine garantierte bereits den Erfolg des Films und zog ein Millionenpublikum an.
Die Schöpfer von The Wizard of Oz haben sich sehr bestimmt dafür entschieden, ihren Farben soviel Farbenpracht wie möglich zu verleihen, etwa so wie Michelangelo Antonioni Jahre später in seinem ersten Farbfilm, II Deserto rosso („Die rote Wüste“). In Antonionis Film dient die Farbe dazu, überhöhte und oft surrealistische Effekte zu schaffen. Ebenso sucht The Wizard of Oz einen gewagten, klatschenden Expressionismus - im Gelb der Ziegelsteinstraße, im Rot des Mohnfeldes, im Grün der Smaragdstadt und der Haut der Hexe. Die Farbeffekte des Films waren so eindrücklich, daß ich bald, nachdem ich ihn als Kind zum erstenmal gesehen hatte, begann, von grünhäutigen Hexen zu träumen; und Jahre später ließ ich den Erzähler meines Romans Midnight’s Children („Mitternachtskinder“) diese Träume träumen, wobei ich ihre Quelle vollständig vergessen hatte. „Keine Farben außer Grün und Schwarz die Wände sind grün der Himmel ist schwarz [...] die Sterne sind grün die Witwe ist grün aber ihr Haar ist so schwarz wie Schwarz“: So begann die Stream-of-Consciousness-Traumsequenz, die den Alptraum von Indira Gandhi mit der Alptraum-Gestalt von Margaret Hamilton verschmolz - eine Zusammenkunft der bösen Ost- und der bösen West-Hexe.
Als Dorothy, die aussieht wie ein blau-blusiges Schneewittchen (keine Prinzessin, aber ein gutes, volkstümliches amerikanisches Mädchen), in die Farbe tritt, eingerahmt von exotischem Blätterwerk und vor einer Gruppe winziger Häuschen, trifft sie das Fehlen des von daheim vertrauten Graus sichtlich wie ein Schlag. „Toto, mir schwant, wir sind nicht mehr in Kansas“, sagt sie, und dieser Klassiker von einer unfreiwillig komischen Dialogzeile hat sich vom Film gelöst, um ein beliebtes amerikanisches Schlagwort zu werden, das endlos wiederverwertet wird, ja es taucht sogar als eines der Mottos zu Thomas Pynchons paranoidem Riesen-Roman über den Zweiten Weltkrieg auf, Gravity’s Rainbow („Die Enden der Parabel“), dessen Protagonisten ihr Schicksal nicht „hinter dem Mond, hinter dem Regen“, aber „jenseits der Null“ des Bewußtseins finden, ein Land, das wenigstens so bizarr ist wie Oz.
Aber Dorothy hat mehr vollzogen als den Schritt aus dem Grau in die Technicolor-Welt. Ihre Heimatlosigkeit, ihre Unbehaustheit wird durch den Umstand unterstrichen, daß ihr - nach all dem Türenspiel der Übergangssequenz und nachdem sie jetzt nach draußen getreten ist - kein Zugang mehr zu irgendeinem Innenraum gewährt wird, bis sie die Smaragdstadt erreicht. Vom Tornado bis zur Begegnung mit dem Zauberer hat Dorothy nie ein Dach über dem Kopf. Da draußen zwischen den gigantischen Stockrosen, deren Eine perfekte Spirale bildet den Ausgangspunkt der gelben Ziegelsteinstraße, eine Geometrie, die sieb später auflösen wird. (Foto British Film Institute) Blüten wie alte Grammophontrichter aussehen, schutzlos dem offenen Raum ausgesetzt (der doch so gar nicht der Prärie von Kansas entspricht), übertrifft Dorothy Schneewittchen um den Faktor von beinahe zwanzig. Man kann fast hören, wie die M GM-Studiobosse aushecken, den Disney-Erfolg in den Schatten zu stellen - nicht nur, indem sie mit lebendigen Figuren nahezu so viele technische Wunder vorführen lassen, wie sie die Disney-Cartoonisten kreierten, sondern auch, indem sie Disney in bezug auf die Heinzelmännchen ausstechen. Hatte Schneewittchen sieben Zwerge, sollte Dorothy Stürm vom Stern namens Kansas eben hundertvierundzwanzig haben.
Die Mümmler wurden genau wie dreidimensionale Trickfilmfiguren zurechtgemacht und kostümiert. Der Bürgermeister von Mümmlerstadt ist unwahrscheinlich rund; der Coroner trägt einen Hut, dessen Krempe auf absurde Weise einer Schriftrolle gleicht, als er den amtlichen Totenschein der bösen Ost-Hexe vorsingt („And she’s not only merely dead, she’s really most sincerely dead“/“Nicht nur beinahe halbtot ist sie, sondern in aller Aufrichtigkeit ganz tot“); die Stirnlocken der Lollipop-Kinder, die offenbar durch den Hinterhof und die Sackgasse nach Oz gekommen sind, ragen noch steifer in die Höhe als diejenige von Tintin. Tatsächlich aber gelingt es The Wizard of Oz mit dieser Szenenfolge, die so grotesk und unappetitlich hätte ausfallen können, sein Publikum ein für allemal gefangenzunehmen, indem er den natürlichen Charme der Geschichte mit der glänzenden Choreographie von MGM verbindet (großräumig angelegte Tanznummern und abgezirkelte Kabinettstückchen wie der Tanz des Wiegenlied-Bundes oder das Erwachen der Schlafmützen, die sich in Nachthemd und Morgenhaube aus den gesprungenen blauen Eierschalen ihrer riesigen Nester erheben, wechseln sich hier ab), allem voran aber durch Harold Arlens und Yip Harburgs außergewöhnlich witzigem „Ding Dong! The Witch Is Dead“ („Ding Dong! Die Hexe ist tot“). Arien äußerte sich etwas geringschätzig über diesen Song und das gleichermaßen unvergeßliche „We’re Off to See the Wizard“ („Wir sind unterwegs zum Zauberer“) und nannte sie seine „Zitronenbonbon-Songs“, wahrscheinlich weil die wahre Genialität beider Lieder in Harburgs Texten liegt. In Dorothys Einleitung zu „Ding Dong!“ hat sich Harburg darauf eingelassen, ein Feuerwerk aus lauter a-a-a-Reimen zu entfachen („The wind began to switch/the house to pitch“; bis wir schließlich auf „witch [...] thumbin’ for a hitch“ und „what happened then was rieh“ stoßen) - eine Serie, bei der wir, genau wie bei den Alliterationen eines Vaudeville-Conférenciers, jeden neuen Reim als eine Art von gymnastischem Triumph bejubeln. Diese Form der Wortspielerei zeichnet beide Lieder aus. In „Ding Dong“ bedient sich Harburg der Ziehharmonikatechnik, indem er Wörter meinanderschiebt:
Ding, dong, the witch ist dead!
Whicholwitch ?
The wicked witch !
(Ding, dong, die Hexe ist tot!
Welche alte Hexe ?
Die böse Hexe!)
Diese Technik kam in „We’re Off to See the Wizard“ noch sehr viel mehr zum Tragen und wurde zu seinem eigentlichen Dreh- und Angelpunkt:
We’re off to see the Wizard,
The wonderful Wizzerdovoz.
We hear he is
A Wizzovawizz,
If ever a Wizztberwozz.
If everoever a Wizztberwozz The Wizzerdovoz is one because ...
(Wir sind unterwegs zum Zauberer, dem wunderbaren Zauberer von Oz.
Wie wir hören, ist er
ein Zauberer von einem Zauberer,
wenn’s je einen Zauberer gab.
Wenns je, ja je einen Zauberer gab, dann den Zauberer von Oz, weil...)
Und so weiter.
Mitten in dieser Mümmlerei stoßen wir auf zwei sehr verschiedenartige Porträts von Erwachsenen. Die gute Hexe Glinda ist hübsch in Rosa (nun ja, ganz niedlich, selbst wenn Dorothy so bewegt ist, daß sie Glinda „schön“ nennt). Sie hat eine hohe, gurrende Stimme und ein Lachen, das aussieht, als hätte es sich verklemmt. Ihr Dialog enthält einen ausgezeichneten Gag; als Dorothy bestreitet, eine Hexe zu sein, zeigt Glinda auf Toto und fragt: „Nun, ist das die Hexe?“ Von diesem Witz abgesehen, vertut sie ihre Auftritte, indem sie grundsätzlich gütig und lieb und ziemlich überpudert aussieht. Interessanterweise birgt sie nicht die Rechtschaffenheit und Anständigkeit von Oz in sich, obwohl sie die gute Hexe ist. Die Einwohner von Oz sind von Natur aus gut, es sei denn, sie werden von der bösen Hexe beherrscht (was dadurch augenfällig gemacht wird, daß im Verhalten ihrer Soldaten eine Wendung zum Bessern eintritt, als sie schmilzt). Das Böse kommt im moralischen Universum des Films also von außen, es haust allein in der teuflischen Doppelgestalt von Jungfer Schlund/der bösen Hexe.
(Man gestatte mir in Klammern eine Sorge über die Darstellung des Mümmlerlandes: Ist es nicht ein klein wenig zu hübsch, zu gepflegt, zu süßlich süß für einen Ort, der bis unmittelbar vor Dorothys Ankunft unter der absoluten Macht der bösen und diktatorischen Ost-Hexe steht? Wie kommt es, daß diese zerquetschte Hexe kein Schloß hatte? Wie konnte ihr Despotismus das Land so wenig prägen? Warum sind die Mümmler, die schon nach kurzer Zeit aus ihren Verstecken kriechen, so vergleichsweise furchtlos und kichern, während sie sich verstecken? Ein ketzerischer Gedanke drängt sich auf: Vielleicht war die Ost-Hexe gar nicht so schlecht - in jedem Fall hielt sie die Straßen sauber, die Häuser auf Vordermann und frisch gestrichen, und zweifellos hielten auch allfällige Züge den Fahrplan ein. Ja sie scheint - auch hier ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester - ohne Hilfe von Soldaten, Polizisten oder anderen Repressionstruppen regiert zu haben. Warum also war sie so verhaßt? Ich frage ja nur.)
Glinda und die West-Hexe sind die beiden einzigen Machtsymbole in einem Film, der weitgehend von den Machtlosen handelt, und es lohnt sich, sie „auseinanderzunehmen“. Beides sind Frauen, und einer der verblüffenden Aspekte von The Wizard of Oz ist der Mangel eines männlichen Helden - denn wegen der ganzen Sache mit ihrem Grips, Herz und Mut ist es unmöglich, in der Vogelscheuche, dem Blechmann oder dem Feigen Löwen klassische Hollywood-Hauptdarsteller zu sehen. Das Kraftzentrum des Films ist ein Dreieck, das aus Glinda, Dorothy und der Hexe gebildet wird; die vierte Ecke, an der man die längste Zeit des Films über den Zauberer vermutet, erweist sich als Illusion. Die Macht der Männer, so wird suggeriert, ist illusorisch; die Macht der Frauen ist wirklich.
Aber gibt es tatsächlich irgend jemanden, der sich bei der Wahl zwischen der guten und der bösen Hexe dafür entscheiden würde, auch nur fünf Minuten mit Glinda zu verbringen? Sicher, Glinda ist „gut“, und die böse Hexe ist „böse“; aber Glinda ist eine törichte Nervensäge, und die böse Hexe ist fein und gemein. Vergleichen Sie ihre Kleidung: krausenbesetztes Rosa versus schlankes Schwarz. Ein ungleicher Wettkampf. Wägen Sie ihr Verhalten zu den jeweiligen Gefährtinnen gegeneinander ab: Glinda lächelt affektiert, wenn sie schön genannt wird, und verunglimpft ihre häßliche Schwester, während die böse Hexe durch den Tod ihrer Schwester in Rage versetzt wird und einen löblichen Sinn für Solidarität an den Tag legt, wie man sagen könnte. Wir mögen sie anzischen, und als Kinder mag sie uns in Angst und Schrecken versetzen, aber wenigstens berührt sie uns nicht so peinlich wie Glinda. Es stimmt, daß Glinda eine Art von aufgeschminkter mütterlicher Geborgenheit verströmt, während die West-Hexe - in dieser Szene jedenfalls - einen merkwürdig zerbrechlichen und hilflosen Anschein macht, der sie zwingt, den Mund mit leeren Drohungen vollzunehmen („Ich werde den richtigen Augenblick abpassen. [...] Kreuze nur nie meinen Weg“). Doch so wie der Feminismus bestrebt war, althergebrachte pejorative Wörter wie „Hexe“ oder „Weib“ zu rehabilitieren, kann man von der bösen West-Hexe sagen, sie repräsentiere das positivere der beiden Bilder, die hier von der Stellung mächtiger Frauen angeboten werden. Der erbitterte Streit zwischen Glinda und der bösen Hexe entzündet sich an den Rubin-Slippern, die Glinda von den Füßen der toten Ost-Hexe weg- und an die Füße von Dorothy zaubert, von wo sie die böse Hexe offenbar nicht mehr wegbewegen kann. Aber Glinda unterweist Dorothy in einer merkwürdig rätselhaften, ja widersprüchlichen Weise. Erst unterrichtet sie Dorothy darüber: „Ihre Zauberkraft muß sehr mächtig sein, sonst würde sie die Rubin-Slipper nicht um jeden Preis haben wollen“; und später warnt sie Dorothy: „Ziehst du sie auch nur einen Augenblick lang aus, wirst du der bösen West-Hexe ausgeliefert sein.“ Nun, Äußerung Nummer 1 legt nahe, daß Glinda sich über die Natur der Rubin-Slipper nicht im klaren ist, während Äußerung Nummer 2 suggeriert, daß sie ihre Schutzkraft genau kennt. Keine der beiden Äußerungen enthält einen Wink auf die Rolle, welche die RubinSlipper später dabei spielen werden, Dorothy zurück nach Kansas zu bringen. Wahrscheinlich ist diese Konfusion eine Altlast des langen Drehbuch-Schreibprozesses, der immer wieder durch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten über die Funktion der Slipper unterbrochen worden ist. Man kann Glindas Widersprüchlichkeit aber auch als Beleg dafür betrachten, daß gute Feen oder gute Hexen keine große Hilfe sind, sobald sie dazu ansetzen. Im Grunde ist Glinda ihrer Beschreibung des Zauberers von Oz nicht unähnlich: „Oh, er ist sehr gut, aber sehr mysteriös.“
„Folgt einfach der gelben Ziegelsteinstraße“, sagt Glinda und entschwindet mit ihrer Kugel in den blauen Hügeln am Horizont; und Dorothy - die ganz unter dem Einfluß der Geometrie steht, wie es jedes Kind wäre, das zwischen Dreiecken, Kreisen und Quadraten aufgewachsen ist - nimmt ihre Reise genau an jenem Punkt in Angriff, dem die Straße spiralförmig entspringt. Dabei geschieht nun, während sie und die Mümmler Glindas Unterweisungen wie ein gleichzeitig heiseres und kehliges Echo wiedergeben, etwas mit ihren Füßen: Sie beginnen, sich synkopisch zu bewegen, was durch wunderbar langsame Einstellungen zusehends augenfälliger gemacht wird, bis wir schließlich, als das Ensemble zum erstenmal in das Titellied des Films einstimmt, den vollentwickelten, raffinierten, schlurfenden kleinen Hopser erkennen, der das Leitmotiv der ganzen Reise sein wird:
You’re off to see the Wizard,
(s-skip)
The wonderful Wizzerdovoz.
(s-skip)
You’ll find he is a Wizzovawizz If ever a Wizztherwozz ...
(Ihr seid unterwegs zum Zauberer,
[h-hops]
Dem wunderbaren Zauberer von Oz.
[b-hops]
Ihr werdet sehen, er ist ein Zauberer von einem Zauberer,
Wenn’s je einen Zauberer gab ...)
Hüpfend nimmt Dorothy - die bereits (wie die Mümmler ihr versichert haben) Geschichte ist, die Nationalheldin von Mümmlerland, die „als Büste in der Ruhmeshalle prangen wird“ - die Straße des Schicksals in Angriff und zieht, wozu Amerikaner berufen sind, nach Westen: Richtung Sonnenuntergang, Smaragdstadt und Hexe.
Immer schon sind mir Hintergrund-Anekdoten über die Entstehung eines Films köstlich und enttäuschend zugleich erschienen, vor allem wenn sich der betreffende Film so tief in mich eingegraben hat wie The Wizard of Oz. Es hat mich etwas betrübt zu erfahren, daß der Zauberer Alkoholiker und Frank Morgan für diese Rolle nur dritte Wahl hinter W.C. Fields und Ed Wynn war. (Welche verächtliche Wildheit hätte Fields dieser Rolle verliehen!) Erste Wahl für seine weibliche Mehr-als-nur-Gegenspielerin, die Hexe, war Gale Sondergaard, nicht nur eine wahre Schönheit, sondern wahrscheinlich ein weiterer Sturm an der Seite von Dorothy und des Tornados. Dann fand ich mich plötzlich in die Betrachtung einer alten Farbphotographie vertieft, die den Strohmann, den Blechmann und Dorothy in einer Waldszenerie zeigt, umgeben von Herbstblättern, und mußte erkennen, daß es sich gar nicht um die Hauptdarsteller, sondern um ihre Stunt-Doubles, ihre Stellvertreter handelte. Obwohl es sich nicht um eine außergewöhnliche Standphotographie handelte, verschlug sie mir doch den Atem; denn auch sie war sowohl melancholisch wie magnetisierend. In meiner Vorstellung wurde sie zum Inbegriff all meiner zwiespältigen Reaktionen.
Da stehen sie also, Nathanael Wests Heuschrecken, die endgültigen Möchtegerne. Der Schatten von Judy Garland, Bobbie Koshay, die Hände auf dem Rücken verschränkt und mit einer weißen Schleife im Haar, bemüht sich tapfer und wacker um ein Lächeln, aber sie weiß, daß sie nur eine Nachbildung ist, was soll’s: sie trägt keine Rubin-Slipper. Auch die Pseudo-Vogelscheuche, der Strohmann, macht einen niedergeschlagenen Eindruck, obwohl er dem Schicksal von Ray Böiger, sich jeden Tag ganz in Sackleinwand hüllen lassen zu müssen, entgangen ist. Würde nicht ein Büschel Stroh aus seinem rechten Ärmel hervorragen, hielte man ihn für eine Art Landstreicher. Zwischen ihnen steht in voller Metall-Montur das noch blechernere Echo des Blechmanns und sieht zum Gotterbarmen aus. Doubles kennen ihr Schicksal: Sie wissen, daß wir ihre Existenz nicht anerkennen wollen, obwohl doch der Verstand uns sagt, daß die Figuren in dieser oder jener gefährlichen Szene - die fliegende böse Hexe oder der Feige Löwe, der kopfüber durch ein Glasfenster hechtet - nicht von den Stars selbst verkörpert werden. Jener Teil von uns, der den Zweifel ausgeräumt hat, besteht darauf, die Stars und nicht ihre Doubles zu sehen. So bleiben diese selbst dann unsichtbar, wenn sie das ganze Bild ausfüllen. Sie bleiben hinter der Kamera, sogar wenn sie auf der Leinwand zu sehen sind.
Darin liegt allerdings nicht der Grund für die merkwürdige Faszination der Photographie; sie verdankt sich dem Umstand, daß wir im Fall eines geliebten Filmes alle die Doubles der Stars sind. Unsere Vorstellungskraft versetzt uns in das Fell des Löwen, rüstet uns mit den funkelnden Slippern aus und schickt uns gackernd auf einem Besenstiel durch die Luft. Diese Photographie zu betrachten, ist wie ein Blick in den Spiegel; wir erkennen uns selbst darin. Die Welt von The Wizard of Oz hat von uns Besitz ergriffen. Wir sind die Doubles geworden. Ein Paar Rubin-Slipper, die bei MGM im Keller gefunden worden sind, erzielten bei einer Auktion 1970 die erstaunliche Summe von fünfzehntausend Dollar. Der Käufer war anonym und ist es geblieben. Wer war so sehr vom Wunsch erfüllt, die magischen Schuhe zu besitzen - oder sogar zu tragen?
Gebeten, ein einzelnes Bild aus The Wizard of Oz auszuwählen, würden die meisten von uns, wie ich vermute, wohl auf die Vogelscheuche, den Blechmann, den Feigen Löwen und Dorothy verfallen, wie sie gemeinsam die gelbe Ziegelsteinstraße entlang-h-hüpfen. (Tatsächlich entwickelt sich der Hopser die ganze Reise über immer weiter, bis er zu einem ausgewachsenen Sp-prung wird.) Wie seltsam, daß die berühmteste Passage dieses sehr filmischen Films - ein Film, der strotzt vor technischer Findigkeit und Spezialeffekten - ausgerechnet der am wenigsten kinematographische, der „theatralischste“ Teil des Ganzen sein soll! Oder vielleicht doch nicht so seltsam, denn es handelt sich um eine Passage, die sich in erster Linie durch ihre surreale Komik auszeichnet, und wir erinnern uns, daß auch das ebenso tolle Treiben der Marx Brothers nicht weniger bühnenmäßig gefilmt worden ist; das clowneske Chaos ihres Unsinns ließ nur die allersimpelste Kameratechnik zu.
Die Vogelscheuche und der Blechmann sind reine Produkte des burlesken Theaters, spezialisiert auf die pantomimische Überhöhung der Stimme und der Körperbewegungen, Stürze (die Vogelscheuche, wie sie von ihrer Stange kippt), unwahrscheinliche Neigungen über das Gravitationszentrum hinaus (der Blechmann während seines kleinen Tanzes) und natürlich auf ihre klugscheißerische Schlagfertigkeit beim Wortgefecht:
Blechmann (festgerostet): (kreischt)
Dorothy: Er sagte „Öl-Kann’“!
Vogelscheuche: Öl kann was?
Den Gipfel all dieser Clownerie bildet jenes ausgewachsene Meisterstück der Komik, Bert Lahrs Verkörperung des Feigen Löwen, der ganz aus gedehnten Vokallauten („Stellt sie hinauuuuuuuuf“), lächerlichen Reimen („Nashorn“ und „Washorn“), gespielter Tapferkeit und gewaltigem, opernhaftem, bedrohlichem, schluchzendem Schrecken besteht. Alle drei - die Vogelscheuche, der Blechmann und der Löwe - sind, nach einer Wendung von T. S. Eliot, „hollow men“ („leere Menschen“). Natürlich hat die Vogelscheuche in Wirklichkeit „ach! einen Kopf voller Stroh“, aber der Blechmann, der Vorgänger von C-3PO in Star Wars („Krieg der Sterne“), ist vollkommen leer - er schlägt sich gegen die Brust, um zu beweisen, daß seine Innereien fehlen, weil der Blechschmied, sein schattenhafter Schöpfer, vergessen hat, ihn mit einem Herz auszustatten -, und dem Löwen fehlt die löwenhafteste aller Tugenden, wie er klagt:
What makes the Hottentot so hot?
What puts the ape in apricot?
What have they got that I ain’t got?
Courage!
(Was macht den Hottentotten so heiß?
Wie kommt der Affe in die Aprikose?
Was haben sie, das mir fehlt?
Mut!)
Vielleicht ist es gerade diese Leere, die unserer Einbildungskraft erlaubt, sich so umstandslos in sie hineinzuversetzen und sie auszufüllen. Das heißt, gerade ihr Anti-Heldentum, ihr offensichtlicher Mangel an Großen Tugenden gleicht sie unserer eigenen Größe an, ja macht sie vielleicht sogar noch kleiner, so daß wir uns, wie Dorothy unter den Mümmlern, als ihresgleichen fühlen können. Schritt für Schritt allerdings entdecken wir, daß sie zusammen mit ihrer „Stichwortlieferantin“ Dorothy (sie spielt in dieser Szenenfolge die Rolle des nicht lustigen Marx Brother, der singen kann und wenig mehr tut, als verdammt gut auszusehen) eine der „Botschaften“ des Films verkörpern - wir besitzen bereits, wonach es uns am sehnsüchtigsten verlangt. Regelmäßig hat die Vogelscheuche blitzgescheite Einfälle, die sie jeweils durch Selbsttadel gleich widerruft, wenn sie diese vorbringt. Der Blechmann kann kummervolle Tränen vergießen, lange bevor der Zauberer ihm ein Herz verleiht. Und als Dorothy durch die Hexe gefangengenommen wird, tritt der Mut des Löwen zutage, selbst wenn er seine Freunde inständig bittet, „mir mein Vorhaben auszureden“. Damit diese Botschaft ihr ganzes Gewicht bekommt, müssen wir allerdings einsehen, wie vergeblich die Suche nach äußeren Lösungen ist. Wir müssen noch einen weiteren „hollow man“ genauer kennenlernen: den Zauberer von Oz selbst. So wie sich der Blechschmied nur als fehlerhafter Schöpfer von Blechmännern erweist - so wie in diesem säkularen Film der Gott des Blechmannes tot ist -, so muß auch unser Glaube an Zauberer zugrunde gehen, damit wir an uns selbst glauben können. Wir müssen das tödliche Mohnfeld überleben - mit Unterstützung eines mysteriösen Schneefalls (warum besiegt Schnee das Gift der Mohnblumen tatsächlich?) und so, begleitet von himmlischen Chören, vor den Stadttoren ankommen.
Hier wechselt der Film noch einmal das Muster und wird ein Porträt des Provinzlers in der Großstadt - eines der klassischen Themen des amerikanischen Films, dessen Echo etwa in Mr. Deeds Goes to Town („Mr. Deeds geht in die Stadt“), ja sogar in Clark Kents Ankunft beim Daily Planet in Superman nachhallt. Dorothy ist ein Bauernmädchen vom Lande, „Dorothy, die kleine und bescheidene“; ihre Gefährten sind hinterwäldlerische Hanswürste. Und doch - auch dies ist eine vertraute Hollywood-Wendung - ist es die Landpomeranze, welche die Rettung bringt.
Allerdings gab es nie eine Metropole wie die Smaragdstadt. Von außen betrachtet sieht sie aus wie eine Märchenversion von New York, ein Dickicht von grünen Wolkenkratzern. Das Stadtinnere jedoch ist malerischer als malerisch. Noch verblüffender ist die Entdeckung, daß die Einwohner - viele werden von Frank Morgan gespielt, der zu den Rollen von Professor Marvel und des Zauberers noch diejenigen des Torwächters, des Kutschers und der Palastwache hinzufügt - mit einem Akzent sprechen, den Hollywood-Schauspieler gerne einen „englischen Akzent“ nennen. „Tyke yer anyplace in the city, we does“, sagt der Fahrer und fügt hinzu: „I’ll tyke yer to a little place where you can tidy up a bit, what?“ („Ich bringe euch in dieser Stadt wohin ihr wollt, bringen wir euch. Ich werde euch an einen kleinen Ort bringen, wo ihr euch etwas frischmachen könnt, nicht?“) Andere Mitglieder der Bürgerschaft sind gekleidet wie Pagen eines Grand Hotels und schicke Nonnen und sagen - oder, besser, singen - Dinge wie: „Jolly good fun!“ („Ein herrlicher Spaß!“) Dorothy lernt schnell. In der „Abwaschen & Aufpolieren“-Fabrik - ein Tribut an den Geist urbaner Technologie, der frei ist von den dunklen Zweifeln, die Modern Times („Moderne Zeiten“) oder City Lights („Lichter der Großstadt“) hegen - zeigt sich unsere Heldin selbst ein bißchen englisiert:
Dorothy (sings): Can you even dye my eyes to match my gown?
Attendant: Uh-huh!
Dorothy: Jolly old town!
(Dorothy [singt]: Können Sie sogar meine Augen färben, so daß sie zu meinem Kleid passen?
Diener [zustimmend]: Mh-hm!
Dorothy: Herrliche Stadt!)
Die meisten Bürger sind von einer fröhlichen Hilfsbereitschaft, und diejenigen, die es nicht zu sein scheinen - wie der Torwächter, die Palastwache -, sind schnell gewonnen. (Auch in dieser Hinsicht, noch einmal, sind sie untypische Städter.) Unsere vier Freunde erlangen endlich Zutritt zum Palast des Zauberers, weil aus dem Wächter ein alarmierend großer Strom von Tränen losbricht, als er Dorothy vor Enttäuschung weinen sieht. Schnell ist sein Gesicht überschwemmt von Tränen, und angesichts dieser extremen Gefühlsäußerung ist man schon durch die nackte Zahl der Anlässe beeindruckt, bei denen in diesem Film geweint wird. Außer Dorothy und der Wache weinen der Feige Löwe, als Dorothy ihm eins auf die Nase gibt; der Blechmann, den die Tränen beinahe wieder einrosten lassen; und schließlich wieder Dorothy, als sie sich in den Klauen der Hexe befindet. Der Gedanke schießt einem durch den Kopf, daß der Film sehr viel kürzer hätte ausfallen können, wäre die wasserscheue Hexe nur bei einem dieser Anläße näher in Reichweite gewesen.
Durch ein Korridor-Gewölbe, das aussieht wie eine in die Länge gezogene Version des Looney Tunes-Emblems, betreten wir den Palast und stehen schließlich vor einem Zauberer, dessen Tricks - riesige Köpfe und Feuerblitze - verbergen, daß er im Grunde genommen mit Dorothy verwandt ist. Auch er ist ein Immigrant; tatsächlich stammt er, wie er später preisgibt, selbst aus Kansas. (Im Buch kam er aus Omaha.) Diese beiden Immigranten haben gegensätzliche Strategien angenommen, um in einem neuen und fremden Land überleben zu können. Dorothy hat sich unerschöpflicher Höflichkeit, Zuvorkommenheit und ausgesuchter Bescheidenheit bedient, während der Zauberer in Rauch und Feuer, in Prahlerei und Bombast aufgegangen ist und sich sozusagen unter Hochdruck seinen Weg zur Spitze gebahnt hat, getrieben von einer Wolke seiner eigenen heißen Luft sozusagen. Aber Dorothy lernt, daß Bescheidenheit allem nicht genügt, und der Zauberer merkt (als der Fesselballon zum zweitenmal die Oberhand über ihn gewinnt), daß er mit heißer Luft nicht so gut umgehen kann, wie er sollte. (Einem Migranten wie mir fällt es schwer, in diesen wechselhaften Schicksalen keine Parabel auf den Zustand der Migration zu sehen.)
Die Bedingung des Zauberers, daß er keinen Wunsch erfüllen wird, ehe die vier Freunde ihm nicht den Besenstiel der Hexe gebracht haben, leitet den vorletzten Handlungsabschnitt des Films ein, der in dieser Phase am wenigsten herausfordernd ist, obwohl sie die action-reichste und „aufregendste“ des Films bildet; er ist hier gleichzeitig ein Kumpel-Film, handfestes AbenteuerGarn und, nach Dorothys Gefangennahme, eine mehr oder weniger konventionelle Prinzessinnen-Befreiungsgeschichte. Nachdem der Film seinen großen dramatischen Höhepunkt, die Konfrontation mit dem Zauberer, erreicht hat, hängt er eine Weile lang durch und gewinnt im Grunde seine Spannung bis zum ebenso dramatischen Höhepunkt des Endkampfes mit der bösen Hexe nicht zurück, der damit endet, daß sie schmilzt und zu nichts „verkümmert“.
Im Schnellvorlauf. Die Hexe ist von uns gegangen. Der Zauberer ist entlarvt worden, aber gerade im Moment seiner Demaskierung gelang ihm ein wahres Zauberkunststückchen, indem er Dorothys Gefährten jene Gaben verlieh, die sie doch im Grunde immer schon hatten, ohne daran zu glauben. Auch der Zauberer ist fort, und zwar ohne Dorothy, da ihre Pläne durch Toto (durch wen auch sonst) durchkreuzt worden sind. Und da ist Glinda, die Dorothy darüber aufklärt, daß sie die Bedeutung der Rubin-Slipper selbst herausfinden muß.
Blechmann: Was hast Du bis jetzt herausgefunden, Dorothy?
Dorothy: [...] Sollte ich mich je wieder auf die Suche nach meinem Herzenswunsch begeben, werde ich nicht weit von unserem Wurf suchen; denn ist er dort nicht zu finden, habe ich ihn nie wirklich verloren. Soviel zum Anfang. Ist das richtig?
Glinda: Das ist sogar alles. [...] Jetzt werden diese magischen Slipper dich in zwei Sekunden nach Hause bringen. [...] Schließe deine Augen und schlage deine Absätze dreimal zusammen [...] und denke bei dir [...] Es ist nirgends besser als ...
Halt!
Wie kommt es, daß man uns am Ende dieses radikalen und unsere Möglichkeiten erweiternden Films - der uns in der denkbar undidaktischsten Weise beibringt, auf uns selbst zu bauen und das Beste aus uns zu machen - diese konservative kleine Moralpredigt erteilt? Sollen wir tatsächlich denken, Dorothy hätte auf ihrer Reise nicht mehr gelernt, als daß sie sie erst gar nicht hätte zu unternehmen brauchen? Sind wir wirklich gehalten zu glauben, daß sie jetzt die Beschränkungen ihres Lebens daheim akzeptiert und dasjenige, was ihr dort fehlt, nicht als Verlust empfindet? „Ist das richtig?“ Nun, verzeih mir,