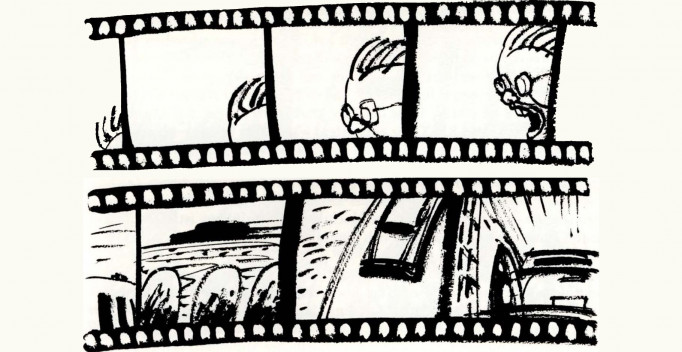Die Filmwerbung verspricht knisternde Erotik, aber vorerst ist das Kameraauge auf eine flockig weisse, lichthaltige Fläche gerichtet. Nichts - nichts Gegenständliches zumindest - zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Die Blicke schwimmen auf dem unbegrenzt scheinenden Milchsee haltlos umher. Trompetenklänge - kalt und klar, zugleich zart und leidensselig - untermalen das Bild, geben Struktur. Miles Davis spielt. Schon wollen wir uns im Kinosessel zurücklehnen und mit offenen Augen träumen, da dringt von unten her ein dunkler Gegenstand in die makellose Leinwandfläche. Es wäre denkbar, das Auftauchen des scharf konturierten Objekts als Verunreinigung, als Verletzung wahrzunehmen, schliesslich wird der intakte, der reine Leinwandkörper durch das Ding aufgerissen - doch die Erleichterung überwiegt. Wir kamen mit der Absicht ins Kino, etwas Bestimmtes, einzelne bestimmbare Elemente mit den Augen zu verfolgen. Wir sind bereit, jeden Gegenstand, jeden denkbaren Handlungsträger im Augenblick zu erfassen und ihm — seinen Linien und Farbflächen - Plastizität zu verleihen. Und so erkennen wir in dem Eindringling, der sich langsam in seiner vollen Grösse aufrichtet - mit dem breiten Kopf und dem geraden Schaft wirkt er recht kriegerisch und potent — einen Turm; davor - endlich hat die Kamera den Blick gesenkt — erstreckt sich ein weites Feld verbrannten Grases, widersteht da und dort Ginster der Hitze. Obgleich sich nichts bewegt, wird die Färb- und Formkonstellation auf dem Filmbild immer komplexer. Der Beschreibende, auf Vollständigkeit bedacht, gerät in Not. Im Vordergrund scheinen ihm ein dunkler Steinblock und ein grosser karminroter Fleck von Bedeutung. Dann endlich der erste Schnitt - ein schöngeformter Fuss in Grossaufnahme. Die Kamera streicht dem dazugehörenden Körper entlang. Einem unbehaarten schlanken Bein ... - doch dort, wo der Oberschenkel in den Beckenbereich einmündet, wird der Blick auf den nackten Körper durch einen Rock - der rote Fleck von vorhin - gestört. Zum Glück ist er dünn und schmiegt sich den breiten Hüften, der schlanken Taille und den straffen Brüsten des seitlich daliegenden Frauenkörpers an. An den Stellen, an denen die blonden Locken nicht über sie hinabgleiten, sind die Schultern entblösst. Auch das rosafarbene Gesicht, die üppigen Lippen, auf denen ein Lächeln schwebt, und die gerade Nase präsentieren sich den Blicken. Die Augen sind geschlossen. Die Schauspielerin stellt offensichtlich eine schlafende Frau dar, die Gesichtsmuskulatur jedoch ist gespannt, das gibt der Haut Glanz, macht sie glatt. Wie gerne würden wir - die männlichen Zuschauer zumal - bei diesem Anblick verweilen, dem Körper entlang nochmals hinab und herauf fahren, ihn mit unseren Augen streicheln, denn diese Frau fühlt sich unbeobachtet, und wir sind ihr nahe, könnten uns sattsehen. Die Filmerin aber - wir befinden uns im Film Siesta von Mary Lambert - will dem Voyeurismus keinen weiteren Vorschub leisten, jedenfalls im Moment nicht. Sie montiert Bilder von Raubvögeln, die langsam ihre breiten Schwingen schlagen, und Flugzeugen, die unmittelbar hinter dem Frauenkörper unter Getöse zur Landung ansetzen, dazwischen. Als sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Frau konzentriert, befindet sich die Kamera in der Luft. Aus der Vogelperspektive sieht man den ausgestreckten Körper. Während ein heftiger Windstoss das Gras zu Boden drückt, sehen wir, wie die blonde Schönheit aufwacht, plötzlich heftig atmet, sich schnell auf den Rücken kehrt und die Arme kreuzförmig ausstreckt. Ein Datum wird eingeblendet („The 4th of July“). Nun sind wir wieder nahe bei ihr, wollen sie, die den Kopf wild hin- und herwirft, beruhigend in unsere Arme schliessen. Schmerz und Ekel zeichnen sich auf ihrem Gesicht ab. Weshalb die unberührte Schönheit durch diesen überspannten Ausdruck, durch dies eindeutige Zeichen zerstören? Hastig streift sie den Rock, unter dem sie nackt ist, hoch. Prüft ihren Körper, findet Blutspuren, aber keine Verletzung. Trotzdem beruhigt sie sich nicht. Sie hat sich mittlerweile aufgerichtet und öffnet den Mund, der die Leinwandmitte ausfüllt, zu einem schaudervollen Schrei. So schreien die Menschen auf Edvard Munchs Bildern, vom Tod gezeichnet. Nun gibt es kein Halten mehr; in der nächsten Kameraeinstellung rennt die Aufgeregte einer baumbestandenen Strasse entlang, stürzt sich eine Böschung hinab, hastet weiter, hält an einem Gewässer, einem kleinen Bach. Sichtlich atmet sie auf. Sie blickt um sich, prüft, ob sie beobachtet wird, und streift den Rock über den Kopf. In der Totalen steht sie nackt, wenn auch in Distanz, unter dem Betrachter, der sie von schräg oben - gleichsam aus einer Baumperspektive - sieht. Nun konzentrieren wir uns auf den weiblichen Unterleib, sehen wie aus dem Rock, den die Frau zu waschen beginnt, Blut fliesst und das trübe Wasser rosig färbt. Anschliessend benetzt die Frau ihre Brust, als gelte es, etwas zu säubern. Auch blicken wir der Nackten von hinten über die Schultern und verfolgen, wie sie den Rock auswringt. Dann sind wir wieder auf dem Baum und sehen, wie sich die Frau auf dem Rock, ihrem weissen Körper Folie und Badetuch zugleich, ausstreckt. Sie öffnet sich und ihren Körper dem Späher, ein Bild der Ruhe und Entspanntheit. Es folgt eine weitere Grossaufnahme des Körpers (der Kameramann hat sich unmittelbar zu seinen Füssen postiert). Alles am Frauenleib ist lustvoll ausgebreitet, der Mund leicht geöffnet. Noch spielt die Frau mit der einen Hand im Wasser, dann schöpft sie etwas von der kühlen Frische, benetzt sich Brüste und Bauch. Und wieder wird eine friedliche Episode mit dem nächsten Schnitt abrupt beendet, und wieder rennt die Frau um ihr Leben.
Dies Wechselbad von Ruhe und Erregtheit, das die ersten drei Minuten von Siesta kennzeichnet, wird erst mit dem Ende des Films aufhören. Die Veränderung der Stimmung wird, dies war in der längeren Beschreibung des Anfangs zu sehen, durch Körperhaltung und Körperausdruck der Hauptdarstellerin gestützt; äusserlich aufgesetzte Signale. Der Körper der Ellen Barkin, des neuen Sex-Idols, als Claire wirkt mitten im sonnenverbrannten spanischen Steppengras, das von Kerosinspuren schmierig und verfleckt ist, wie frisch gewaschen und balsamiert. Damit setzt er eine lange Reihe von Filmfrauenkörpern fort; Körper, die Häute über der Haut besitzen. Aus ihrem Innern steigt kein Ton auf. Diese Körper reden nicht, sie zeigen uns bestenfalls auf, dass sie willig gewissen Regieanweisungen folgen. Diese Körper lügen kaum, sie tragen offen ihre Scheinhaftigkeit zur Schau, dennoch lassen wir uns meist an der Nase führen. Der Zuschauer liest das heftige Hin- und Herwerfen des Kopfes als Zeichen für einen inneren Erregungszustand, auch wenn er spürt, dass der Impuls zu dieser Bewegung nicht aus den Eingeweiden, sondern aus den Hirnwindungen kommt. Wir sind oft froh, dass die Filmkörper nur das zeigen, was sie zeigen wollen, und nicht das Dahinterliegende, Beunruhigende, das ganz Andere. Solche Körperlandschaften sind mit scharfen Konturen ohne Modellierung oder grellem Licht ohne Schatten vergleichbar. Sie plappern die Schlachtrufe der Moderne selbstzufrieden weiter: „A rose is a rose is ..." oder „A beautiful body is just a beautiful body“ oder „You see, what you see“. Die metaphysische Wurzel menschlicher Gebärde ist gekappt, vor allem dann, wenn der Körper der Schauspielerin in Symbolhaftigkeit - der Kreuzform als Ausdruck für die märtyrerhafte Christusnachfolge - erstarrt.
Wie ganz anders drücken sich Gesicht und Leib von Isabella Rossellini als Nachtclubsängerin Dorothy Valent in David Lynchs Blue Velvet aus! Bei ihr wirken dicke Schichten von Schminke und Pomade wie ein loser Verband, der die blutige Wunde darunter nicht zu stillen vermag. Wenn sich diese junge Frau nach dem nächtlichen Auftritt in ihrer bescheidenen Wohnung, deren Böden und Wände in dem schummrigen Licht von einem braunen Pelz überzogen scheinen, auszieht, schält sich ein müder, geschundener Körper aus seinen Hüllen. Er ist schwer und schlaff, vor der Zeit gealtert. Wie selbstverständlich verliert er bei der kleinsten Erschütterung den Halt, windet sich verzweifelt auf dem Boden. Dem Voyeur im Schrank - sein Blick auf die Frau wird im Film immer wieder unterbrochen mit Blicken in den Schrank, auf sein gespanntes Gesicht — und dem Zuschauer im Kinosaal bietet sich kein appetitliches Schauspiel. Wider ihren Willen müssen sie mitansehen, wie hier ein Mensch sein elendes Inneres nach aussen stülpt, mit seinem Körper schreit. Aber halt - es ist der Körper eines Filmstars. Das Ganze nur Spiel. Die Falten und grauen Stellen der Haut womöglich das Werk des Maskenbildners. Wurden wir belogen? Ist Körpersprache im Spielfilm zwangsläufig scheinhaft? Dennoch wage ich einen weiteren Vergleich: die fahle, spröde Haut Dorothy Valents ist wie die Asche eines Feuers, das von innen her brennt. Ohne schon hinter das Geheimnis dieser Frau gekommen zu sein, glauben wir zu wissen, dass hier - wie so oft — eine Frauenseele, ein Frauenkörper gequält und misshandelt wurde, gegen offenen oder versteckten Widerstand benutzt. In Blue Velvet ist der nackte Frauenleib nicht Stimulus für ermüdete Männertriebe, sondern Geschichtenerzähler; so müssen wir Geschichten, die wir nicht hören wollen, sehen und verstehen; Falte für Falte, Flecken für Flecken nachlesen. Es ist eine Geschichte voll Gewalt und Perversität, die das Kleinstadtidyll von Lumberton zu zerreissen droht. Die Männerbrutalität, die wir später von Denis Hopper als Frank zur Genüge vorgespielt bekommen, ist bei der ersten Begegnung mit dem Körper Isabella Rossellinis noch nicht blosse Filmaktion, Spektakel - sie haust mitten in der Frauenfigur und schwärt und modert dort, bis ein Prinz sie aus dem Gehäuse vertreibt und das Haus wieder herausputzt.
Geschichten, Geschichte ganz allgemein, sind ohne die Körper nicht denkbar; sie hängen und kleben förmlich am Körper. Was geschieht - und damit dem narrativen Zugriff zugänglich wird -, hat sich bereits im Körper niedergeschlagen, in den Körper eingefressen, wird von ihm wieder ausgedünstet. Deshalb lässt sich Geschichte am besten am Körper, an der Geschichte der Körper ablesen und nachbuchstabieren. Da aber nicht jede Körperäusserung der Wahrheit entspricht, müssen wir auch in der von Körpern geschriebenen Geschichte mit der Lüge rechnen. Geschichtserzählung - körperhaft oder körperlos - ist so oder so fiktional. Auch Worte helfen dem verbissenen Wahrheitssucher nicht weiter. Die anschauliche Sprache der Körper verliert im diskursiv logischen Gatter der Wortstruktur bloss an Feuer. Eine Rettung aus den Fängen zweideutiger Ausdrucksformen versprechen die visuellen Medien. In ihnen liesse sich die durchschaute Körperlüge zurückbuchstabieren oder zumindest den erstaunten Betrachtern auf die Nase binden: entlarven als etwas, das von dem Eigentlichen meilenweit entfernt ist.
Meine Hypothese: Manche Comicszeichner der jüngsten Zeit haben eine solche entlarvende Körpersprache entwickelt. Sie kommen über die dickste Lüge zur dünnzarten Wahrheit. Von hier kann man leicht eine Linie zu einem Film wie Blue Velvet ziehen, der aus seiner Künstlichkeit nie ein Hehl macht; ein Abgesang auf eine Zeit, da die menschlichen Körper noch als Instrument der Verstellung dienten.
Nach Genuss und Strapaze eines solchen Films - und das mag das Paradoxe sein - will man Zehen, Becken, Brust und Schulter eines Menschen, natürlich auch seine Gesichtsmuskulatur in barocker Tradition erneut zum Prüfstein der „inneren Wahrheit“, zum Prüfstein der Seelenregungen erklären. Wer hat es nicht schon erfahren, dass er - ganz Körper und nur noch Körper - die Illusion hegte, die Täuschungen, der Irrtum, der Wahn des Bewusstseins seien abgeschüttelt. Bestätigt werden wir in diesem Glauben durch die Physiologen, die Neurologen und Psychologen, die schon längst die Bedeutung des kleinsten Muskelreflexes analysiert, den Körper als Erkenntnisquelle auf ihre Weise ausgeschöpft haben. Nun behaupten sie, über den nackten Körper auf die „nackte Wahrheit“ gestossen zu sein.
In der Antike war der Körper eher schönheitshaltig als wahrheitshaltig. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts - zu einer Zeit, als die Temperamentenlehre der Psychologie im modernen Sinn weichen musste - wurde der Körper endgültig zum Seismographen der Seele. Gestik und Mimik wurden in kleinste Bestandteile, heute würden wir sie als Seme oder Kineme bezeichnen, zerlegt: Zeichen eines Kommunikationssystems, das teils dem spontanen Verstehen der Empfänger zugänglich ist, teils erlernt werden muss. Ist man dieser Sprache kundig - so lautet die verbreitete Meinung ist das vocabulaire visuel sowohl in der Natur als auch in der Kunst eindeutig lesbar. Charles Le Brun, der Hofmaler Ludwigs XIV, stellte eine ausgefeilte Lehre auf, mit deren Hilfe man die Veränderungen der Gesichtszüge als bestimmte Gefühlsäusserungen erkennen konnte. Er wies nach, dass sich irdische Liebe (amoure simple) und himmlische Liebe (amoure de Dien.) nicht in gleicher Weise auf dem Gesicht widerspiegeln. Der Blick ins Gesicht und die Kenntnis seines Kodes genügen also, um den Heuchler, der simple Liebeslust als religiöse Inbrunst ausgeben will, des Verrats zu überführen. In der Art, wie sich die einzelnen Teile der Augenbrauen heben und senken, lässt sich nach dieser Lehre schon vieles ablesen. Der Wissende vermag durch die Veränderung dieser Gesichtspartie zu unterscheiden, ob sein Gegenüber Widerwillen, Angst oder Entsetzen empfindet.
Wer jedoch die unwillkürlichen Bewegungen der Gesichtsmuskulatur durchschaut hat, kann sie willkürlich für seine Zwecke einsetzen. Bücher zur Wiedergabe der Leidenschaften wurden geschrieben. Was zunächst als Regelwerk für Schauspieler gedacht war - das übertriebene Gehabe von Arlecchino und Hanswurst sollte der Darstellung wahrheitsgetreuer und nachvollziehbarer Emotionen Platz machen -, wurde im 17. und 18. Jahrhundert von der ganzen höfischen Gesellschaft gelesen und beherrscht. Die abgebrühte Mätresse, ihre Gesichtsmuskulatur vollständig unter Kontrolle, konnte das jungfräuliche, in erster Liebe erblühte Mädchen mimen und den Neuankömmling am Hof des Sonnenkönigs bezirzen. Trotzdem war noch Diderot davon überzeugt, dass Mimik, Gestik, die Gebärden im allgemeinen zu einer universelleren und natürlicheren Sprache gefügt werden können als Worte, denn in jeder noch so gekünstelten „Expression“ komme auch naiver und spontaner Ausdruck zur Geltung. Um das Interesse seiner Mitmenschen zu wecken, sei allerdings auch bei der Körpersprache eine gewisse obscuritas, die Verschleierung der einfachen, lauteren Gefühle ratsam. Im weiteren sei zu beachten, dass zusammengesetzte Emotionen — Liebe und Neugier, Melancholie und Abscheu - einem einfältigen Charakter Tiefe verleihen können. Wir sehen, sind einmal die leiblichen Zeichensysteme problematisiert, differenziert und festgeschrieben, kann der Körper seine Arbeit als Legendenbildner beginnen. Nicht mehr seine Wahrheitshaltigkeit, sondern seine Erzählkompetenz ist gefragt.
In bezug auf die verschiedensten künstlerischen Medien werden auch heute Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Gestik als jene Übermittlungsfelder bezeichnet, auf denen sich am meisten Informationen über das Innere dargestellter Menschen oder Lebewesen sammeln lassen (Vgl. Kai Riedemann, Comix, Kontext, Kommunikation, Frankfurt a.M., Bern, New York, Paris 1988, S. 98ff.). Nur eine geringfügige Veränderung der Stellung der Kopfachse zur Körperachse lockt bei einem gezeichneten Strichmännchen z.B. einen neuen Gefühlsausdruck hervor. Die mit dem Zeichenstift erfasste Mimik wirkt offenbar dann natürlich, wenn sich bei einem Gefühlswechsel eine Vielzahl von Gesichtselementen geringfügig verschiebt oder eine geringe Zahl von Gesichtsmerkmalen eine starke Veränderung durchmacht. Bei einer solchen Herstellung von Emotionen kann man sich im wesentlichen auf den Mund- und Augenbereich beschränken. Um den mimischen Zeichen eine gewisse Unschärfe zuzugestehen - auch dies steigert ihre Überzeugungskraft -, ist das gezielte Zusammenspiel von Mimik und Gestik wichtig. Da er sich nicht dem Vorwurf schierer Beliebigkeit aussetzen will, wird der Zeichner darauf achten, dass sich die Informationen, von Auge, Mund, Arm und Hand ausgehend, nicht gegenseitig widersprechen. Es ist für den Rezipienten meist beglückend, wenn er realisiert, dass Mimik und Gestik gemeinsam eine verständliche Botschaft übermitteln.
Niemand wird heute behaupten wollen, Körperzeichen irgendwelcher Art und die Körpersprache als syntaktische Einheit, Kinesik, seien Natur; sie sind - wie schon Umberto Eco es betont hat - das Gegenteil davon: Konvention und Kultur. „Auch da, wo wir vitale Spontaneität vermuten, existiert Kultur“ (Umberto Eco, „Der Film und das Problem der zeitgenössischen Malerei“, in: Texte zur Filmtheorie, hrsg. von Franz-Josef Albersmeier, Stuttgart 1979, S. 313). Nun wird die leidige Frage nach der Lügenhaftigkeit oder dem Wahrheitsgehalt dieses Kodes hinfällig. Sprachstruktur - dies hat unter anderem Dieter Kamper auf den Punkt gebracht - heisst wesentlich Lügenstruktur (Dieter Kamper, Hieroglyphen der Zeit, München 1988). Zuerst muss man lügen können, bevor da und dort im unscheinbaren Diskursfetzen auch die Wahrheit aufscheint. Oder sollten Wahrheit und Lüge noch enger verknüpft sein? Ist in jeder Lüge Wahrheit eingesponnen - wie in jeder zärtlichen Berührung von Körpern Schläge? Das Abenteuer Leben besteht wohl dann, den Zeitpunkt der Metamorphose und des Wandels von der Lüge zur Wahrheit, der Wahrheit zur Lüge zu antizipieren. Dann wird der Tag kommen, an dem uns die Verwandlung der Kröte zur Prinzessin und umgekehrt nicht mehr verstört.
Sobald wir akzeptieren, dass der Körper keine natürliche Sprache spricht, dürfen wir fordern, dass diese Sprache nicht im Regelwerk und der Normierung erstickt, zum Stereotyp verkommt. Damit die Kinesik nicht die Reihe der toten Sprachen vermehrt, ist eine ständige Neuprägung sozialer und kultureller Trends innerhalb der Körpermotorik notwendig, müssen sich in Körperhaltung und -ausdruck Veränderungen von Zeitgeist und Weltbild objektivieren.
Ein solcher Ort der Neuprägung von Körperzeichen - bei der Aussagestruktur des Zeichensystems und Erwartungshaltung des Zeichenempfängers zunächst auseinanderfallen - waren in den 70er Jahren die Underground Comics, sind heute Teile der kommerziellen Comics-Produktion. Die Gefühle scheinen nun tatsächlich in die Körperfasern der gezeichneten und gemalten Menschen gefahren zu sein; sie liegen auf ihren Lippen, schweben über den Augenbrauen, stecken im Sprunggelenk. Es müssen starke Gefühle sein, denn das kräuselt und verzieht sich, krümmt und dehnt sich, robbt, klettert, stolpert, rennt. Aber wozu diese Hektik und Aufgeregtheit? Als Stefano Tamburini und Tanino Liberatore Ende der 70er Jahre in der Comicszeitschrift „Frigidaire“ die Figur von RanXerox entwarfen, war es ihre erklärte Absicht, durch dieses menschliche Monstrum und die Handlungsmuster, die es forderte, Wege aus dem Kerker der Intellektualität zu weisen — das Risiko einer rationalistischen Flucht war einkalkuliert. Waren Comics früher im besten Fall „frisch, zugreifend, originell“, so ist den Comicszeichnern nun kein Tabu heilig, keine Perversion zu ekelerregend. Der Szenarist und der Zeichner idealisieren die Brutalität, entdecken ihre Lust am Grotesken und Deformierten, den Reiz der Gewalt, der Zerstörung und die Nähe von Tod und Leben. Der Kult der pensiera negativa wird zelebriert. Wichtiger als die Farbsignale sind jedoch die Körper- und Bewegungszeichen, die sich im muskelstrotzenden Körper von RanXerox, dieser fleischgewordenen Maschine, konzentrieren. Wenn sich in seinem Gehirnzentrum nicht gerade zwei Drähte berühren oder seine Batterie zu Ende geht, dann fletscht dieses Wesen die Zähne, stülpt die kurze Nase hoch, ballt die Fäuste, spannt die Muskeln und fliegt, zusammengekauert zum Geschoss geworden, durch den Raum, fällt mit aller Wucht die Zielscheiben seines Zorns an; er zerquetscht, zermalmt und massakriert sie. Seine Gefühlsregungen sind kaum motiviert, seine Reaktionen in jedem Fall unverhältnismässig. Episode reiht sich an Episode. RanXerox überwindet Räume, ohne dass ihm die Zeit zu folgen vermag. Die Aktion wird zeitlich komprimiert, artet zum wilden Stakkato, zur irren Repetition aus. Nach einem kurzen Vorgeplänkel kommt es regelmässig zur Gewalttat, auf dem Höhepunkt jeder Handlungssequenz spritzt Blut, fliesst ein Auge aus, hängen Gedärme in der Luft. Ein Comics-Brutalo einfachster Machart? Gegen diese Etikettierung spricht die stupende Technik. Von Panel zu Panel wechselt die Kamera, respektive der Betrachter-Zeichner seinen Standpunkt. Er springt vom einen ins andere Extrem. Schwebt einmal über den Köpfen der Menschen, kriecht das andere Mal zwischen ihren Beinen durch, liefert so eine Fülle von Detailinformationen über die Räume und die Menschen, die sie bevölkern. Er wird Kleider, Haltungen, Gesichtszüge der Figuren zu einem vielschichtigen Soziogramm zusammenfügen.
Trotzdem, wer nicht an die Katharsis-Theorie glaubt - daran, dass sich durch die Beobachtung von Gewalttaten das eigene aggressive Potential abbaut -, wird bereitwillig diesen Comics-Geschichten den Wert absprechen. Das liegt in der Absicht vieler Comics-Erfinder. Tamburini und Liberatore z.B. wollen Ware produzieren; konsumierbar, wegwerfbar, schwer zu entsorgen. Einen neuen Trend oder gar einen neuen Kode zu prägen, liegt ihnen fern. Der scharfe Wind des Sarkasmus schlägt jedem entgegen, der bestimmte Forderungen an ein Kunstprodukt - und sei es auch eine Massenware — stellt. Unter anderem werden die heiligen Kühe der Moderne und der Spätmoderne, Originalität und Geschwindigkeit, im Manifest der „Arte mai vista“ oder der „Arte immobilista“ geschlachtet. Das alles ändert nichts daran, dass die Geschichten von RanXerox ihre Wirkung haben, unsichtbare Sporen hinterlassen, die sich unter die Haut bohren. Die Lust an der Grenzüberschreitung, am Übertriebenen und an der Sinnlichkeit der Materie — immer gebrochen durch das Prisma von Selbstironie und Witz -, die innerhalb von Kunst und Film zu erlahmen drohte, erhält von der Seite der Comics-Szenarien und -Zeichnungen neue Nahrung. Das Aufeinanderprallen von verstümmelten, deformen Männerkolossen und klischeehaft idealisierten Frauenleibern - auch im Comics Morbus Gravis von Paolo Eleuteri Serpieri - erzeugt eine innere Gespanntheit, die den Ekel vor der Banalität des Alltagslebens im Nu vertreibt.
Seitdem sie am Ende des 19. Jahrhunderts ihre ersten Schritte wagten, haben sich die Medien Comics und Film gegenseitig befruchtet. Lange Zeit konnten die Zeichner von Kameraführung, Schnitt- und Montagetechnik der Filmer lernen. Gegenwärtig gehen von der Comicsproduktion wichtige Impulse für den Film aus. „It’s a strange world!“, so fasst - schaudernd vor Erregung — der jugendliche Held Jeffry in Blue Velvet die Erkenntnisse zusammen, die er auf nächtlichen Eskapaden beim Blick in die Welt menschlichen Getriebenseins und Gejagtwerdens gewinnt. Er, geborgen im kleinbürgerlichen Milieu, wurde durch die schwülen Dämpfe des Bösen und die süssen Düfte des Todes angezogen. Er hat den Eros der Lebensverneinung berührt und wäre beinahe in das Meer aus Gewalt, Drogen und Sex hinabgesunken. Frank, der Gegenspieler Jeffrys in Blue Velvet, und RanXerox - beides grimassierende Monstren mit Schaum vor dem Mund - ritualisieren die Grenzüberschreitung und den Tabubruch. Obgleich sie gewisse Ähnlichkeit mit Gestalten aus unserer Alltagsrealität haben, sind es Kunstfiguren, mit technischer Meisterschaft vom Schauspieler Denis Hopper und vom Zeichner Liberatore zum Leben erweckt. Eine Lebendigkeit, die zum Ted auf grosse Namen der europäischen Kunstgeschichte zurückzuführen ist: Der italienische Comicszeichner orientiert sich an Malern wie Michelangelo oder Giulio Romano.
Was sich - abgesehen von der inhaltlichen Nähe zu gewissen Comics - an einem Kultfilm wie Blue Velvet noch beobachten lässt, ist die Verwandtschaft zum „Iperrealismo fauve“, der im Umfeld von Zeitschriften wie Canibale, Frigidaire oder Heavy Metal grassiert. Beliebt ist das Aufeinanderprallenlassen verschiedener Stile und unterschiedlicher Stilhöhen: genüsslich vorgetragene Künstlichkeit trifft sich mit scheinbarer Wirklichkeitstreue. Aber ist dadurch schon ein Zipfelchen Wahrheit erhascht? Der kinesische Kode zu neuem Leben erweckt?
Die künstlerische Meisterschaft, das Beherrschen verschiedener Techniken ändert nichts an der Tatsache: am Äussersten wird die Luft dünn. Die extremen Formen der Körpersprache lassen keine Variation, keine Nuancierung zu. Es kommt zwangsläufig zu Wiederholungen, beim Leser und Zuschauer stellen sich Ermüdungserscheinungen ein, sie stumpfen ab. „Don’t look at me!“, schreit Frank seinen Mitmenschen entgegen. Er ahnt, dass sein Anblick Schrecken erzeugt, der nur durch emotionale Gleichgültigkeit für den Schauenden ertragbar wird. Allmählich nimmt der Rezipient die verstümmelten, die verzerrten Gesichtszüge in sein Vokabular mimischer Äusserungen auf. Er registriert die Abscheulichkeiten, liest sie und verarbeitet sie nicht, so wie er täglich eine Menge von Unglücksfällen und Verbrechen nicht verarbeitet. Seine Kodekompetenz im Bereich der Kinesik mag sich durch Film und Comics erweitern und modifizieren, er selber verändert sich in den seltensten Fällen. Vielleicht wird es ihn nun weniger unangenehm berühren, wenn in seiner Lebenswelt ein Mitmensch mit hervorquellenden Augen von einem Asthmaanfall geschüttelt wird.
Die rauschhaft intensive Motorik der grausigen Comics- und Filmhelden entbindet von der Frage nach dem Wozu und dem Danach - auch die Frage nach dem Sinn dämmert nicht am Horizont. Ich balle die Faust, also bin Ich! Ich zeige die Zähne, und niemand wird von mir erwarten, dass ich denke. Den Experten der Aktion bleibt keine Zeit, vor der Tat eine Phase des Erfahrens und Erkennens einzuschieben. Erkennen ist diesen Berserkern des wilden Treibens, die blitzschnell auf alles reagieren, was sich bewegt, fremd. Sie sind, wo immer sie sind, mittendrin; können sich keinen Überblick verschaffen. Auch der Rezipient, der Hauptfigur immer auf den Fersen, hat Mühe, zur Besinnung zu kommen.
So lässt sich abschliessend feststellen, die patriarchal kodierten Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder - im wesentlichen Resultat der Information, die man der Körpersprache entnimmt - sind im Umgang mit Comics angeritzt, aber nicht aufgebrochen worden. Allenthalben macht sich Verwirrung breit. Was eben noch durch seine Klarheit schmerzte - die intensive Körpersprache —, entzieht sich hinter schwefeligen Dämpfen dem Zugriff der Logik. Die überdeutliche Gebärde verweigert sich dem Lesehungrigen, sie kippt ins Rätselhafte um. Aus dem Lügenfeuer(werk) steigt nicht zwangsläufig die Wahrheit empor. Die Gliedmassenverknotung ist nicht automatisch mit Herzverwirrung zu übersetzen, das Gesichtsmuskelchaos nicht mit Seelenvibrationen.
So kehren wir beruhigt zum stummen und makellosen Körper Ellen Barkins und den aufreizenden Rundungen Marie Jades, des naschhaften Luxuspüppchens im gleichnamigen Comics von Chris Scheuer und Rodolph, zurück. Sind diese scheinhaft schönen Figuren nicht ehrlicher als die von Akne und Narben entstellten Körper Liberatores? Selige Körperinseln, die sich willig von männlichen Seelen- und Gehirngespinsten einwickeln lassen. In ihrer Lügenhaftigkeit wirken die Leiber dieser Comics- und Filmstars menschlich, und sie sind menschlich, weil sie durch ihren Anblick niemanden überfordern, verändern wollen: Körper, herausgelöst aus dem unerbittlichen Diskurs der Wahrheit.