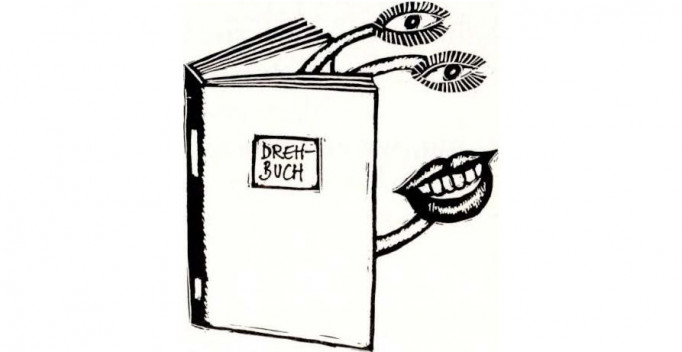„Was der deutschsprachige Film heute vor allen Dingen braucht, sind gute Bücher. Die Krise, in der sich die Branche seit einem Jahrzehnt befindet, ist ja eindeutig die Folge dessen, was in den Siebzigern unter dem Begriff Autorenfilm Mode geworden war. Von den Erfolgen des genialischen Wunderkinds Rainer Wim Herzog geblendet, hatten es die verantwortlichen Stellen - sprich: Filmhochschulen, Redaktionen, Gremien - versäumt, dem Nachwuchs zu vermitteln, was seit jeher die Grundlage eines jeden gelungenen Films ausmacht, nämlich ein packend erzähltes, dramaturgisch überzeugend konstruiertes und inhaltlich gehaltvolles Drehbuch! Gerade weil wir den sowohl künstlerisch wertvollen, als auch beim Publikum erfolgreichen Film wollen, müssen wir nun danach trachten, die so sträflich vernachlässigte Kunst des Drehbuchschreibens wiederzubeleben, und also den Drehbuchautoren mit allen verfügbaren finanziellen und ausbildungsprogrammatischen Mitteln fördern.“ So oder so ähnlich tönte es aus dem Mund der erfahrenen Produzenten, kam es über die Lippen des kompetenten Redakteurs, floss es aus der Feder des berufenen Kritikers. Beifall nickend sah ich mir das ansonsten eher wieder fade Kulturmagazin noch bis zu Ende an und schnitt mir am nächsten Morgen zufrieden den entsprechenden Artikel aus der Tageszeitung. Ich konnte den Herren und Damen ja nur zustimmen, hatte ich doch selbst gerade mein erstes abendfüllendes Drehbuch geschrieben (d.h., eigentlich nur das Exposé zum Buch, denn für die detaillierte Ausführung desselben wollte ich ja mit einem gerechten Honorar bedacht sein), und wartete nun furchtsam, doch trotzig, auf Resonanz.
Drei Monate und fünf Absagen älter, ereilte mich dann im Mai 1987 die Nachricht, dass ich einer von zehn glücklichen Stipendiaten der 2. Drehbuchwerkstatt des Literarischen Colloquiums Berlin sei. Acht Monate lang würde ich nun Zeit und Geld (nämlich 16 000 Mark à 2000 monatlich) haben, aus meinem vielversprechenden Exposé ein Erfolg, Ruhm und noch mehr Geld bringendes Drehbuch zu machen. Die Teilnahme an zwei zehntägigen Seminarblöcken, sowie an fünf zusätzlichen Arbeitswochenenden sei obligatorisch, da eigentlicher Zweck der Sache. Am Ende würde ich entweder wissen, wie man ein packend erzähltes, dramaturgisch überzeugend konstruiertes und inhaltlich gehaltvolles Drehbuch schreibt, oder erkennen - auch das ein persönlicher Gewinn -, dass meine Ambitionen grösser als mein Talent waren, und ich mich doch besser auf einem anderen Feld der Berufsausübung versuchen sollte. (Die zweite Möglichkeit kam für mich natürlich nicht in Betracht, wurde auch so von den Organisatoren und Betreuern der Werkstatt nie formuliert, bohrte sich aber während der folgenden acht Monate wie ein kalter Wurm immer wieder ins Gewissen des Stipendiaten).
Ich rief also sofort Mutter, Vater, Freunde an, die noch bis zum Vortag zur Beendigung eines „sinnvollen“ Studiums, respektive zur Ergreifung eines reellen Brotberufs geraten hatten, und verkündete stolz und siegesgewiss meinen Aufstieg zum anerkannten Drehbuchautoren. Dann trank ich acht Budweiser im Café M und freute mich. Erst am nächsten Morgen mischten sich in den aufkommenden Bierjammer leise zwickende Bedenken und Ängstlichkeiten hinsichtlich des bevorstehenden „Ausbildungslehrgangs“. Schliesslich kannte ich die Tätigkeit des Schreibens bis dato als eine rein monologische, als schöpferischen Akt, der Einsamkeit, Abgeschlossenheit und Unbeirrtsein von äusseren Einflüssen braucht, um wahrhaft Originäres hervorzubringen. Wie würde es mir da ergehen, wenn in Berufung auf ihre Berufung nun plötzlich x, y und z mir in jeden Dialogsatz dreinredeten, noch bevor dieser überhaupt zu Papier gebracht sein würde?
Der erste Tag war fürchterlich. Zehn Stipendiaten und zehn Betreuer sassen sich bei Saft, Kaffee, Obst in einer viel zweifelhafte deutsche Geschichte atmenden, also einschüchternd imposanten Herrenvilla am Wannsee gegenüber. Jeder einzelne Stipendiat sollte nun in möglichst knapper und präziser Formulierung Inhalt und Thematik seines Projekts vorstellen. Darauf war ich nicht vorbereitet, hatte ich doch in meinem Exposé bereits nämliches getan. So geriet ich bei meinen Ausführungen ziemlich schnell ins Stocken, wischte mir die feuchten Hände an der Hosennaht und versuchte erfolglos darüber hinwegzulächeln, dass ich mir über Inhalt und Bedeutung meines Buchvorhabens vielleicht doch noch nicht so klar war, wie man es offenbar von mir erwartete. (Am Ende der Drehbuchwerkstatt freilich sollte ich feststellen, dass die Grundidee zu meiner Geschichte damals zwar noch ungenügend formuliert, als meine eigene jedoch durchaus vorhanden gewesen war, während das fertige Drehbuch dann zur Unzufriedenheit aller zwar viele kleine, klar erkennbare Ideen, jedoch kein einheitliches, tragendes, gedankliches Gerüst mehr beinhaltete, aber ich greife vor ...) Der zweite Tag verlief glimpflich. Kleine Arbeitsgruppen aus Stipendiaten und Betreuern (sprich Redakteuren und Produzenten) wurden gebildet und es gab auch ein richtiges Mittagessen mit - soweit ich mich erinnere - Kartoffelsalat.
Die Arbeit am treatment ging zügig voran. Ich schrieb meine zwei bis drei Seiten täglich und freute mich über die erste auf meinem Konto eingegangene Rate. Den empfohlenen kritischen Ideen- und Gedankenaustausch mit anderen Stipendiaten sowie meinen Betreuern vermied ich zunächst, wollte ich doch erst etwas halbwegs Fertiges vorzuweisen haben, das als Diskussionsgrundlage dienen könnte. Ich war mir meiner Sache ziemlich sicher, schickte hochtrabende Briefe nachhause, verliebte mich, kaufte mir eine neue Schreibmaschine und liess im Gespräch mit Freunden bei jeder sich bietenden Gelegenheit einfliessen, dass ich nun definitiv auf dem Weg nach oben sei. Dann kam der erste Seminarblock. Eher skeptisch lauschten wir dem umfassend und sorgfältig recherchierten Vortrag des Dozenten, der uns in die amerikanische Technik des Drehbuchschreibens einweihte. Bald wussten wir, dass jedes „gute Drehbuch“ in drei Akte eingeteilt zu sein habe, wobei am Ende des ersten und des zweiten Aktes ein sogenanntes plot point als dramaturgischer Wendepunkt einzubauen sei.
Dieses Erzählschema, so wurde uns versichert, sei schon seit Jahrhunderten (!) bewährt und also durchaus verbindlich. Wir bräuchten uns nur ein beliebiges Meisterwerk aus der Filmgeschichte herauszugreifen, und würden sofort auf nämliches Schema stossen. Und Ausnahmen würden hier nur die Regel bestätigen. Zwar wolle und könne man uns damit kein Rezept verordnen, doch seien wir, mangels besseren Wissens gut beraten, uns daran zu halten.
Bei mir mischte sich Unsicherheit mit Empörung. Schliesslich wollte ich meine mir heilige künstlerische Freiheit nicht durch die Weisheiten irgendwelcher dollar-verwöhnter Gurus aus der Traumfabrik einschränken lassen! Andererseits war ich doch unzweifelhaft hier, um etwas zu lernen, und - wer weiss - vielleicht war eine gewisse dramaturgische Linie, zumindest als Ausgangspunkt, doch ganz hilfreich. Am Ende des Seminars wurde uns dann die Aufgabe gestellt, unsere Geschichten auf vier Seiten zusammenzufassen, und zwar in genauer Einteilung in Exposition, plot point I, Mittelteil, plot point II und Finale. Wider Erwarten funktionierte dies bei mir beinah reibungslos, und meine anfängliche Skepsis wich der vorschnellen Überzeugung, dass ich eben von Haus aus auf dem richtigen Weg gewesen sei. Erst viel später, nach der vierten, noch immer unbefriedigenden Version meines Buches, fing ich an, mir die Frage nach einer verbindlich erlernbaren Technik des Drehbuchschreibens erneut und etwas vorsichtiger zu stellen.
1. Exkurs - Dialog zwischen dem Germanistikstudenten A, der gerade das Buch Screen Writing von Syd Field gelesen hat, und B, einem Absolventen der Kunstakademie, der seit zwei Jahren kein Bild mehr zu Ende gemalt hat. Beide kommen soeben aus der Spätvorstellung des Films Rain Man.
A: Und?
B: Ich glaub, ich nehm den Nachtbus.
Nein, was meinst du zum Film?
Ach so ... also, den muss ich erst ein bisschen wirken lassen, da kann ich jetzt so direkt gar nicht viel sagen ...
Komm, der war doch einwandfrei, oder?
Naja, schon, aber ... ob der jetzt die vier Oscars alle verdient hat ... ich mein, der Dustin Hoffmann hat schon toll gespielt, aber ...
Was heisst da, der Dustin Hoffmann ... die ganze story war gut! Das war ein absolut perfektes Drehbuch! Da stimmte einfach alles, verstehst du?
Das Drehbuch? Naja, also da kenn ich mich jetzt nicht so aus, da müsst’ ich erst ein bisschen drüber nachdenken ...
Also erstmal die Dialoge: Die waren doch unheimlich witzig, knapp, und doch treffend. Da war kein Satz zuviel und keiner zu wenig. Da kann man sagen, was man will, aber das können sie einfach, die Ami’s. Wenn ich da an dieses ewige Gelaber in deutschen Filmen denke ...
Na gut, das stimmt schon ...
Eben. Und die Charaktere haben auch gestimmt. Das ist überhaupt das wichtigste: glaubwürdige Figuren.
Ich sag, ja, der Dustin Hoffmann ...
Das lag nicht nur an den Schauspielern, das lag auch an der Konzeption der Figuren! Da hatte jeder ein ganz bestimmtes Ziel, need nennt man das auf Amerikanisch. Das ist erst mal nötig, damit überhaupt was in Gang kommt. Und weil der Dustin Hoffmann ein ganz anderes need hatte, als der Tom Cruise, gab es einen Konflikt. Zack! Und weil die beiden, so verschieden sie auch waren, sich doch irgendwie zusammenraufen mussten, gab es eine spannende Geschichte! Das klingt zwar einfach, aber es funktioniert. Das kannst du bei zig anderen amerikanischen Filmen auch beobachten!
Naja, das ist es ja gerade. Irgendwie hatte ich das Gefühl, als hätte ich das alles schon zwanzigmal gesehen.
Es gibt halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Geschichten. Man muss sie nur immer wieder auf eine neue, originelle Art erzählen!
Schon, aber worum gings eigentlich in dieser Geschichte? Also, was war für dich das Thema des Films?
Ist doch ganz klar, Autismus!
Na gut, aber was will uns der Autor sagen?
Naja, eben dass ... also da sind zwei Brüder, der eine ist ein mieser Yuppie und der andre eben Autist, und an sich können sich die beiden überhaupt nicht verstehen, aber mit der Zeit lernen sie dann doch einer vom andern ...
Klingt ziemlich schematisch, findest du nicht? Ich mein’, statt Yuppie und Autist könnte man doch genauso gut Journalist und Guerillero, oder Kommunist und Grossgrundbesitzer, oder Pfarrer und Nutte ...
Das ist eben ein klassisches Erzählmuster, da ist doch nichts Schlechtes dran!
Also reden wir jetzt über Erzählmuster oder über das Thema des Films?
Das ist doch ein und dasselbe. Inhalt und Form. Eins ergibt sich aus dem andern, oder?
Genau. Aber dann versteh ich nicht, warum es in diesem Film um Autismus gehen soll. Was wir gesehn haben, war doch nichts anderes, als die x-te Version von „Zwei gute Kumpels on the road“
Buddy-Film nennt man sowas ...
Aber was uns dann noch als „soziales Thema Autismus“ aufgetischt wird, ist doch nur Vorwand, Alibi, beliebiges Vortäuschen von „Aussage“.
Mann, jetzt wirst du aber dogmatisch. Du hast dich doch auch gut unterhalten, gib’s zu ...
Solange der Film lief, schon, aber danach ...
(Beide müssen lachen)
Anmerkung: Seit etwa drei Jahren reisen amerikanische Drehbuchlehrer wie Robert McKee, Syd Field, Frank David u.a. quer durch Mitteleuropa und bringen lernbegierigen und zahlungskräftigen Nachwuchsautoren bei, wie sie ihre Lieblingsfilme Casablanca, Chinatown oder auch Rain Man noch einmal schreiben können: Das ist ungefähr genauso begrüssenswert oder verwerflich wie die schon etwas länger grassierenden method work-shops für Schauspieler. Wir warten ja auch alle sehnsüchtig auf den ersten bayrischen Mickey Rourke, oder?
Sommerferien im Tessin. Ich liege im Maggia-Tal auf einem warmen Felsen und freue mich auf die Eröffnung der 40. Filmfestspiele von Locarno. Aber ein Künstler kennt keine Ferien. Deshalb liegt mein inzwischen auf 50 Seiten gewachsenes Manuskript im Hotelzimmer und wartet - Papier ist geduldig - auf weitere Bearbeitung. Vier Wochen später komme ich braungebrannt nach Berlin zurück und habe keine einzige Zeile geschrieben.
Was war bloss los? Die Hälfte meiner Stipendiaten-Frist war verstrichen und mein Buch gefiel mir weniger und weniger. Obwohl das dramaturgische Gerüst doch stimmte, kam es mir nun jeden Tag vor, als schriebe ich völlig ins Blaue hinein. Also begann ich umzubauen, zu korrigieren, wieder zu verwerfen, neue Figuren einzuführen und gleich wieder zu streichen, und verlor langsam aber deutlich meine Geschichte immer mehr aus den Augen. Als dann ein Wochenende mit meinen Betreuern ins Haus stand, kam mir zum ersten Mal zu Bewusstsein, dass ich mein Stipendium nicht ewig würde einstreichen können, und ich meine erste wirklich professionell verdiente Mark als Drehbuchautor noch gar nicht verdient hatte. Und schliesslich war das Film-Business ein hartes Geschäft, da musste man schnell und präzise, ja, vor allen Dingen schnell arbeiten, das hatte man uns oft genug versichert! „Fristgerecht abliefern“ war oberstes Gebot! Und so schüttelten die Herren Redakteure und Damen Produzenten auch bedenklich die Köpfe ob meiner plötzlichen Schaffenskrise und schlugen mir mit fuchtelndem Zeigefinger aufs Gewissen: Schreib oder stirb! Da konnte ich noch so beschwichtigend von „kreativer schöpferischer Pause“ reden, ich glaubte mir ja selber nicht. Und es kam noch schlimmer: meine Geliebte wanderte aus und meine Mutter schickte mir Päckchen mit schrecklichem Selbstgestricktem für die „langen, kühlen Herbstabende am Schreibtisch“.
Der zweite Seminarblock wurde von den beiden polnischen Regisseuren Edward Zebrowsky und Woytech Makejew betreut. Jeder der Stipendiaten musste eine Szene aus seinem Buch mit professionellen Schaupsielern inszenieren oder von einem professionellen Regisseur inszenieren lassen. Ich entschied mich dafür, selbst zu inszenieren und ging bis zum Haarschopf baden. Es zeigte sich, dass ich über meinen Bemühungen um plot point, plant und pay off (ein Revolver, der im 3. Akt abgefeuert wird, muss im 2. bereits in der Schublade liegen), die innere Motivation meiner Figuren sträflich vernachlässigt hatte, so dass ich nun selbst nicht fähig war, den Schauspielern, die jetzt meine Texte sprechen mussten, Einleuchtendes zu erläutern. Ich musste einsehen, dass keine Szene in einem Drehbuch für sich steht, sondern von der vorangegangenen ebenso wie von der darauffolgenden bestimmt und gedeutet wird, und kam so darauf, dass meiner ganzen Geschichte etwas Entscheidendes fehlte, nämlich eine klare Haltung des Autors zu seinen Figuren und also (noch schlimmer!) das ganz einfache Bewusstsein des Erzählers über seine eigenen Absichten. Der Gipfel der Ratlosigkeit war erreicht, und es konnte nur noch besser werden. Ich musste also wieder ganz von vorne anfangen und fragte mich nun, wie ich dies den betreuenden Damen und Herren aus Produktion und Sender klarmachen sollte, rechnete ich doch immer noch fest mit deren finanzkräftiger Hilfe für eine spätere Realisierung meines Projektes.
2. Exkurs - Fragen an einen jungen Drehbuchautor, der gerade sein zweites Buch schreibt.
Frager: Können Sie von Ihrer Arbeit leben?
Autor: Im Augenblick ja, ich habe einen Projekt-Vertrag mit einem Fernsehsender. Was danach kommt, weiss ich noch nicht.
Arbeiten Sie alleine, oder mit einem Co-Autor?
Ich habe das Glück, mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der bereits mein erstes Buch realisiert und mitgeschrieben hat.
Wie sieht diese Arbeit praktisch aus?
Wenn eine Idee da ist, wird zuerst darüber diskutiert, dann schreibt einer das Exposé, dann wird diskutiert und korrigiert. Gemeinsam erstellen wir dann das treatment, in dem Motiv und Sinn jeder einzelnen Szene genau bestimmt werden. Dann führt wieder einer die einzelnen Szenen samt Dialog aus, der andere liest und kritisiert, und es wird noch mal korrigiert.
Waren Sie bei der Verfilmung Ihres ersten Buches manchmal am Set?
Beinahe jeden Tag. Ich mischte mich nicht in die Inszenierung ein, profitierte aber allein schon vom Zusehen. Vieles funktioniert bei der Realisierung überhaupt nicht so, wie man es sich an der Schreibmaschine ausgedacht hat. Da kann man auch für’s Schreiben viel lernen.
Wurden Ihre Dialoge oft verändert?
Verändert oder gestrichen, ja.
Wurmt Sie das?
Ein Drehbuch ist kein eigenständiges, fertiges Kunstwerk, sondern lediglich Vorlage, Material für den Regisseur. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass nur aus einem guten Drehbuch auch ein guter Film werden kann, es sei denn, der Regisseur schreibt selber, und sei es auch nur in seinem Kopf, um, und wird damit selber zum Autoren.
Glauben Sie, dass die vielbeschworene Krise des deutschsprachigen Films auf eine mangelnde Qualität des Drehbuchs zurückzuführen ist?
Es gibt bei uns nicht wie in Amerika eine kontinuierliche Tradition des Drehbuchschreibens. Das heisst aber für mich nicht, dass man sich nun mangels Alternative der amerikanischen Tradition bedienen oder besser unterwerfen sollte. Wie man eine Geschichte am besten erzählt, das hängt davon ab, welche Geschichte man erzählt. In Amerika werden seit Jahrzehnten - mal gut, mal weniger gut - immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Das mag für Amerika in Ordnung sein. Sollten wir hier in Deutschland aber keine eigenen Geschichten zu erzählen haben, würde sich für mich das Drehbuchschreiben erübrigen. Wenn wir etwas eigenes zu sagen haben, werden wir auch eigene Formen finden. Im übrigen verstehe ich die neumodische Diskreditierung des sogenannten Autorenfilms nicht. Was soll schlecht daran sein, wenn der Regisseur seinen Autor so gut kennt wie sich selbst?
Das kommt vielleicht daher, dass der Autorenfilm in letzter Zeit bei uns nicht sonderlich erfolgreich war.
Dann waren eben die Regisseure manchmal keine guten Autoren. Aber das hat doch nichts Zwangsläufiges an sich.
Sie glauben also nicht, dass Ihr Beruf, nämlich der des Drehbuchautoren, bei uns unterbewertet und vernachlässigt wird?
Ich würde mir natürlich eine grössere Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit wünschen. Das können aber nur Funktionäre auf Festivals und Journalisten bewirken. Mit der Qualität eines Buches hat das nichts zu tun. Früher kannte man nur die Schauspieler, die Stars, später wurden dann auch die Regisseure wichtig. Das heisst aber nicht, dass sie besser wurden.
Erneutes Treffen mit Tutoren und Stipendiaten. Zwei der Bücher waren bereits so gut wie verkauft, meines, da ich wieder von vorne begonnen hatte, noch nicht mal halb fertig. Von allen Seiten kamen nun Ratschläge und Kritik, mal mitfühlend schulterklopfend vorgetragen, mal von unverhohlen verärgertem Kopfschütteln begleitet, auf mich zu. Noch 7 Wochen bis zur absoluten dead-line, und ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand. Ich griff mir die plausibelsten Ideen meiner Kritiker heraus, und setzte mit dem Mut des Verzweifelten zum Endspurt an. Fünf Wochen später tippte ich das schöne Wörtchen „Ende“ aufs Blatt und fühlte mich wie ein Fussballspieler, der gerade direkt aus der Kreisliga in die A-Nationalmannschaft berufen worden war. Die vor einem Jahr gesendete Diskussion zum Thema „Drehbuchschreiben heute“ kam mir in den Sinn, und ich kramte den dazugehörigen inzwischen etwas verblichenen Zeitungsartikel wieder hervor, der die wichtigsten Zitate enthielt: „Packend erzählt“ war mein Buch zweifellos (das hatte ich wohl den Polen zu verdanken), die dramaturgische Konstruktion war so überzeugend wie nur was (Syd Field sei dank!), „inhaltlich gehaltvoll“ war gar keine Frage (ich hatte im letzten Moment noch eine wirklich zu Herzen gehende Liebesgeschichte eingebaut!), „künstlerisch wertvoll“ verstand sich irgendwie von selbst, und der Erfolg beim Publikum war ja nur eine Frage der Zeit. Dass am Ende trotzdem keiner mein Buch haben wollte, warf dann zwar meine kostspieligen Urlaubspläne, nicht aber mein Selbstbewusstsein um. Heute weiss ich zwar, dass mein Buch geradezu vorbildlich misslungen war (viel angewandte Technik, aber keine persönliche Handschrift mehr), doch sollten mir meine bei der Drehbuch-Werkstatt gesammelten Erfahrungen auf längere Sicht trotzdem von Nutzen sein. Vor allen Dingen hatte ich gelernt, dass es ein Erfolgsrezept nicht gibt, da jede Geschichte ihre eigene Form verlangt, dass man aber aus der Kenntnis verschiedener, erprobter Erzähltechniken durchaus eine eigene „Methode“ entwickeln kann.
Nachtrag: Als ich im August 1988 bei den Filmfestspielen von Locarno mein erstes, von meinem Freund und Co-Autoren Marcel Gisler verfilmtes (!) Drehbuch präsentieren konnte, wurde ich - ich hatte in dem Film auch eine Rolle als Darsteller übernommen - überall nur als Schauspieler vorgestellt und wahrgenommen. Wies ich diskret auf meine Arbeit am Drehbuch hin, erntete ich nur freundlich-mitleidige Blicke. Genauso gut hätte ich damit angeben können, ich sei der Schwager des zweiten Kamera-Assistenten.