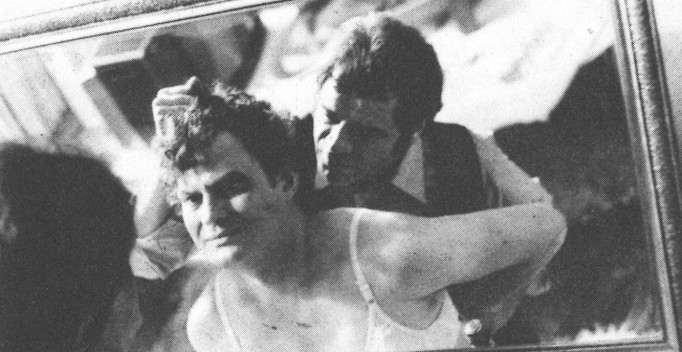Bis zum Jahr 2000, so erklärte er an einer Pressekonferenz anlässlich der Vorführung seines zweitletzten Films Die Sehnsucht der Veronika Voss an den diesjährigen Berliner Filmfestspielen, wolle er noch eine Vielzahl von Filmen machen. Und mit jedem dieser Filme werde er dem, was er suche, ein wenig näherkommen. Wenn er es dann gefunden habe, könne er aufhören, Filme zu machen. Einige haben bei diesen Worten Fassbinders gelacht — es werden dieselben gewesen sein, die zu der Pressekonferenz nur gekommen sind, um vielleicht bei einem Skandal dabei zu sein. Fassbinder wurde oft falsch verstanden. Er war so direkt. Das liegt nicht jedem.
Sein Leben wollte er zu einem einzigen Film machen. Dreizehn Jahre lang ist das auch gegangen, dann ist der Film gerissen. Querelle ist der letzte Teil dieses langen Films geworden. Aber Querelle ist nicht das Ende. Fassbinders Lebensfilm beschreibt zwar einen mühevollen, nicht endenwollender Weg in die Dunkelheit. Aber der Tod, das war es nicht, was Fassbinder suchte.
Nach der Revolution
Anfangs der siebziger Jahre liefen hier (in Bern, im Kellerkino) seine ersten Filme. Das interessierte damals noch nicht. Fassbinder, das war kein Name, weder für die Filmwirtschaft noch für ein Partygespräch. Die Filmwirtschaft hätte wohl beleidigt Klage eingereicht, wenn man behauptet hätte, sie werde sich eines Tages an dem zornigen deutschen Jungfilmer zu bereichern versuchen. Den einen, den Kulturellen, war er zu unanständig, zu grob — ein Primitiver, der zu viele Gangsterfilme gesehen hat. Den anderen, den müde gewordenen linken Studenten, war er zu wenig klassenkämpferisch — ein Unpolitischer und darum ein Reaktionär. Wer wollte denn damals schon kahle Wände anstarren und kaputte Gesichter, wo doch gerade die revolutionären Filme aus der Dritten Welt die grosse Mode waren? Bilder vom Einzug bärtiger und schmutziger Männer in irgendein Kaff am anderen Ende der Welt, Befreiungsszenen aus dem sozialistischen Bilderbuch vermochten damals halt mehr zu verzücken. Fassbinder war zu nah dran an dem, was man selber nicht hatte ändern können.
Zu Götter der Pest, 1969 gedreht, sagte er 1974:
Und dann ist er so in einer Zeit gemacht, in dieser Zeit nach der Revolution, wo man einfach überhaupt nicht mehr wusste, wo’s jetzt langgeht, ob man weiter für Politik sich interessieren soll oder nicht, und wirklich alle eigentlich völlig am Arsch waren — da trifft der Film mich ganz persönlich.1
Wo er nicht abgelehnt wurde, da verunsicherte er. Er war, wie viele andere auch, an einem toten Punkt, aber er ist zu seiner Ratlosigkeit und zu seiner Wut gestanden. Er hat sich — indem er die Kamera auf die Umwelt richtete wie der Gangster die Pistole auf den Kassier in einer Bank—mit dieser Situation intensiv auseinandergesetzt. Auf seine eigene Art, ganz direkt und nur sich selber verpflichtet. Diese Hinwendung zum Persönlichen, oder anders gesagt: diese Veröffentlichung privater Ängste und Sehnsüchte war ungewöhnlich.
Privatsachen: Peter Handke 1969 über Liebe ist kälter als der Tod:
Den Unterschied dieses Films zu den meisten anderen Filmen (im Wettbewerb der Berliner Filmfestspiele) könnte man etwa so verdeutlichen: das Bett, in dem geschlafen wird, ist von denen, die darin schlafen... sichtlich selber bezogen worden und auch schon vor der Filmeinstellung benutzt worden.2
Einige der frühen Filme erzählen Gangstergeschichten, Liebe ist kälter als der Tod, Götter der Pest, Der amerikanische Soldat. Andere erzählen Geschichten, die zu Kriminalgeschichten werden, Warum läuft Herr R. amok? und eigentlich auch Katzelmacher. Immer aber erzählen diese Filme auch von den Räumen, in denen sie handeln, von den Städten (der Stadt, München), in denen ihre Geschichten ausgedacht wurden. Und wenn sich die Darsteller so benehmen, wie sie sich vorstellen, dass Gangster sich benehmen, so handeln die Filme trotzdem vor allem von den Darstellern selber. Peter Handke warf Liebe ist kälter als der Tod «gewollte Melancholie» und einen «falschen Niemandsland-Charakter» vor. War das 1969 wirklich so schwer, zu verstehen, was Rainer Werner Fassbinder wollte? Oder war es vielleicht die rauhe und fast naive Art Fassbinders, zu reden und zu filmen, die schockierte und ärgerte? War da einer mit einer Wut im Bauch zehn Jahre zu früh gekommen?
Fassbinder 1969:
Man müsste alles als kriminell deklarieren ... Man liest Zeitungen, man hört Nachrichten, sieht Fernsehen und man wird immer böser... Da ist bei mir der Moment gekommen, wo ich nichts anderes mehr machen wollte als die Darstellung von kriminellen Sachen.3
Ein Wilder in Deutschland
Von Liebe ist kälter als der Tod bis Querelle: kriminelle Sachen. Geschichten von Menschen, die zu weit gehen, weil sie nicht anders können, und von Menschen, die zu kurz kommen und zugrunde gehen, weil es in dieser Welt so sein muss. Fassbinder hat nicht nur seine Figuren durch die Hölle geschickt, er muss da selber mehrmals durchgegangen sein. Todessehnsucht, man weiss es nicht nur aus der Klatschpresse, war ihm vertraut. Die Hölle — die zahlreichen Figuren und die des Regisseurs — aber liegt nicht irgendwo. Fassbinder hat nicht auf dem Mond Filme gemacht, sondern zur Hauptsache in der Bundesrepublik Deutschland. Ausser Alexander Kluge hat sich kein anderer Spielfilmregisseur deutschen Films in den sechziger und siebziger Jahren so intensiv mit dem eigenen Land beschäftigt wie er. Im Unterschied zu Kluge ist er dabei verbissen und haltlos vorgegangen: ein Wilder in Deutschland.
Deutschland in seinen Filmen: ein Land zum Davonlaufen. Aber er hat es nicht gemacht, obwohl ihm das Leben und die Arbeit mehrmals schwergemacht wurden. 1976 bis 1978 war so eine Zeit. Nach der Veröffentlichung des Stücks Der Müll, die Stadt und der Tod (von Daniel Schmid in Schatten der Engel verfilmt) wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen, ein öffentlicher Streit über seine Person entbrannte, Suhrkamp sperrte die Auslieferung des Stücks. Fassbinder, damals Direktor am Frankfurter Theater am Turm, kündigte und verliess die Stadt. Bald darauf setzte ein neuer Streit ein, weil Fassbinder vorhatte, «Soll und Haben» von Gustav Freytag für das Fernsehen zu verfilmen.
Fassbinder wollte weggehen und er ging auch. Nach Paris, wo er dann am Drehbuch zu Berlin Alexanderplatz schrieb. Dieses Projekt sei, so erklärte er, der Grund gewesen, warum er Deutschland nicht ganz verlassen habe. In welch schlechtem Zustand er sich in dieser Zeit befunden hat, demonstrierte er selber in der Episode zu Deutschland im Herbst — einem unheimlichen Dokument einer sowohl persönlichen als auch gesellschaftlichen Krise.
In einem Gespräch mit Peter W. Jansen erklärte Fassbinder im Januar 1978 in Paris:
Ich glaube, dass speziell Deutschland sich in einer Situation befindet, wo sehr vieles sehr rückläufig ist. Das heisst, ich würde sagen, dass 1945, als der Krieg zu Ende war, als das Dritte Reich zu Ende gewesen ist, dass da die Chancen, die Deutschland gehabt hätte, nicht wahrgenommen worden sind, sondern dass die Strukturen letztlich und die Werte, auf denen dieser Staat, jetzt als Demokratie, beruht, im Grunde die gleichen geblieben sind. Das heisst, dass das zusammen mit einer Entwicklung nach rückwärts zu etwas führen wird, was eine Art von Staat ist, in dem ich nicht so gerne leben möchte.4
Wohin hätte er denn gehen sollen, wenn er weiter arbeiten und nicht einfach in einer Hängematte faulenzen wollte? Nach Amerika, von dem auch er träumte? Dass er — als angesehener europäischer Regisseur—nicht dorthin gegangen ist, wo er wohl hätte hingehen können, nach Hollywood, mag zu tun haben mit der Angst, dass er dort nicht mehr seine Sache machen könnte. Vielleicht wollte er auch einfach solange warten, bis dass ihm die Grossen der Branche aus den Händen fressen. Doch sein Zögern war bestimmt auch ein Zeichen dafür, dass er nicht loskam von daheim, weil er eben dort verborgen glaubte, was er suchte.
Was hätte Fassbinder in Amerika denn gedreht? Wären seine Filme dort nicht jenen Filmen ähnlich geworden, die in den dreissiger und vierziger Jahren von Emigranten in Hollywood gedreht wurden, weil sie an einem anderen Ort nicht hatten entstehen können, die aber eigentlich europäische Filme waren — französische bei Jean Renoir oder deutsche bei Fritz Lang und — am Anfang — bei Douglas Sirk? Wären es nicht Filme ohne Heimat geworden? Die Produktion jedenfalls, die am meisten amerikanische Grössenmasse annahm, Lili Marken, 1980 mit 10,5 Millionen DM realisiert, war zugleich Fassbinders hässlichste und unpersönlichste. Aber auch Despair, 1977 nach einem Drehbuch von Tom Stoppard mit 6 Millionen und grosser Besetzung — Dirk Bogarde — gedreht, wurde zum zwar eleganten, letztlich aber doch nur geschmäcklerischen internationalen Kunstfilm.
Wieviel anders waren da die Filme, in denen oder durch die Fassbinder die Hand erhob gegen die Heimat: Der Händler der vier Jahreszeiten, Angst essen Seele auf, die Episode zu Deutschland im Herbst, In einem Jahr mit 13 Monden. In diesen Filmen, da paarten sich die Wut und die Zärtlichkeit, die Verzweiflung und die Lust, da hat einer, den es fast zerrissen hat, gebrüllt vor Schmerz und gefleht um ein bisschen Liebe. Da hat einer, dem es in seiner Haut und seiner Umwelt unwohler war als allen anderen, um die Würde des Menschen gerungen, in einer Welt, aus der alles weggefegt ist, was dem Menschen zum Glück verhelfen könnte. Überhöht, manchmal bis ins Extrem gesteigert, hat er gezeigt, was ihn kaputt macht.
Tod in Frankfurt
Die Stadt zum Beispiel. Frankfurt zum Beispiel, der Ort, der in dem Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod gemeint ist. Eine der Figuren dieses Stücks, die Hure Roma B., sagt:
Und die Stadt macht uns zu lebendigen Leichen, zu Horrorfiguren ohne das richtige Kabinett, mit B-Ebenen als Lebensraum, mit Strassen, die uns vergiften, wo man uns noch vergiften kann. Mit Schmerzen, die uns Angst machen, wo wir es uns zu gut gehen lassen. Und jeder Genuss birgt schon die tödliche Reue in sich, und nur die Mörder retten sich, denn ihr Leben hat einen Inhalt, wenigstens das, sie haben das Beste getan. Ich sehe keinen Grund mehr, das zu ertragen, was mir den Atem nimmt, ohne ihn mir wirklich zu nehmen. Ich küsse Tote, schmecke den Geschmack von längst Gestorbenem, der Moder wird mir zum Gesangbuch, der Ekel zum Genuss. Und sang’ ich Lieder, die dem Abgrund trotzen, war ich ein Luder, das das Gehirn von Affen frisst, die leben. Und tu ich’s nicht, lass ich mich selber fressen. Man muss schon sein, wie es gefordert wird, sonst ist man ganz verloren, gänzlich unten durch. Ich will dies Leben nicht mehr leben, Gott. Ich will’s verschenken, mich zum Opfer machen, der Stadt zuliebe, die Opfer braucht, um sich lebendig zu erscheinen, und nicht zuletzt, um mich zu retten, zu retten vor dem Tod im Leben, der mich denen gleichmacht, die vergessen haben, was das ist, ihr Leben. Die stumpf geworden sind und sprachlos und sich glücklich wähnen und vergessen, dass sie eigentlich nicht sind, und denen keine Zähne wachsen, sich im Dschungel zu behaupten.5
1974 habe ich Fassbinder in Frankfurt besucht. Auf dem Weg zu dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnte, bin ich durch einen kleinen Park gekommen. Hinter Gebüschen haben sich zwei Jugendliche gegenseitig beim Fixen geholfen. Dass ich das ausgerechnet auf dem Weg zu Fassbinder gesehen habe, ist ein Zufall. Und doch sind solche Erlebnisse oder überhaupt Erfahrungen in Deutschland nicht unwichtig für den Zugang zu seinem Werk. Sie rücken vieles, was einem braven Schweizer in den Filmen als überrissen und darum vielleicht auch als Darstellung eines nur privaten Weltschmerzes erscheinen mag, in die Nähe des Möglichen. Gelegentliche Besuche in deutschen Bierkneipen können dem Fremden schon einen Eindruck vermitteln von den angestauten Enttäuschungen, die da im Alkohol ertränkt werden. Aufgedunsene Gesichter, obszöne Redensarten und ein Lachen, das nicht fröhlich, sondern grausam ist, weil es messerscharf einen Schwächeren trifft: da kann man erahnen, wie furchtbar die Rache sein muss, wenn einer es nicht mehr aushält — einer vielleicht wie Herr R., der aus dem Gewöhnlichen, dem Alltäglichen, das ihn gefangen hält, nur ausbrechen kann, indem er zum Mörder und Selbstmörder wird.
Die Stadt, die Opfer braucht, um lebendig zu erscheinen: in Frankfurt ist auch In einem Jahr mit 13 Monden entstanden. Fassbinder hat ihn nach dem Selbstmord seines Freundes Armin Meier in 25 Tagen gedreht. Fast allein ist er einem Alleingelassenen gefolgt, fünf Tage und Nächte lang, bis dieser Andere (diese Andere) nicht mehr konnte. Fast allein — Fassbinder zeichnete bei diesem Film für Regie, Buch, Kamera und Schnitt, niemals sonst hat er zugleich so viel allein gemacht. Dabei sei es ihm aber wichtig gewesen, «einen Film zu machen, der nicht simpel das überträgt, was meine Gefühle waren zu diesem Selbstmord».6
In einem Jahr mit 13 Monden erzählt vom Ende des Transsexuellen Erwin/Elvira. Der Film bleibt bei seiner Hauptfigur, er beschreibt einen Rundgang durch die Welt des Bösen (einen Rundgang, wie er mehr oder weniger deutlich auch in anderen Filmen zu sehen ist, in Faustrecht der Freiheit, in Berlin Alexanderplatz und zuletzt in Querelle).
Fassbinder in seinen Bemerkungen zum Film:
Er spielt in Frankfurt, einer Stadt, deren spezifische Struktur Biographien wie die geschilderte fast herausfordert, zumindest aber nicht als besonders ungewöhnlich erscheinen lässt. Frankfurt ist kein Ort des freundlichen Mittelmasses, der Egalisierung von Gegensätzen, nicht friedlich, nicht modisch, nett, Frankfurt ist eine Stadt, wo man an jeder Strassenecke überall und ständig den allgemeinen gesellschaftlichen Widersprüchen begegnet, zumindest, wenn man nicht gleich über sie stolpert, den Widersprüchen, an deren Verschleierung sonst allerorten recht erfolgreich gearbeitet worden ist.7
In einem Jahr mit 13 Monden hätte nicht irgendwo entstehen können. Lili Marleen jedoch ist irgendwo entstanden.
Die Leute um ihn herum
Ende der sechziger Jahre war der Junge deutsche Film, der 1962 in Oberhausen das Ende von «Papas Kino» verkündet hatte, in der Krise. Was war denn ausser Abschied von gestern seit dem Manifest von Oberhausen von denen, die damals so selbstsicher auftraten, wirklich weltbewegendes gedreht worden? Der Junge deutsche Film war nicht nur eine Randerscheinung des internationalen Kinos geblieben, eine vielerorts beachtete, aber eben eine Randerscheinung, er blieb auch in dem eigenen Land ohne grosses Echo. Von einem breiten und wirtschaftlich einigermassen abgesicherten Filmschaffen, von einer Industrie gar, keine Spur. Einer Industrie, von der sich Fassbinder «die Chance, auf normalem Weg Filmregisseur zu werden»8 erhofft hatte.
Das hiess also: noch einmal von vorne anfangen. Ich glaube, dass gerade auch dieses Nichtexistieren einer Industrie, diese Situation, dass es zwar deutsche Filme, aber keinen deutschen Film gab, Fassbinders Ehrgeiz ganz besonders angeregt hat. Sich und der Welt etwas beweisen, das war eine der Hauptaufgaben, die er sich stellte.
Kurt Raab hat Fassbinder, wie andere Mitarbeiter und Freunde auch, in einem Münchner Kleintheater kennengelernt, dem Action-Theater. Über die ersten Begegnungen schreibt er:
Da stiess zu den ziellosen Planungssitzungen, erst unregelmässig, dann tagtäglich, ein junger Mann, der sich wie selbstverständlich unter uns mengte und mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Das gefiel mir gar nicht, weil mir der nicht gefiel: mürrisch fast immer, trotzig das runde Gesicht, das bleich war und porös wirkte. Ich war also erstaunt zu erfahren, dass wir wieder ein neues Stück proben würden; und noch erstaunter, dass dieser Kerl auch noch an der Regie teilnehmen sollte.9
So hat es angefangen. Fassbinder, Schauspielschüler und Gelegenheitsarbeiter, hatte 1965 und 1966 zwei Kurzfilme, Der Stadtstreicher und Das kleine Chaos, gedreht. 1968 brachte das Action-Theater mit Katzelmacher sein erstes eigenes Stück heraus. Kurz darauf zerkrachte sich die Gruppe und einige Mitglieder, darunter Fassbinder, gründeten das Antiteater, das zum Ausgangspunkt für Fassbinders Arbeit als Filmregisseur wurde.
Das Antiteater wurde nie eine über längere Zeit hinweg funktionierende Gruppe, weil — was schwer auszumachen und im Übrigen auch gar nicht so wichtig ist — entweder Fassbinder die Gruppe brauchte, um seine Ideen umzusetzen, oder aber die Gruppe ihn, weil er Ideen hatte, in ihren Mittelpunkt schob. Dennoch wuchsen aus der Arbeit dieses Theaters Beziehungen und Freundschaften, die für das Schaffen Fassbinders bis hin zum letzten Film von grosser Bedeutung waren: Peer Raben wurde der Komponist fast aller seiner Filme, Kurt Raab verkörperte nicht nur diese bürgerlichen Figuren am Rande des Wahnsinns — Herr R., den Stationsvorstand Bollwieser — sondern besorgte lange Zeit auch die Ausstattung der Filme, Harry Baer — der junge Arbeiter Franz in Wildwechsel, der nachdenkliche Unterweltler Franz in Götter der Pest — wurde zum Assistenten, zum künstlerischen Mitarbeiter. Hanna Schuygulla wurde zum Star, Margrit Carstensen, Elisabeth Trissenaar, Barbara Sukowa und Rosel Zech zu grossen Darstellerinnen. Und dann sind da all die anderen Namen, die mehr oder weniger regelmässig in den Besetzungslisten auftauchten, unter ihnen: Klaus Löwitsch, Ulli Lommel, Ingrid Caven, Hans Hirschmüller, Günther Kaufmann, Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin und Lilo Pempeit — die Mutter. Eine möglichst kontinuierliche Zusammenarbeit suchte Fassbinder schliesslich auch bei Kamera — Dietrich Lohmann, Michael Ballhaus, Xaver Schwarzenberger — und Schnitt — Thea Eymèsz, Juliane Lorenz.
Die Leute um Fassbinder — das war eine Beschreibung, worunter sich nicht nur Insider etwas vorstellen konnten. Bis zu fünfzig Personen wird man zu diesem Kreis rechnen dürfen, dazu kamen, als die Filme dann einmal grösser wurden, zahlreiche Mitarbeiter aus Fernsehen und Film, darunter auch Prominenz, wie Oscar-Preisträger Rolf Zehetbauer, der Lili Marleen, Die Sehnsucht der Veronika Voss und Querelle ausstattete. 41 Filme wurden zwischen 1969 und 1982 unter der Regie Fassbinders für Kino oder Fernsehen produziert und vertrieben: Rainer Werner Fassbinder hat sich den «normalen Weg Filmregisseur zu werden» selber geschlagen. Um ihn herum hat sich nach und nach ein Unternehmen gebildet, das von ihm angetrieben wurde, ohne das er aber gar nicht hätte existieren können: er hat sich, auf einer ganz persönlichen Ebene und ohne die Absicht, sich auf Kosten anderer zu bereichern, sondern einzig mit dem Ziel, das Leben zum Film zu machen, eine Industrie aufgebaut. Das ist in dieser Form, soviel ich weiss, einmalig in der Geschichte des Films.
Es gab solche um ihn herum, die wollten aussteigen. Andere sind auch — wenigstens vorübergehend — ausgestiegen. Hanna Schygulla, weil sie nach Effie Bliest glaubte, leblos geworden zu sein. Aber sie kam wieder und Fassbinder hat sie — was kein anderer gekonnt hätte — zu einer Leinwandgöttin gemacht, wie man sie aus dem alten Hollywood kennt: unerreichbar und gleichzeitig doch auch erregend nahe!
Noch andere zerstritten sich mit dem Regisseur. Kurt Raab etwa. In dem schon zitierten Aufsatz «Fassbinders Faszination» hat er sein Verhältnis zu ihm mit grosser Offenheit beschrieben. Raab schreibt:
Anfänglich war mir sein plötzlicher Aufstieg in ungeahnte Höhen etwas unheimlich . . . Aber nach und nach gefiel es mir schon, beruflich einer seiner engsten Mitarbeiter und privat einer seiner besten Freunde zu sein. Andere persönliche Beziehungen waren nicht mehr wichtig; andere berufliche Interessen verblassten mehr und mehr.
Doch eines Tages erklärte ihm Fassbinder, dass er sein Gesicht und seine Stimme nicht mehr ertragen könne:
Unschlüssigkeit, Verzweiflung, Unfähigkeit kam da über einen, man wusste nichts Rechtes mehr mit sich anzufangen, man schlich sich weg und versteckte sich.10
Denen, die mit ihm zusammenarbeiteten, hat es Fassbinder sicher nicht einfach gemacht. Ohne ihn gegenüber denen, die besser wissen, wie es mit ihm war, die seine Launenhaftigkeit kannten, in Schutz nehmen zu wollen, glaube ich doch, dass sich einer, der eigentlich fast rund um die Uhr und während Jahren etwas versucht, von dem niemand weiss, ob es möglich und wie lange möglich ist, eine gewisse Rücksichtslosigkeit selbst gegenüber den Nächsten aneignen muss. Das Leben als Film, der Film als eine Art Befreiungskampf gegen sich selber und die Umwelt: dazu gehört ein Hauch von Wahnsinn und die Bereitschaft, notfalls allein, entsetzlich allein zu sein.
Die Reise ins Tessin
Einen älteren Freund hat Fassbinder in Douglas Sirk gefunden — einen Freund, keinen Vater, Sirk würde eine solche Rolle entschieden ablehnen. Fassbinder ist, wie später so viele, anfangs der siebziger Jahre zu Sirk ins Tessin gereist, nachdem er einige seiner amerikanischen Filme gesehen hatte. Das Antiteater hatte gerade Warnung vor einer heiligen Nutte gedreht, ein Werk bitterer Selbstbezichtigung. Die Gruppe war in der Krise: ein gescheitertes Kollektiv, das sich ein paar Jahre lang radikal ausgekotzt hatte.
1971 drehte Fassbinder Der Händler der vier Jahreszeiten. Darin erzählt er von Hans Epp, der wegen seiner bösen Mutter in die Fremdenlegion gegangen ist und nach seiner Rückkehr Polizist wurde, dort aber bald wieder hinausgeschmissen wurde, weil er sich von einem leichten Mädchen hat verführen lassen, und der jetzt als Obsthändler mit einem Karren durch die Hinterhöfe hässlicher Mietskasernen zieht. Die Frau, die er wollte, hat er nicht bekommen, und die Frau, die er hat, liebt ihn nicht. Hans trinkt, schlägt seine Frau und bricht zusammen, weil sie sich von ihm scheiden lassen will. Den Hilfsarbeiter, den er einstellen muss, weil er selber nicht mehr recht mag, war, als er sich im Spital von seinem Zusammenbruch erholte, einmal mit seiner Frau zusammen gewesen. Ein anderer, den er später einstellt, ein Bekannter aus der Fremdenlegion, nimmt mehr und mehr seinen Platz ein. Hans verstummt, ein langer Abschied von der Welt, in der es ihn nicht braucht, wo er allem und jedem nur im Wege steht, führt ihn zu seiner Familie und danach in die Wirtschaft. Dort säuft er sich zu Tode.
In keinem anderen Film zuvor, und auch nachher in fast keinem mehr, hat sich Fassbinder mit solcher Vehemenz hinter die Hauptfigur gestellt wie hier hinter den von Hans Hirschmüller dargestellten Obsthändler, diesen, wie ihn der Volksmund nennen würde, «armen Kerl, der dem Teufel vom Karren gefallen ist». Das ist ein tragischer Held, dem unsere ganze Sympathie zu gelten hat — daran gibt’s nichts zu rütteln.
Sirk habe ihm Mut gemacht, publikumswirksame Filme zu drehen, hat Fassbinder erklärt. Sirk hat ihm aber auch Mut gemacht, bedingungslos zu seinen Figuren zu stehen, selbst dann, wenn diese konsequent das Falsche machen und sich einem System unterwerfen, das sie zerstört. Zu den Figuren und zu den Gefühlen, denen sie nicht Meister werden können. Kein Verrat durch feige Distanzierung: Verzweiflung ist Verzweiflung. Und die Verzweiflung der Figuren ist auch die eigene Verzweiflung, mit dem Unterschied, dass die Figuren — meistens endgültig — scheitern, während der Regisseur sich noch einmal — einmal mehr — freifilmt. Sirk musste dabei gezwungenermassen zurückhaltend vorgehen, zum einen durfte er den amerikanischen Standpunkt nicht verletzen und zum anderen mussten seine Filme in den Kinos der Welt Aufsehen erregen. Da hatten auch die Gefühle Schleier zu tragen.
Bei Fassbinder aber sind sie nackt, schutzlos. Obschon Fassbinder diese Nacktheit in anderen Filmen — In einem Jahr mit 13 Monden, Berlin Alexanderplatz und zuletzt Querelle — extremer dargestellt hat, traf sie mich niemals mehr als beim Obsthändler Hans Epp in Der Händler der vier Jahreszeiten. Dieses exakte Kleinbürgerdrama, das mich direkt doch eigentlich gar nichts angeht, verwirrte und verunsicherte mich. Ich kam mir so furchtbar hilflos vor. Was hätte ich denn dem «armen Kerl» raten können? Hätte ich ihn anstiften sollen zum Widerstand, zum Aufstand gegen seine Umwelt, wo ich doch genau weiss, dass er damit seine Unschuld verloren hätte? Nein, ich musste mir selber zugeben, dass es in dieser Welt für den um sein bisschen Glück geprellten Hans keinen anderen Weg als die Verweigerung — den Selbstmord — gegeben hat. Dem Pessimismus dieses Films hatte ich nichts entgegenzusetzen.
Der Händler der vier Jahreszeiten ist ein mutiger Film gerade deswegen, weil sein Held nicht gerettet wird. Der Bewusstseinsprozess, der in anderen Filmen vielleicht dazu führen würde, dass der Held etwas tut, was für ihn aussergewöhnlich ist, führt hier zu der brutalen Einsicht, dass alles sinnlos ist. Fassbinder:
Wenn ein Film traurig, böse, oder was auch immer, aufhört, muss ihnen (den Zuschauern) doch klarwerden, es muss irgendetwas anderes geben. Nur über die Sehnsucht jedes einzelnen nach etwas anderem kann etwas anderes entstehen.11
Der Händler der vier Jahreszeiten, der Film nach Fassbinders Reise ins Tessin, wurde für das weitere Schaffen des Regisseurs zu einem Muster. Viele der folgenden Filme erzählen — nicht immer so gradlinig — ähnliche Leidensgeschichten: Die bitteren Tränen der Petra von Kant, Martha, Faustrecht der Freiheit, Die Sehnsucht der Veronika Voss.
Innenräume
Die Schlussbilder in den Filmen Fassbinders zeigen Tote, Kranke, Invalide, Müde oder Mörder. Fassbinder erzählt Geschichten, die tragisch enden. Es gibt bei ihm schon auch Figuren, die sich zu erheben versuchen, die sich — furchtbar ungeschickt zwar — wehren gegen die Ausbeutung. Der Maurer Peter in Ich will doch nur, dass ihr mich liebt zum Beispiel. Er erschlägt einen Wirt, der ihn an seinen Vater erinnert, an den Menschen, vor dem er erfolglos zu glänzen versuchte. Und es gibt Figuren, die sich mit Gleichgesinnten zusammentun, die Putzfrau Emmi Kurowski und der Fremdarbeiter Ali in Angst essen Seele auf. Und Figuren, die sich, der Not gehorchend, mit allen möglichen Mitteln durchschlagen, kaltblütig und mit gebrochenem Herz: eine junge Frau im zertrümmerten Deutschland, die sich mit List, Stärke und der Sehnsucht nach einem Mann den Traum vom Glück zu verwirklichen versucht, Die Ehe der Maria Braun. Nur die niedliche Lola, die, wenn sie in Schuss kommt, so aufregend ist, darf überleben, ihr erfüllt sich der kleinbürgerliche Traum. Die Kleinstadt-Hure wird zur Gesellschaftsdame, während Fredy Quinn vom weissen Schiff nach Hongkong singt und der erste Fernsehapparat in die Stube gestellt wird. Bei dem Glück, das Lola findet, braucht es keine Katastrophe, um zu unterstreichen, wie jemand sich selber aufgibt. Lola, Fassbinders drittletzter Film, hat ein falsches Happy-End wie die Filme von Sirk. Lola ist ein unerhört deprimierender Film, weil wir wissen, was nach der Zeit gekommen ist, in der er handelt.
Was mit ihnen auch passiert — die Figuren Fassbinders sind schon vom ersten Bild an Verlorene. Sie haben keine Chance. Es wäre wohl kaum auszuhalten, wenn man sich seine Filme alle hintereinander ansehen müsste. Andererseits würde dabei auffallen, wie sie mit der Zeit düsterer wurden, wie das Böse mehr und mehr als etwas Endgültiges dargestellt wurde. Wenn ich an die paar letzten Werke denke, fallen mir Bilder ein von Räumen ohne klare Konturen, von Menschen, die von wenigen Lichtstrahlen gestreift werden, Bilder von bedrohender Dunkelheit, Bilder der Angst.
Fassbinder, so scheint es, hat sich allmählich zurückgezogen, er hat die auf die Umwelt gerichtete Kamera umgedreht gegen sich selber: die Wahrheit oder ich schiesse. Der Film wurde — er hat es selber gesagt — zur Therapie. So beobachten wir in einigen der letzten Werke, besonders in der Fernseh-Serie Berlin Alexanderplatz und in Querelle, wie einer, nachdem er alle Hemmungen abgelegt hat, sich selber erforscht und befragt.
Fassbinder zu Querelle:
Es ist überaus aufregend und spannend, erst langsam, dann aber immer dringender und dringender, herauszufinden, wie diese fremde Welt mit ihren eigenen Gesetzen sich zu unserer, freilich auch subjektiv empfundenen, Wirklichkeit verhält, dieser Wirklichkeit erstaunliche Wahrheiten abringt, weil sie uns zu Erkenntnissen und Entscheidungen zwingt, die, und ich bin mir des Pathos voll bewusst, so schmerzhaft diese Erkenntnisse im Einzelnen auch erscheinen mögen, uns unser Leben näherbringen. Das heisst auch: wir nähern uns unserer Identität! Und nur wer wirklich mit sich identisch ist, braucht keine Angst vor der Angst mehr zu haben. Und nur wer keine Angst hat, kann wertfrei lieben; das äussere Ziel aller menschlichen Anstrengung: sein Leben leben!12
Der Rückzug oder anders: das Eindringen Fassbinders in sich selbst verbildlichte auch die Studioarbeit. Da wurden Orte nicht mehr gesucht und gefunden, sondern gebaut, da war das Licht, das die Leidenden streift, kein Sonnenlicht, da wurde eine künstliche Welt aufgebaut, eine ausgedachte Welt: Innenräume.
Zu neuen Ufern
Verlockend zu sagen: wie gut doch Querelle an den Lebens-schluss dieses Ruhelosen passt, ans Ende seines Lebensfilms. Der letzte Akt eines erbarmungslosen Befreiungskampfes, eines Krieges gegen die eigene Seele? Ich glaube nicht. Denn es gibt ja in dem Film nicht nur diesen abscheulichen Ausverkauf, diese schändliche Zerstörung aller Menschlichkeit, sondern auch und ganz besonders die Verherrlichung eines schönen, kräftigen Mannes, einer (möglichen) männlichen Traumfigur. Brad Davis hat durch seine Darstellung des Matrosen Querelle de Brest eine Figur geschaffen, deren Faszination man sich kaum entziehen kann. Diese Wechselbäder der Gefühle: einmal ist er der Naive, das Kind, das Schutz sucht, dann die Bestie, die kaltblütig mordet, und schliesslich der Liebende, der höchste Lust empfindet.
Querelle ist ein Mörder, er ist zu allem fähig. Er ist sogar fähig, zur Liebe zu finden. Keine andere Figur Fassbinders ist so weit gekommen. Querelle kann nicht das Ende sein, weil sich in dem Film und durch den Film neue Ufer eröffnen. Etwas anderes lässt sich erahnen, etwas, das Hoffnung macht.