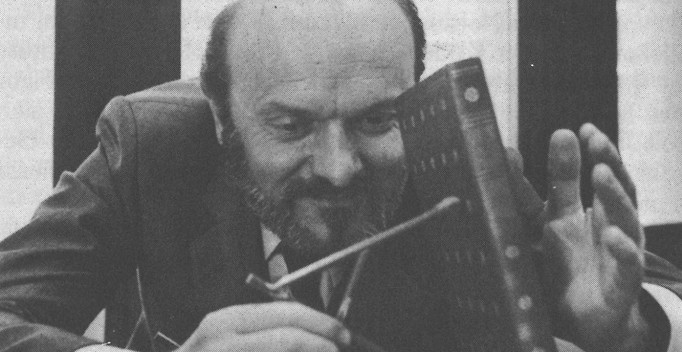«Hier spürt man die Heimat: ein Draht ums ganze Land herum, ein einziger Nationalpark. So tritt keiner (von draussen) ein um das gute Gras zu essen und uns die gute Luft wegzunehmen.»
Einem Durchschnittstessiner fällt es nicht allzu schwer, sich mit Geschichte und Person Alfredo Bossis zu identifizieren. Unter einem «Durchschnittstessiner» verstehe ich einen Menschen, der nach der obligatorischen Schulzeit aus der engen und immer peripheren Geographie des Kantons Tessin gerissen wird, einen, der Ende der 50er und während der 60er Jahre dazu beigetragen hat, einen Teppich von Ballungszentren, von Vororten und Städten zu weben, die sich noch heute leicht an einer Hand abzählen lassen. Städtische Zentren, die denjenigen der übrigen Schweiz immer ähnlicher werden, die ebenfalls unter der Unverhältnismässigkeit der Mittel aufgrund der Aufstockung durch massive Zuwanderung leiden. Aber da diese Immigration vorwiegend aus Italien kommt, ist dies im Tessin ein Grund, oder sollte es wenigstens sein, zur Identifizierung mit der italienischen Kultur. Eine Lebensweise, ein Lebensmodell, das hier und dort kleine, aber dauerhafte Risse aufweist.
Eine ihrer Folgeerscheinungen ist das zwanghafte Ritual der Suche nach den eigenen Wurzeln, die oft bei der simplistischen Ausübung einer heruntergekommenen Folklore endet, vollgepfropft mit Schundware, unverdaulicher Gastronomie, grauenhafter Liederseligkeit, Festhüttendarbietungen und wehleidiger Literatur. Und all dies eingetaucht in ein Klima der falschen oder gar nicht existierenden Wiederbelebung. Eine Rekonstruktion der Vergangenheit also, die bloss eine schlimme Erfindung unter dem Druck der «transalpinen Gäste» ist, die ihrerseits dem Kanton längst dieses eklige, aber dennoch nie energisch genug zurückgewiesene Etikett «Sonnenstube» verpasst haben. Diese oberflächliche Folklore, dieser fatale Gütestempel haben die Tradition entleert, haben viele Zweige absterben lassen. Ein endgültiger und selbst mit-hilfe der sachlichsten Vergangenheitseinschätzung nichtmehr rückgängig zu machender Schnitt: Die Folklore stellt sich unüberwindbar zwischen die urbane Realität und die dörfliche Zivilisation, die noch am Ende der 50er Jahre - im Guten wie im Schlechten - mit jener von Ermanno Olmis L’albero degli zoccoli vergleichbar war.
Ein weiteres Ritual, das einer unaufhörlichen Landschafts-verschandelung, dem willkürlichen Städtewachstum und der Bodenspekulation entgegengesetzt wird, ein weiterer Versuch, sich seiner Wurzeln und Identität zu versichern, ist die freitagabendliche Rückkehr ins Heimatdorf: Ein Weg von nur wenigen Kilometern, heute allerdings im Stau der Gotthard-autobahn ein Alptraum.
Was bringt dieser allwöchentliche Rückzug in die «heile Welt»? Die Modernisierung von Haus und Stall (man nennt dies heute «Restaurierung», wenngleich die Spuren der Vergangenheit ausradiert und verwischt werden). Die Begegnung mit Personen, die der Kindheit noch so viel Halt gegeben hatten. Den Blick aus der Ferne auf eine sich verändernde Welt, in der Illusion, man sei von dem fieberhaften Wandel noch nicht angesteckt. Kurz, die Einigelung in einen Bunker von mit Draht zusammengehaltenen, grünen und reinen Träumen. Das ist das wenige, was einem noch wirklich gehört. Ein realer Raum (warum nicht?), der jedoch bereits bedroht ist durch den Nachbarn mit dem unverwechselbaren schweizerdeutschen Akzent, welcher sich am Samstagmorgen in seinem Gärtchen ebenfalls den Tröstungen des Chlorophylls hingibt.
Das also ist unser Durchschnittstessiner: ein Mensch, der mit der gewaltsamen Trennung von Stadt und Land, von Gegenwart und Vergangenheit sowie allen Folgeerscheinungen der Entfremdung zu Rande kommen muss. Zum Beispiel mit der «ticinesità», die uns auszeichnen soll. Oder mit dem noch viel schwierigeren Verhältnis zu Italien. Ich verstehe «ticinesità» nicht so sehr als ideologischen Begriff, sondern als realen, entscheidenden Begriff, der einen sehr schwierigen Diskurs über die Lebensweise nach sich zieht: die Definition nämlich von «Vaterland», das heisst die Schweiz, und »Muttererde», das heisst das Tessin.
Heute wird zweifelsohne der Grossteil dieser Auseinandersetzung vom Vaterland bestimmt: die wichtigsten Weisungen empfangen wir aus dem Norden, wo die nationale Identität definiert wird. Der herablassende Protektionismus gegenüber der führenden lokalen Schicht und gegenüber einer ethnischen und sprachlichen Minderheit ganz allgemein hat wenigstens teilweise in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts die Differenzen zwischen Nord und Süd, zwischen «hochentwickelter» und «unterentwickelter» Schweiz scheinbar aufgehoben. Zum Nachteil der Tessiner, versteht sich: Dr. Athos Eberle, der junge, aufstrebende Manager aus der Deutschschweiz, ist das Produkt einer staatlichen «Kaderausbildungsstätte», der Handelshochschule St. Gallen (einer idealen Brutstätte übrigens auch für angehende Tessiner Führungskräfte!), und er stiehlt Alfredo Bossi, der sich von unten heraufgearbeitet hat, einem zwischen Stadt und Dorf verlorenen Tessiner, die Stelle. Das zeigt deutlich die Grenzen der Autonomie, deren sich die «ticinesità» zur Zeit erfreut.
Und wie steht es mit der «Muttererde»? Hier wird eine Auseinandersetzung schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Noch in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts schrieben einige zur transatlantischen Auswanderung gezwungene Tessiner über die Schweiz nicht wie über ihr Heimatland, sondern wie über irgendeine Nation Europas. Sie verkannten oder durchtrennten das Band, das 1803 geknüpft wurde, das allerdings heute äusserst dünn geworden und beileibe aus Draht nicht mehr ist. Den Geist der Frühe galt und gilt es aufzuspüren oder zu entdecken (etwa anhand des Hauptwerkes eines frühen radikalen, Stefano Franscini).
Die vielschichtigen, jahrhundertealten Verknüpfungen mit Italien, vor allem mit den Nachbarregionen Lombardei und Piemont, waren mindestens bis zur Zeit des Risorgimento sehr stark. Heute symbolisieren sie mehr ein historisches Erbe - sie sind kein Kulturgut, das es um jeden Preis zu erhalten und zu pflegen gilt. Unsere Drahtumzäunung einerseits, die grossen Einwanderungswellen, die Unsicherheit angesichts der politischen und sozialen Entwicklung Italiens andererseits haben in den letzten Jahrzehnten einen eigentlichen Graben des Unverständnisses, ja der Feindseligkeit geschaffen. Die einzig gute Sache, die durch die Maschen des Drahtgitters schlüpft, ist das Geld. Aber im allgemeinen sind die Italiener - die Saisonarbeiter und Grenzgänger - Randfiguren wie in der übrigen Schweiz auch, sind zufällig in das soziale Gefüge eingetreten. Auch sie sind «matlosa».
Diese Anmerkungen, dieser kleine Beschwerdenkatalog, den man zum Beispiel ohne weiteres auf den politischen Bereich ausdehnen könnte, muss unvollständig bleiben. Im Tessin gibt es keine Kulturpolitik, und wenn, liegt sie bei den Schulen mit den nur zu bekannten Folgen. Wenn sie aber von Politikern an die Hand genommen wird, erhält sie den Charakter einer emphatischen, sich im Kreis drehenden Feier. Man schüttelt am Baum der Geschichte, damit ein paar reife Äpfel herunterfallen, ein paar Namen von einer Aura umgeben, die ihnen meist gar nicht zusteht.
Villi Hermanns Angestellter Alfredo Bossi, Freizeit-Maurer, verhinderter Bauer und Matlosa; eine versteckt gehaltene Frau; die Kinder gefangen in den kleinen Piraten-Mythen einer Konsumgesellschaft, die sich bereits überlebt hat; die Häuser; die Geräte; die Landschaft; die Sprache (ein weites Feld) - sie alle sind Partikel, Fragmente, Überreste einer in der Struktur des Tessins der achtziger Jahre äusserst prekär gewordenen Identität. Es ist ein Tessin, das vor einem neuen Andrang von Touristen auf der Suche nach einem zweiten Wohnsitz steht, vor dem Ausverkauf der letzten Grundstücke, in einer klaren, unleugbaren wirtschaftlichen Abhängigkeit... Ein Reservat, das, um endlich aufzuwachen, so viele kleine Gesten der Auflehnung wie diejenige des Matlosa Alfredo Bossi brauchte.
Federico Jolli
PS. Zu unserem Identitätsproblem verweise ich auf einige Materialien, die in Block Notes, Nummer 2 und 3, Bellizona 1980, erschienen sind; sowie auf die Bücher von Plinio Martini und Giovanni Orelli.
Matlosa, ausgesprochen in vielen dialektalen Tönungen, z. B. maschlösa; vom deutschen «heimatlos»: Hausierer, Bürstenbinder, Fecker, Schirmflicker, Korber, Scherenschleifer, Gaukler, Vagabund, Fahrender, Streuner. Überdies: ohne Haus, ohne Heimat, ohne ständigen Wohnsitz. Im übertragenen Sinne: alle Randfiguren.
Marco, der Lehrer in Alain Tanners «Jonas», ruft einmal aus: «Wir sind alle Grenzgänger». Der frontalier, der matlosa, der Aussteiger und «Landesverräter» ist die beständigste Figur im neuen Schweizer Film. Charles De wird einer (Charles mort ou vif?), William war schon immer einer (La lune avec les dents), Georges Plond wird zu einem gemacht (Le fou); die Deutschschweizer haben in Zärtlichkeit und Zorn die matlosa aller Schattierungen dargestellt, vom Künstler bis zum Landesverräter, vom Invaliden bis zum Spanienkämpfer. Und auch in den Spielfilmen der Autoren aus der Deutschschweiz stehen sie im Mittelpunkt, von Peter von Guntens Netschajew bis zum Korber und zum Schirmflicker in Xavier Kollers «Das gefrorene Herz». Man muss es wohl nicht mehr weit und breit ausführen: In der Figur des Marginalen, des Fahrenden, des Out Cast drückt sich seit Jahren die Sehnsucht der Disziplinierten aus. Die Geschichte des neuen Schweizer Films liesse sich von dieser Thematik her fast lückenlos schreiben.
Das selbe trifft auch auf das bisherige Werk von Villi Hermann zu: In 24 su 24 (1970) geht es um Schmuggler und Grenzwächter; in Cerchiamo per subito operai, offri-amo ... (1974) stehen Grenzgänger (frontalieri) im Mittelpunkt; San Gottardo (1977) rekonstruiert die Emigration des 19. und dokumentiert die Emigration des 20. Jahrhunderts, matlosa sind die Helden, und die Sesshaften werden mit höchstem Verdacht entlassen; Es ist kalt in Brandenburg (1980) schliesslich folgt den Wegen eines Mannes, der nur noch brieflich mit seiner Heimat verkehrt, und den die Heimat schmählich im Stich lässt, weil sie für diese Art Bürger, wie Maurice Bavaud einer war, nichts übrig hat.
Der qualitative Sprung von San Gottardo und Es ist kalt in Brandenburg zu I Matlosa ist jener von der Dokumentation und Rekonstruktion in die Fiktion. Die eigene Biographie - Hermann ist in Luzern geboren, hat in London studiert, in Zürich gearbeitet -, eine Novelle von Giovanni Orelli und die Kenntnis vieler kleiner Geschichten von Tessiner Emigranten, Bauern, Pendlern (zwischen Dorf und Stadt) sind zusammengeflossen in eine Story und in eine Figur (Alfredo Bossi), die mehr zu transportieren haben als eine traditionelle realistische Erzählung, ein fait divers: das Sinnbild nämlich einer gefährdeten, ja ausgelöschten Identität. Villi Hermanns Alfredo ist gedacht als Symbolfigur. Es mussten filmische Mittel gefunden werden, um ihn immer auf jener zweiten Ebene sich bewegen zu lassen, wo die Ereignisse und abgebildeten Gegenstände Zeichen sind. Das Anekdotische durfte nie Überhand nehmen. Die Rede sollte schliesslich nicht von einer einzelnen Erfahrung sein, von einem unerhörten Ereignis, sondern von einem verborgenen Sinn.
Die erste Einstellung - eine Aufsicht auf ein Pult, zwei (noch unbekannte) Hände, ein Federmesser, ein Bleistift, eine Tabakdose und die Streichhölzer mit einem touristischen Tessin-Motiv als Dekoration - gibt den Ton bereits an. Da wird ein konkreter Vorgang abgebildet - jemand schnitzt (in zerstörerischer Weise? Jedenfalls in einer ungewohnten) an einem Bleistift herum -, und da liegt noch anderes Zeichenhaftes herum. Darüber liegt - im Off - eine formelhafte Sentenz, (wiedergegeben an der Spitze von F. Jollis Aufsatz). Eine «unrealistische» Musik betont im nachhinein die Zeichenhaftigkeit des Arrangements, wenn nun die Titel folgen, auf sepia getönten Schwarzweissfotografien eines fahrenden Händlers, die sich später als Ur- und Leitbild, als schmerzliche Erinnerung, als Hintergrund, als Traum herausstellen werden.
Was ich sagen wollte: I Matlosa ist in keinem Fall ein Film, der da die berühmt-berüchtigte Scheibe vom Leben herunterschneiden soll. Sonst hätte er einen anderen Anfang.
Woran es liegt, dass der Film trotz seiner Einleitung in der ersten Sequenz seiner Gegenwartshandlung vorübergehend an Höhe verliert, ist schwer auszumachen. Der Aufbruch der Familie Bossi aus Bellinzona ins Weekend, dahin, wo «die Luft noch rein und das Gras noch gut» ist, scheint mir der schwächste Teil von I Matlosa zu sein. Plötzlich gerät der Film in ein naturalistisches Wellental. Man schaut einer Familie, die man nicht kennt, zu, und man verpasst die wenigen Zeichen, die weiter deuten als auf den Begriff «Abfahrt»; man sieht die Anschriften in der Tiefgarage nicht, wundert sich über die Maske, die sich der Sohn übergezogen hat. Und die Kamerafahrt hinter dem Auto her, das die Familie Bossi ins paese kutschiert, gewinnt auch nicht jenen Grad von Stilisierung, der nötig wäre, damit sich der Zuschauer auf anderes gefasst macht als auf Alltäglichkeiten. Die Ebene (jene oben erwähnte zweite) wird erst wieder erreicht, wenn der Wagen nicht ins Dorf fahren kann, wo gerade eine vorfabrizierte Garage ausgeladen wird («auch zu mauern verstehen die offenbar nicht mehr»), beim Anblick der nahen Staumauer und der im Wasser versunkenen alten Steinhäuser. Die erste Rückblende - der Knabe Alfredo mit einem bunten Ball in einer steilen Bergwiese - stellt wieder her, was am Anfang ganz klar und einfach gegeben worden ist. Von nun an ist der Zuschauer wieder mit den Augen auf sichtbaren Erscheinungen und mit dem Sinn im Unsichtbaren einer problematischen Existenz, der Existenz des Angestellten Alfredo und der Existenz eines zerstörten und kolonisierten Lebensraums, des Tessins.
Die Gegenwart des Films - Alfredo bei einem morgendlichen Spaziergang in den monti, Alfredo ein Mäuerchen bauend vor dem Haus, die Mahlzeiten der Familie, die Heimfahrt im dichten Verkehr, der Arbeitsalltag Alfredos, der Familie -, diese Gegenwart wird und bleibt bis fast bis zum Schluss der Grund, von dem die Hauptfigur abstösst: in die Erinnerungen, in Träume; sie ist Stichwortgeber für Expeditionen in die verschüttete Identität der Hauptfigur.
Hermann hat diese Gegenwart reduziert auf ganz wenige Zeichen; ein demagogischer Autor hätte sie gehäuft. Die Widersprüche dieser Gegenwart scheinen auf in den einfachsten Bildarrangements: in der Einrichtung von Alfredos Elternhaus, das jetzt zum Zufluchtsort geworden ist, in der Dengelmaschine eines alten Dorfbewohners, den Erinnerungsstücken des Onkels, einem Migros-Verkaufswagen, im kleinen Zementmischer, den sich der Städter angeschafft hat für ein paar kleine Maurerarbeiten; in der Kleidung (Verkleidung) des Angestellten Alfredo, in seinem Aktenköfferchen, der Steckkarte, die Türen öffnet usf.
Drei Erscheinungen aber verbinden beide Zeit- und Bedeutungsebenen des Films: der hölzerne Schubladenkasten mit den Glasmurmeln, die Vogelfalle, die Alfredo mit Bleistiften und einem Buch nach einer Kindheitserinnerung wieder zu bauen versucht, der Kaffee schliesslich, den sich Alfredo fast rituell mit einem Schluck Wein «verlängert».
Der Kasten und die Vogelfalle gehören - in der Vergangenheit - zu der rätselhaften Figur des Matlosa, des fahrenden Händlers, zu dem der junge vaterlose Alfredo eine Art Sohn-Vater-Beziehung aufgebaut hat, zu jener Figur, der die Sehnsucht des wohlbestallten, aber haltlosen Alfredo gilt. Den Kasten hat der Fahrende damals zurückgelassen im Dorf, als er von Soldaten und Zöllnern über die Grenze zurückgestellt wurde; die Vogelfalle hat er dem jungen Alfredo draussen im Kastanienwald einmal vorgeführt.
Alfredo findet irgendwie zurück; er versucht, die Erinnerungen und die Gegenwart wieder zusammenzubekommen. Er muss ein matlosa werden, muss sich an die Ränder zurückbegeben, von denen er herkommt. Das letzte, das poetischste Bild des ganzen Films, hat gleichzeitig etwas Tröstendes und etwas Trauriges an sich: Alfredo Bossi im Strassenanzug, mit dem Kasten des matlosa auf dem Buckel auf einem belebten Platz in der Stadt; von der Kamera weg läuft er, den Satz rufend, den er aus seinen Erinnerungen heraufgeholt hat: «Policarpo Sperandio che porta la cassetta sul dedrio»; wenn er über den Platz in die Gasse verschwindet, schwenkt die Kamera aufwärts mit, zeigt die engen Gassen, die Dächer der Stadt und schliesslich, wenn sich die Stimme Alfredos in der Tiefe des Bildes verliert, kommen die Dörfer an den Berghängen ins Bild, die monti, der Himmel.
Ich denke, dass in diesem Schlussbild sich das Konzept von Villi Hermanns Film am besten artikuliert.
I Matlosa hat einige Momente, hat ganze Passagen von dieser eigenartigen - und im Schweizer Film doch ziemlich neuen - Poesie. Dass der Film zwischen diesen Momenten und Passagen auch zuweilen in die Alltagsprosa - Fernsehfilm - zurückfällt, kann nicht bestritten werden. Aber als Gesamterinnerung bleibt trotzdem ein Film stehen, der mit sichtbaren Elementen vom Unsichtbaren spricht, von der Zerstörung der Seele, um es einmal so zu sagen, und von einer versuchten Wiedergewinnung. Dass ein Geschmack -der Geschmack von mit Wein «verlängertem» Kaffee - im Angelpunkt steht (ein Proustsches Motiv!), sagt viel über das, was Villi Hermann versucht.
Martin Schaub