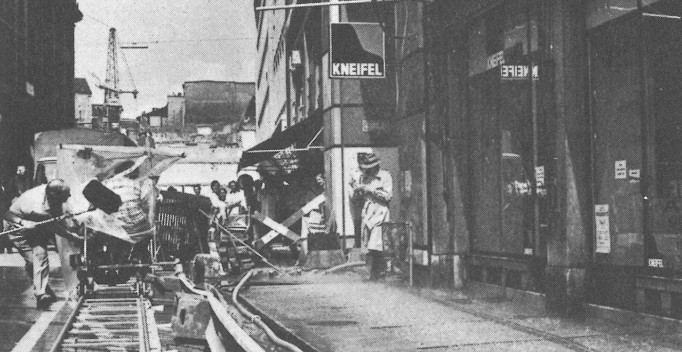Martin Schaub: Martin Schlappner, Sie haben jetzt während anderthalb Jahrzehnten alle Filme, die nennbar sind, in der Schweiz gesehen, ist das immer noch gleich interessant wie vor fünf, sechs Jahren, oder haben Sie sich schon gewöhnt an diese Art von Filmen, wie sie in der Schweiz produziert werden, und hat sich vielleicht schlimmstenfalls sogar die Langeweile eingestellt?
Martin Schlappner: Die Frage ist schwierig zu beantworten. Wenn man, wie ich, mehr als dreissig Jahre Filmkritiken schreibt, dann stellt sich eine Gewöhnung an den Film ein, die in einem gewissen Masse gefährlich wird, weil sie einen Teil der Empfänglichkeit, der Sensibilität, nicht unbedingt für das Neue, aber für Erlebnisse oder für das, was man auch Betroffenheit nennt, abbaut. Die Frage ist dann nur, wo diese Empfänglichkeit sich wiedereinstellt.
Das muss nicht unbedingt beim professionell gemachten Kinospielfilm sein, ganz sicher nicht, das kann beim - ich weiss nicht, ob man das Wort gebrauchen kann - dilettantisch gemachten Film sein, wobei ich dilettantisch nicht als abwertend gebrauchen möchte, sondern mehr im Sinne von Georges Duhamel, der in den dreissiger Jahren das leider heute völlig vergessene Buch La querelle du cinéma geschrieben hat, wo er dem Dilettantismus das Wort redete, das heisst nicht denen, die in den grossen Ateliers arbeiten, sondern denen, die daneben, als Aussenseiter arbeiten und neue Visionen, neues Sehen, neue Bildmöglichkeiten erobern.
Es gibt Filme, die professionell gemacht sind, oder in einer Produktion gemacht sind, die Professionalität, wirtschaftliche, ökonomische Infrastruktur haben. Filme, die immer wieder ansprechen, bewegen. Und es gibt auch Filme, die von ausserhalb kommen, vom Nachwuchs, von neuen Leuten.
Eine gewisse Abgegriffenheit der Stoffe, der Themen, der Motivationen, der Haltungen und Tendenzen ist sicher feststellbar, und da kämen wir dann vielleicht auf das, was Sie als die kreative Krise bezeichnen. Ich sehe sie aber nicht unbedingt, um es etwas polemischer zu sagen, bei jenen Leuten, die auch für das Fernsehen arbeiten, sondern ich sehe sie gerade bei der älteren Generation, zum Beispiel bei Alain Tanner. Dann gibt es, weniger im Spielfilm- als im Dokumentarfilmbereich, Leute, die Neues vom Stoff her, von der Machart, vom formalen oder vom technischen Experiment herbringen. Ich identifiziere mich nicht mit jedem dieser Filme, aber ich denke, Kollegen von Urs Graf ist einer der interessanteren Filme gewesen von der Art her, wie das Video einbezogen, integriert und dramaturgisch genutzt wurde. Von Interesse war auch der Schwangerschaftsabbruchfiim Lieber Herr Doktor, weil er, ohne blosse Agitation zu bringen, politisch, dialektisch und didaktisch gestaltet worden ist, damit er einsetzbar wird in der politischen Diskussion. Ich erwähne jetzt nur diese Beispiele, um zu sagen, dass es Neuerungen noch immer gibt. Wie zahlreich sie sind, das wird man nur im historischen Rückblick abschätzen können.
Bernhard Giger: Ich bin zwar nicht dreissig Jahre im Film tätig, sondern, als aktiver Filmkritiker, erst etwa seit sieben Jahren. Aber ich bin mit ganz bestimmten Erwartungen in diese Schweizer Filmszene eingetreten und stelle nun fest, dass diese Erwartungen für mich nicht mehr erfüllt werden. Ich habe mich auch genau gefragt, warum es so weit gekommen ist. Die Antwort gaben mir zum Teil Leute, die nicht im Film arbeiten, sondern einfach ab und zu ins Kino gehen.
Ich würde behaupten, dass heute, vor allem im Spielfilm, sehr viel gedreht wird, was mit den Leuten, die es machen und mit den Leuten, die es sich dann im Kino anschauen - das sind vor allem Junge - sehr wenig zu tun hat. Ich vermisse die Filme, die wirklich gemacht werden müssen. Um das klar zu sagen: Ich frage mich, ob Kurt Gloor mit einem alten Mann wie dem Schuhmacher Steiner wirklich etwas zu tun hat, und ich frage mich, ob Peter von Gunten mit minderjährigen Drogenabhängigen wirklich etwas zu tun hat, oder ob die beiden nicht einfach Probleme verfilmt haben, die in der öffentlichen Diskussion sind.
Friedrich Kappeler: Ich möchte das nicht einfach mit einzelnen Namen behalten. Und ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl von einer kreativen Lähmung, hingegen finde ich die Situation verstörend, wenn man bedenkt, welche Filme in der Deutschschweiz im letzten Jahr Erfolg hatten. Ich denke da an Die Schweizermacher, an Das gefrorene Herz von Xavier Koller und an Wilfried Bolligers Landvogt von Greifensee. Das sind tatsächlich Filme, wo wir uns einerseits fragen müssen, was gehen die uns an, die aber andererseits erfolgreich waren. Für mich stimmt’s da irgendwo nicht mehr. Offensichtlich hat sich das Interesse des Publikums gewandelt.
Martin Schlappner: Ich verstehe die Argumentation von Bernhard Giger und von Friedrich Kappeler. Bernhard Giger sagt, das Hauptpublikum, das heute ins Kino geht, das sind die Jungen, also muss man Filme machen, die die Jungen angehen. Es gibt aber auch das Argument der älteren Generation, die sagt, wir gehen die Schweizer Filme nicht mehr anschauen, weil sie nicht mehr mit Stoffen kommen, die wir verstehen, weil wir nicht mehr das Gefühl haben, dass in ihnen unser Land reflektiert und gespiegelt wird. Da liegt einer der Gründe für den Erfolg von Schweizermacher und Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner. Viele ältere Leute gingen sich diese Filme anschauen, weil für sie hier wieder Stoffe behandelt wurden, wie sie der traditionelle Schweizer Film früher behandelt hat.
Ich möchte nicht einfach sagen, dass sich das Interesse des Publikums verändert hat, sondern eine Anzahl von mitteljüngeren Filmemachern hat wieder Stoffe aufgegriffen, oder erachtet es als wichtig, sie wieder aufzugreifen, die über den Interessenbereich des jungen Publikums hinausgingen und die älteren Zuschauer wieder für den Schweizer Film mobilisierten.
Insofern möchte ich auch Bernhard Giger widersprechen. Ich muss ja nicht als Verteidiger von Kurt Gloor laufen, aber Die plötzliche Einsamkeit des Konrad Steiner hat nun ganz sicher ein Problem aufgegriffen. Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist eine ältere Bevölkerung. Ich finde es darum sehr erfreulich, dass ein jüngerer Filmschaffender ein Thema aufgegriffen hat, das die ältere Generation betrifft.
Friedrich Kappeler: Dies entkräftet jedoch das Argument von Bernhard nicht. Ich kann da aus der eigenen Erfahrung reden. Mein erfolgreichster Film war Müde kehrt ein Wanderer zurück, ich hab von dem, was ich mit ihm verdient habe, den zweiten Teil meiner Zeit auf der Filmschule bezahlt.
Die Alten sind ein dankbares Thema und ich kann mir vorstellen, dass es beim Kurt Gloor so eine Kombination war von dem Interesse an den alten Leuten einerseits und dem Schielen nach dem Erfolg andererseits. Der Beweis wäre die Liebesgeschichte, die für mich eindeutig eine Konzession ist und die ja irgendwo gar nicht stimmt vom Leben her.
Martin Schaub: Ich würde nicht von den Stoffen her operieren, sondern eher von den Formen her. Vor zwölf Jahren, als es einen Spielfilm in der Schweiz sozusagen nicht mehr gab, hat man ja gesagt, wir wollen Spielfilme machen und wir wollen andere Spielfilme machen, nicht melodramatische, nicht sentimentale Filme, sondern Filme, die durch eine neue Verwendung der Bilder und Töne ganz anders reden als jene, die man so gemeinhin im Kino anschaut. Nun habe ich in acht Jahren Arbeit im Begutachtungsausschuss der Sektion Film feststellen müssen, dass sich die eingereichten Drehbücher immer ähnlicher sehen. Da wird in einem «theoretischen Teil» bewiesen, dass man sich mit einem Stoff auseinandergesetzt hat - das geht bis zu langen Literaturangaben. Dann folgt das Drehbuch für eine Kinogeschichte, eine Fernsehgeschichte vielleicht sogar. Der Vorsatz, mit dem man gestartet war vor zwölf Jahren, nämlich neben Kinoformen vorbei zu zielen auf ganz spezifische Weise, ging allmählich verloren.
Ich habe in acht Jahren vielleicht dreissig Projekte gesehen, die Dokumentarspiele waren. Ich gebe ein ganz kleines Beispiel: Wenn Rolf Lyssy in seinen Recherchen über das Attentat von Davos gelesen hat, dass David Frankfurter zuerst einen Fehlschuss abgab, dann inszeniert er diesen Fehlschuss im Film, weil er genau sein will. Ich glaube, dass in einer ganz bestimmten Art von Kino, dem Kino von Lyssy und von Peter von Gunten, aber auch von Imhoof und Gloor, die Recherche, die Vorbereitung, sich in den Weg einer eigentlichen Fiktion gestellt hat. Der Deutschschweizer Film leidet an einer Angst vor der Fiktion, das macht dieses Kino so langweilig.
Angst vor der Fiktion
Martin Schlappner: Der Schweizer - und nicht nur der Schweizer Filmemacher, sondern auch der Schweizer Schriftsteller -hat vor der Fiktion tatsächlich eine verhältnismässige und manchmal unverhältnismässige Angst. Das hängt sehr wahrscheinlich zusammen mit unserer Mentalität, mit der sogenannten Nüchternheit, mit der Pragmatik unseres Lebens. Die Literatur, Gottfried Keller ganz ausgesprochen und höchstens als Ausnahme Conrad Ferdinand Meyer, hat das Schreiben immer didaktisch benutzt, um ins Volk zu wirken. Das hemmt nicht eigentlich die Phantasie, aber vielleicht das Ausleben, das Skrupellose der Phantasie.
Dazu kommt, und das betrifft jetzt speziell den Film, dass sich der Schweizer Spielfilm in allen seinen Anläufen aus dem Dokumentarfilm heraus entwickelt hat. Das kann man immer wieder sehen, dass das dokumentarische Erarbeiten der Realität die Grundlage des Spielfilms bildet. Auch der junge Schweizer Film, der Schweizer Film seit ungefähr zwanzig Jahren, seit Henry Brandts Quand nous étions petits enfants, hat versucht, das Dokumentarische zur Grundlage zu machen. Und in dem Moment, wo das Dokumentarische über die auf der Stirn getragene Plausibilität hinausging, wurden die Recherchen nötig, die sozialen, die soziologischen und die historischen.
Martin Schaub: Conrad Ferdinand Meyer ist genannt worden und ich würde jetzt noch Daniel Schmid dazunehmen. Conrad Ferdinand Meyer hat ja in seiner Novelle Die Richterin auch unglaubliche Recherchen getrieben. Zuerst ganz private - es ging um sein Verhältnis zu seiner Schwester, und das hat er nicht dokumentarisch darstellen können, darum hat er diesen Aufschwung gemacht, hat dieses ganze historische Kostüm darumgehängt. Er sprach von etwas, das ihn anging, ist aber sozusagen fast ausgewichen in die Fiktion. Daniel Schmid ist noch weitergegangen. Und es ist doch interessant, dass er ein Fremdling geblieben ist in dieser schweizerischen Filmszene, gerade deswegen, weil er sich im Grunde genommen, abgesehen von einer gewissen Fühligkeit und einer gewissen Sehnsucht nach Heimat, überhaupt nicht schert um irgendwelche dokumentarischen Hintergründe, sondern sofort abstösst in die Fiktion.
Mir kommt vor allem der Deutschschweizer Spielfilm manchmal so vor wie ein Pipe1, der nicht abheben kann. Und das ist das, was ich vorher meinte, was jetzt zum Teil kulturhistorisch erklärt worden ist.
Martin Schlappner: Ich erinnere mich an Fritz Strich, meinen Lehrer an der Universität Bern. Er hat die Schweizer Literatur unter den Obertitel «Zwischen Pflicht und Gefühl» gestellt. Das gilt zum Teil auch für den zum Aufbruch gewillten Schweizer Film. Er ist immer zwischen Gefühl, ich würde mal Emotion oder auch Phantasie sagen, und der Pflicht, dokumentarisch richtig zu liegen, ein Mass zu setzen, und zwar auch dort, wo man extreme Positionen einnimmt. Insofern ist Daniel Schmid eine Ausnahme.
Bernhard Giger: Aber Daniel Schmid hat eben etwas gemacht, was die anderen nicht gemacht haben. Er ist einfach mal losgezogen und hat dabei etwas gewagt. Das vermisse ich bei den anderen.
Martin Schlappner: Jetzt muss ich aber gerechtigkeitshalber fragen: Wollen sie’s überhaupt machen oder können sie es machen? Liegt ihr Talent nicht in einer ganz anderen Richtung?
Friedrich Kappeler: Ich hab’ da auch meine Bedenken. Wenn ich mir den Dokumentarfilm Gossliwiler Trilogie2 anschaue, dann entdecke ich da eine ähnliche Buchhaltermentalität, wie sie eben zum Teil auch in den vorher erwähnten Spielfilmen zu finden ist. Das Problem scheint mir da zu liegen, dass wir nicht wie in Deutschland eine Palette haben von Praunheim bis Straub, sondern dass bei uns ein Grossteil der Produktionen von der Mentalität her ähnlich gelagert sind.
Martin Schaub: Handke hat ein Stück mit dem Titel Die Unvernünftigen sterben aus geschrieben. Und wenn ich jetzt unvernünftig ersetze durch unverantwortlich, nicht pflichtbewusst, dann müsste ich einfach sagen, die sterben bei uns nicht aus - es gibt sie nicht. Man wagt sich nicht in die Freiheit der Phantasie und des Traums. Nun glaub ich aber, dass gerade dieses Abstossen von der Pflicht und Hineintauchen oder Aufsteigen in diesen Raum der Freiheit, dass das etwas Wunderschönes ist und dass es die neue Pflicht sein könnte. Wir reden immer von diesem Reich der Freiheit, das das Reich der Vorstellung ist und der Utopien, aber wir machen uns nicht auf den Weg. Ich finde den Spielfilm und auch den Dokumentarfilm manchmal deshalb so langweilig, weil er nur immer bis zum Bahnhof führt und nicht abfahrt. Und zwar den Themen nach, den Geschichten nach und den Formen nach.
Martin Schlappner: Sie sprechen von unvernünftigen Filmen, und Sie betrachten sicher Pazifik oder die Zufriedenen von Fredi M. Murer als einen unvernünftigen Film, einen der ersten Spielfilme - sagen wir der Einfachheit halber Spielfilm -, die Mitte der sechziger Jahre gekommen sind. Ich glaube, diese Art der Unvemünftigkeit ist heute sicher erschwert. Vorher wurden die Produktionsbedingungen angesprochen. Diese sind trotz aller Diskussion und aller Skepsis über die materielle Krise des Schweizer Films heute wesentlich besser als vor zehn Jahren. Dank der Bundeshilfe, dank dem Fernsehen, dank Geldern, die vermehrt doch von Kantonen, eventuell auch von Gemeinden und Privaten her fliessen, und dank dem Wiederentstehen von Produktionsinfrastrukturen.
Die Produktionsbedingungen sind etwas leichter geworden, sie werden dadurch vermehrt zu Sachzwängen, gerade, wenn dann die Budgets steigen, wie jetzt Kurt Gloors Der Erfinder auf 1,7 Millionen, Michel Soutters Les Repérages, den ich persönich ja sehr liebe, auch mit 1,7 Millionen. Damit wachsen wirtschaftliche, soziale Verantwortlichkeiten für die Equipe, für die Schauspieler usw., die natürlich gerade in unserem kleinen, wirtschaftlich schwachen Filmbereich die Hemmungen aufbauen, viel stärker aufbauen, als wenn man sogenannte unvernünftige Filme macht. Ich glaube, dass der unvernünftige Film in der nächsten Zeit ganz sicher nicht auf der Ebene des 35-mm-Dokumentar- oder Spielfilms kommen wird, weil dort eben diese Imponderabilien der wirtschaftlichen Produktion viel stärker geworden sind, und dass er weniger auf dem 16-mm-Bereich kommen wird, sondern ich habe - gegenüber meiner eigenen anfänglichen Skepsis - das Gefühl, dass die unvernünftigen Filme vermehrt beim S-8 kommen werden.
Bernhard Giger: Ich hoffe es zwar nicht, aber ich befürchte schon auch, dass die unvernünftigen Filme der nächsten Zeit vor allem S-8- oder Video-Produktionen sein werden. Ich glaube aber, dass es nicht nur die Produktionsbedingungen sind, und die höheren Produktionskosten, die das bedingen, sondern auch die heutige Kinosituation oder die Fernsehsituation. Es ist heute eine ganz grosse Ängstlichkeit festzustellen von Seiten der Verleiher und Kinobesitzer, den unvernünftigen oder den Aussenseiterfilmen gegenüber, es ist eine Ängstlichkeit da gegenüber dem 16-mm-Format, es gibt wenige Kinos, die 16-mm-Projektoren installieren. Wenn diese Leute endlich einmal den unvernünftigen Film, oder diesen kleinen Film entdecken, und nicht nur immer mit Vorurteilen an diesen herangehen würden, glaube ich, dass sich doch einiges ändern könnte.
Angebot und Nachfrage
Friedrich Kappeler: Eine grosse Misere in der Schweiz ist halt auch, dass es ausser dem Kellerkino in Bern kaum Orte gibt, wo man überhaupt unvernünftige Filme spielen kann. In Bern gibt es zwar das Kellerkino, aber keine städtische Spielstelle wie in Zürich. Dafür gibt es in Zürich kein Kellerkino. Dass das nicht richtig funktioniert hat mit dem Einrichten solcher Spielstellen, trägt wahrscheinlich auch noch bei zu dieser Angst der Verleiher und Kinobesitzer. Diese Ängstlichkeit und auch Mutlosigkeit hat sich dann ein wenig übertragen auf die Filmemacher.
Und dann muss man auch berücksichtigen, dass die Filmemacher zwischen vierzig und fünfzig plötzlich Familien haben, diverseste Gründe, warum sie sich nicht mehr in allzu grosse finanzielle Risiken stürzen wollen. Dazu kommt, dass die Leute, die sich jetzt fünfzehn Jahre lang mit dem Geld herumgeschlagen haben, auch - mal negativ ausgedrückt, -besitzorientierter geworden sind.
Bernhard Giger: Die Misere ist die, dass ein Film wie Ritorno a casa nicht in einem Studiokino mit hundert Plätzen zwei, drei Wochen in einer Stadt wie Bern laufen kann, oder noch schlimmer, dass das nicht einmal versucht wird. Und wenn die älteren Regisseure, aus mehr oder weniger verständlichen Gründen, irgendwie bequemer geworden sind und vielleicht mutloser, wenn diese Filmemacher, die ja den Schweizer Film heute noch immer tragen, nicht mehr mit unbequemen Filmen um den Platz im Kino kämpfen wollen, dann besteht doch die Gefahr, dass die in jahrelanger, harter Arbeit geschaffenen Grundlagen für ein anderes Kino zerfallen. Denn die Jungen haben da eine noch zuwenig gewichtige Stimme, um irgendwie aufzufallen. Ritorno a casa hatte ja selbst im Kellerkino grosse Schwierigkeiten, ein Publikum zu finden. Diese keineswegs hoffnungsvolle Situation scheint mir nicht zuletzt eine Folge davon zu sein, dass der Schweizer Film für das nicht besonders interessierte Publikum heute im grossen Kino stattfindet. Wie rasch sagt man sich doch: «Was soll ich mir denn noch Filme anschauen, die in einem tiefen, nicht gerade komfortablen Keller laufen, wo ich mir doch Filme aus der Schweiz im weichen Kinosessel anschauen kann.»
Martin Schaub: Der Fall Ritorno a casa ist ja kein Einzelfall. Tatsächlich haben heute diese Filme, die wir jetzt unvernünftig genannt haben, die wir aber auch extrem nennen können, extrem persönlich, formal extrem oder politisch extrem, in der Schweiz nicht mehr das Publikum, das sie gehabt haben vor einigen Jahren. Und ich glaube, dass das zum Teil eine Folge der Anpassung unserer ganz starken Regisseure an die herkömmlichen Kinoformen ist. Beispielsweise hat Claude Goretta während Jahren erzählt, er mache jetzt wieder einen kleinen Film, 16 mm, zweihunderttausend Franken Budget, mit und für Emigranten, einen sieben- oder achtsprachigen Film mit Direktton. Es hätte mich immer interessiert, diesen Film zu sehen, aber Goretta hat ihn nicht gemacht. Er ist der typische Fall eines älteren Regisseurs, der einen extremen Film in petto hat, der ihn aber immer wieder verschiebt und letztlich vergisst.
Ich glaube eben, dass diese ganze Generation der heute Vierzig- bis Fünfundfünf zigjährigen ihre extremen Filme immer in petto hatten, im Herz drin, dass sie aber für das Fernsehen, für das Kino gearbeitet haben und dadurch die junge Tradition des experimentelleren Films gebrochen haben.
Martin Schlappner: Mich beschäftigt, ausgehend von Ritorno a casa - vielleicht gibt es auch andere Beispiele, die mir jetzt nicht präsent sind -, der Mangel an Publikum, und auch an jungem Publikum, bei Stoffen dokumentarischer Art.
Bernhard Giger: Das überrascht mich - jedenfalls bei den Jungen - eigentlich nicht. Denn so, wie es eine Discojugend gibt, so gibt es auch eine Jugend, die wieder auf ganz konventionelle Filme steht, wie sie halt vor allem in Hollywood gemacht werden. Das kann dann soweit gehen, dass die Jungen Grease tatsächlich einen grossartigen Film finden. Wenn man in diesen Filmen drin wirklich etwas spürt, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass man in Schweizer Filmen auch etwas spürt.
Friedrich Kappeler: Neben der Discojugend gibt es auch noch jene, die jetzt in Zürich die Kulturrevolution macht. Wenn man sich überlegt, wie der Schweizer Film sich mit ihnen beschäftigt, ob er sich überhaupt mit ihnen beschäftigt, dann muss man begreifen, dass die sagen, ihr könnt uns am Arsch lecken, das ganze Zeugs geht uns nichts an. Vielleicht werden Video-Filme kommen, mit denen sie eher etwas anfangen können. Der Schweizer Film aber, der heute im Kino ist, geht die ja wirklich nichts mehr an. Wir als Macher haben weitgehend den Kontakt zu diesen Jungen verloren.
Martin Schaub: Meine Erfahrungen mit Jugendlichen beruhen auf Filmvorführungen bei Mittelschülern, und die sind es ja nicht, die jetzt das Theater auf der Strasse machen. Sie sagen aber ähnliches: «Uns geht das nicht viel an.» Und neben den Jugendlichen sind es auch Frauen, die oft über den Schweizer Film lästern. Es ist tatsächlich eine Schwäche des Schweizer Films, dass es wenige junge Identifikationsfiguren gibt und wenige starke Frauenfiguren.
Ich rede nur vom Angebot in den Kinos, in diesem Kino «zwischen Pflicht und Gefühl». Es ist ein Kino der biologisch und mentalitätsmässig zwischen fünfunddreissig und fünfundvierzig Jahre alten Männern, der «68er» eben. Und die können nicht über ihren Schatten springen.
Martin Schlappner: Das Thema unvernünftige Filme steht ja noch immer im Raum. Es gibt für mich einen herrlichen unvernünftigen Film, das ist der von Angelo Burri, der Wildwester The Wolfer. Das ist wirklich der erste schweizerische art brut-Film, zudem habe ich mich selten so gut amüsiert im Schweizer Kino.
Friedrich Kappeler: Und man hat im Schweizer Film noch nie eine derartige Liebesszene gesehen...
Aber etwas anderes scheint mir jetzt auch noch wichtig zu sein: Wir Regisseure haben eine relativ starke Tendenz, uns in ganz bestimmten Kreisen zu bewegen, in Kreisen, die unsere Arbeit mögen, unter Gleichgesinnten also. Wir haben die Verbindung verloren mit den Leuten, die ins Kino gehen, denn sonst könnte eigentlich das Erstaunen darüber, wie wenig Leute sich die Filme anschauen, die wir wichtig finden, Grauzone etwa, nicht so gross sein. Das ist irgendwie schon beängstigend.
Und wenn jetzt gewisse Leute sagen, dass das, was da so geschildert wird, das Milieu der fünfunddreissig- bis fünfund-vierzigjährigen Intellektuellen sei, oder der Linksliberalen oder weiss Gott was, darf man sich eigentlich nicht wundem darüber, dass dafür plötzlich historische Filme oder Komödien erfolgreich sind.
Im Bett der Mutter
Martin Schaub: Es ist vorher ein unvernünftiger Film genannt worden, den ich auch sehr mag, The Wolfer: Cinéma brat, aber mit einer unglaublichen Hingabe gemacht, man spürt das in jedem Detail. Es ist ein Film, den es eigentlich gar nicht geben kann: Über drei Jahre mit Freunden gedreht, immer wieder unterbrochen, wenn man kein Material oder Geld hatte. Weil dieser Film so entstanden ist, hat er seinen einzigartigen Reiz. Nun kann eine nationale Kinematografie nicht auf diese einzelnen Verrückten bauen. Strukturen sind nötig, Professionalität. Ich frage mich nur, ob man mit der professioneilen technischen Ausrüstung und den professionellen Equipen nicht etwas mehr an die Grenzen der Konvention oder darüber hinaus gehen könnte, als das gegenwärtig geschieht?
Friedrich Kappeler: Könnte man auf jeden Fall. Ich meine, das Problem liegt halt wahrscheinlich eher bei uns, bei den Machern, als bei den professionellen Ansprüchen. Zum Beispiel die Arbeit fürs Fernsehen: Tanner hat mal gesagt, wir3 hätten uns als Jünglinge zur reichen Dame Fernsehen ins Bett gelegt. Die Wahrheit ist aber noch verstörender, es ist eher so, dass wir uns als Jünglinge zu einer Mutter ins Bett gelegt haben, einer Mutter, die uns braucht und uns Aufgaben gibt, die uns liebt, aber auch genau sagt, wo die Liebe zu Ende ist. Und wenn die Filme zu zornig oder schon nur zu lang werden, dann befinden wir uns auf einem Terrain jenseits der Liebe.
Dieses Bedürfnis, mit dem Fernsehen zusammenzuarbeiten, ist wahrscheinlich aus der Unsicherheit heraus entstanden, welche Filme überhaupt gemacht werden sollen. Das ist irgendwo eine Absicherung, dass man nicht ins Leere fällt. Ich schliesse mich da voll ein. Obwohl ich diesen Film4 gern gemacht habe und er für mich auch eine Chance war, hätte ich es nicht gewagt, ihn unabhängig vom Fernsehen zu machen. Es haben halt sehr viele - auch ich - die Chance und den Moment abgewartet, wo solche Filme durch so eine Art Förderang möglich wurden. Das heisst aber auch, dass man zugleich viel von dem persönlichen Engagement zurücksteckt.
Martin Schlappner: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich im Zürcher Stadthaus eine Sitzung moderiert habe zwischen den Filmemachern und dem Fernsehen. Dort wurde mit heftigen Worten, mit mehr oder weniger guten Argumenten auf beiden Seiten um das Thema Fernsehfilm-Aufträge an Externe gestritten. Damals waren alle Filmschaffenden einhellig, wirklich einhellig der Auffassung, dass das Fernsehen bezahlen müsse. Heute bezahlt es - und jetzt kommt der Gegenschlag.
Man sagt, man verkaufe sich an das Fernsehen. Aber man muss doch einsehen, dass das Fernsehen wenigstens die Möglichkeit bietet, eine bestimmte Art von Filmen herzustellen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Formulierung von Friedrich Kappeler aufnehmen und sagen, man kann den Zorn nicht ausleben, man muss ihn bemessen - was ja wieder das mögliche Schweizerische wäre. Denn ich verstehe das, dass ein Programmdirektor die Verantwortung nicht nach draussen delegieren kann. Die liegt innerhalb des Hauses, bei dem Abteilungsleiter Dramatik, bei Max Peter Ammann, der meines Wissens ja sehr grosszügig ist, auch wenn er vielleicht bestimmte formale Vorstellungen hat, die nicht mit unseren harmonisieren. Ich frage mich, ob das wirklich eine Verarmung sein muss, wenn jetzt Filmemacher, die früher für das Kino oder den Parallelverleih gearbeitet haben, fürs Fernsehen arbeiten. Ich glaube, dass eine eigene Bildersprache auch beim Fernsehen durchgehalten werden kann, vielleicht nicht unbedingt in den Sendungen für das sogenannte Hauptprogramm. Man muss sich davor hüten, auch auf der Seite der Filmschaffenden, durch eine ablehnende Haltung dem Fernsehen gegenüber Möglichkeiten zu verbauen.
Martin Schaub: Ich möchte präzisieren, was ich meine, wenn ich warne vor diesen Nächten im Bett der Mutter. Ich bin der Meinung, dass gewisse Filmemacher den Anforderungen des Fernsehens zu rasch entsprochen haben, dass sie recht bequeme Partner wurden. Nicht alle, aber die älteren unter denen, die heute für das Fernsehen arbeiten, wollten vor zehn Jahren kleine Godards werden. Vorbild war ein Filmemacher, der das Kino neu erfand, es von innen her aufbrach.
Wenn ich aber heute schaue, was sie dem Fernsehen abliefern, dann frage ich mich, wo und mit welchen Gründen sie ihre Unbequemlichkeit und ihre Unvernunft abgegeben haben. Ich nehme das Beispiel Der Handkuss5, was ein feiner, in bestimmten Bereichen sogar gut gemachter Film ist. Für mich unterscheidet er sich nicht von irgendwelchen Filmen, die ich am Fernsehen täglich sehe. Aber es scheint mir fast komisch, wenn ich ihn auf dem Hintergrund alles dessen anschaue, was Seiler früher an Forderungen ans Fernsehen und an sich selber formuliert hat. Wie kam es zu dieser Abschleifung?
Martin Schlappner: Zur Verteidigung von Alexander J. Seiler: Ich habe den Film mit Amüsement angeschaut. Er hatte, was mich gerade bei Seiler überrascht, eine erstaunlich leichte Hand und eine duftige Art. Sie sagen: Das ist Fernseh-Art. Ich würde sagen, es hat gewisse Elemente drin, die vom kleinen Bildschirm her bestimmt sind, aber ich würde auch sagen, dass wenn dieser Film etwas kürzer wäre, er gewonnen hätte. Und wenn man ihn dann in der alten Art der fünfziger Jahre mit einem zweiten oder einem dritten zusammengehängt und einen Episodenfilm von zwei Stunden gemacht hätte, wäre etwas sehr Hübsches auch für das Kino daraus entstanden.
Friedrich Kappeler: Aber Filme wie Das gefrorene Herz von Xavier Koller und Der Handkuss sind ja Projekte, die mehr von den Autoren an das Fernsehen herangetragen wurden. Die Leute wollten das machen, und die stehen auch dazu. Bei der Diskussion, die wir in Leysin gehabt haben, hat der Tanner den Seiler schwer beschimpft, worauf Seiler geantwortet hat, dass er den Film so machen wollte.6 Die Kritik von Tanner sollte also eigentlich mehr gegen die Leute gehen, die diese Filme machen, und weniger gegen das Fernsehen.
Martin Schaub: Ich möchte auch nicht für alles nur die Institutionen verantwortlich machen, die Dramaturgie des Fernsehens oder die Filmförderung beim Bund, obwohl ich da auch gewisse Fremdbestimmungen sehe. Was mich stört, und das stört mich auch bei mir selber, dass ich extremer rede als handle, dass ich privat sehr extrem mit mir selber umgehe, und sobald es dann darauf ankommt, sobald es öffentlich wird, unglaublich zurückstecke. Also wieder dasselbe Phänomen, das Martin Schlappner vorher mit der Polarität von «Pflicht und Gefühl» umschrieben hat. Sie zeigt sich jetzt immer deutlicher im Schweizer Film.
Ein Film, den ich besonders schätze, ist Geschichte der Nacht, und da liegt das nicht vor. Da gibt es keine Differenz zwischen dem ideell formulierten Anspruch und der Durchführung.
Martin Schlappner: Darf man es den Älteren verargen, dass sie sich stärker anpassen? Michel Soutter erzählte mir bei den Dreharbeiten zu Repérages von seiner Angst, einen so teuren Film zu machen. Aber die Ansprüche der Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, seien auch gestiegen, dieser habe geheiratet und jener habe zwei Kinder, und die seien doch alle von ihm abhängig.
Ich verstehe diese Argumentation, ich habe auch meine Träume und Phantasien, vor die sich dann bei der täglichen Arbeit die Pflicht schiebt.
Bernhard Giger: Ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn ältere Filmemacher vorsichtiger werden. Nur müssten sie sich, gerade in diesem Land, doch auch ganz genau über die Konsequenzen im Klaren sein. Wenn jetzt die Sieben Todsünden entstehen, und jeder dieser Filme kostet eine halbe Million oder noch mehr, so gewöhnt man sich doch, auch und vielleicht vor allem bei den Auftraggebern, dem Fernsehen, an diese aufwendigen Produktionen. Es gibt heute Filmemacher, die, wenn sie fürs Fernsehen arbeiten, bei der Berechnung ihrer Kosten einfach ein altes, schon vorliegendes Budget eines Fernsehfilms kopieren.
Etwas anderes: Ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass wir auf Friedrich Kappeler hemmhacken, weil er einen teuren Fernsehfilm gemacht hat, schon dämm nicht, weil ich, als ich bei den Dreharbeiten für den Stolz war, das Gefühl hatte, dass er sich ganz wohl fühlt in der grossen Equipe. Stimmt das?
Friedrich Kappeler: Ich habe selber ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl bei dem ganzen Projekt. Ich hab’ ja bisher immer sehr billige Filme gemacht, Dokumentarfilme, und Stolz war mein erster Spielfilm, das erste Buch auch, das ich geschrieben habe. Und dann war da plötzlich viel mehr zur Verfügung, als ich bisher immer gehabt habe, plötzlich war da die Möglichkeit, Leute anzustellen, die einen als Unerfahrenen unterstützen können, die Möglichkeit, ohne finanzielle Krämpfe etwas zu machen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass die Equipe vielleicht schon zu gross war, aber weil es eine hervorragende Equipe war, hab’ ich mich auch wohl gefühlt mit ihr.
Veränderung einer Bewegung
Martin Schaub: Es gibt einen Film aus dem Jahr 1979, der nicht teurer war als einer von 1969, Schilten von Beat Kuert. Und es gibt einen Film, der nicht viel mehr als eine halbe Million gekostet hat, das ist Grauzone. Eigenartigerweise sind diese beiden Filme die Werke, die am deutlichsten gegen die Kinostandards und gegen die Kinokonventionen verstossen. Ich finde beide Filme, wenn wir das Wort weiter brauchen wollen, unvernünftig. Ich habe den Eindruck, dass diese Eskalation der Kosten die Kinostandards konsolidiert.
Der neue Schweizer Film ist vor fünfzehn Jahren angetreten mit der Zielsetzung, die Standards zu zerstören, sich nicht um sie zu kümmern. Darum bin ich auch so skeptisch gegenüber dem Fernsehen, denn die Auftragsproduktionen für das Fernsehen sind ebenfalls dazu angetan, die Standards weiter zu konsolidieren.
Martin Schlappner: Die Kostenexplosion im Schweizer Film beunruhigt mich auch. Nicht, weil ich finde, dass ein Film, der anderthalb Millionen kostet, deshalb schlechter sein muss als ein Film, der eine halbe Million kostet, sondern weil ich das Gefühl habe, dass die Produktionsbedingungen sowohl wirtschaftlich wie auch kulturell-geistig überfordert sind.
Ich glaube, dass ein Filmemacher, der einen teuren Film gemacht hat, den nächsten deshalb nicht noch teurer machen muss. Ich erinnere da an Hitchcock. Wenn er einen Vier- oder Fünf-Millionen-Dollar-Film gemacht hat, hat er gesagt, das ist viel zu teuer, jetzt mache ich einen Film für eine Million. Die Möglichkeit, dass man wieder zurückschraubt und billigere Filme macht, besteht durchaus.
Martin Schaut: Ich gehe, seit wieder Spielfilme gemacht werden in der Schweiz, zu Dreharbeiten. Und ich erschrecke immer mehr, weil so viele Leute hemmstehen. Früher arbeiteten alle in Doppel- und Dreifachfunktionen, heute ist es wie bei internationalen Filmen.
Martin Schlappner: Jetzt muss ich, ohne dass ich in den Geruch eines Reaktionärs kommen möchte, etwas sagen: Hängt die Kostenexplosion nicht auch zum Teil mit dieser Syndikalisierung der Filmtechniker zusammen, von Leuten, die plötzlich alle beschäftigt sein müssen? Ich gönne jedem sein tägliches Brot, das müssen Sie nicht falsch verstehen, aber wenn die Equipen so aufgeblasen werden und noch, gerade beim Fernsehen, eine grosse Bürokratie dazukommt, dann geht doch viel verloren von der Art, wie früher in der Schweiz gearbeitet wurde.
Martin Schaub: Ich sehe keine Lösung des Problems, sondern stelle einfach im Moment mal fest, dass beispielsweise die Kommunikation innerhalb grosser Equipen viel schwerer ist, und ich sehe da eine institutionalisierte Unpersönlichkeit der Filme heranwachsen.
Wenn ich noch einmal auf die Standards zurückkommen darf, und auf die Entwicklung, die der neue Schweizer Film genommen hat, würde ich provokativ formulieren: Vor fünfzehn Jahren haben alle gesagt, wir wollen Filme machen, wie sie noch keiner gesehen hat. Ich glaube, dass da eine qualitative Veränderung einer Bewegung stattgefunden hat.
Martin Schlappner: Das ist sicher richtig, die Frage ist nur, muss man das bedauern oder nicht bedauern. Ich glaube, das liegt in der Notwendigkeit einer Entwicklung: Man hat sich durchgesetzt, man hat, indem man sich durchgesetzt hat, Filme gemacht, die man vorher nie gesehen hat. Dabei hat man sich mehr und mehr etabliert und durch die Qualität, die entstanden ist, hat man eine Basis, die wirtschaftliche zuallererst, erarbeitet, und die entwickelt von sich aus wieder Zwänge, personell, ökonomisch. Zwänge, die dann zu einer Stabilisierung, zu einer Etablierung des Begonnenen führen.
Diese Entwicklung kennt man ja nicht nur aus der Schweiz, bei der Nouvelle Vague ist es gleich gegangen, auch beim englischen Free Cinema und beim jungen polnischen Film. Aber für mich ist in der Schweiz die Erstarrung, wenn man von Erstarrung reden will, die Festigung gewisser Formen des Kinos noch nicht soweit fortgeschritten, wie sie damals, als die heute Älteren angefangen haben, im Schweizer Film war. Die Erstarrung ist noch nicht soweit, dass die Explosion der Jüngeren unbedingt stattfinden müsste, der Druck ist noch zu wenig stark, damit die Jungen wieder rebellieren und auf ihre Art von vorne anfangen müssten.
Bernhard Giger: Die Etablierung im Schweizer Film - die ich schon eine Erstarrung nennen möchte - könnte aber so weit gehen, dass die Jungen, oder einfach die Leute, die anfangen möchten, Filme zu machen, den Mut verlieren, oder dass sie dann Filme machen, die sie eigentlich gar nicht machen möchten, weil man andere Filme in der Schweiz nicht mehr machen kann.
Dafür ein Beispiel: Während den Solothurner Filmtagen hat der Präsident der Filmgestalter, Hans-Ulrich Schlumpf, bei einer öffentlichen Diskussion einem jüngeren Kollegen, der seinen ersten langen Spielfilm gezeigt hat - ein Film, der nicht ganz gelungen ist7 - nahegelegt, vielleicht daran zu denken, wieder ein paar Kurzfilme zu machen. Vermutlich hat Hans-Ulrich Schlumpf das nicht ganz so hart gemeint, wie es getönt hat, aber ich sehe darin doch eine Überheblichkeit, die mir gar nicht gefällt und die ich irgendwo schon fast gefährlich finde.
Martin Schaut: Es sei denn, sie provoziere eben diese Wut, sie provoziere die Jungen so sehr, dass sie wirklich aufstehen gegen die Alten.